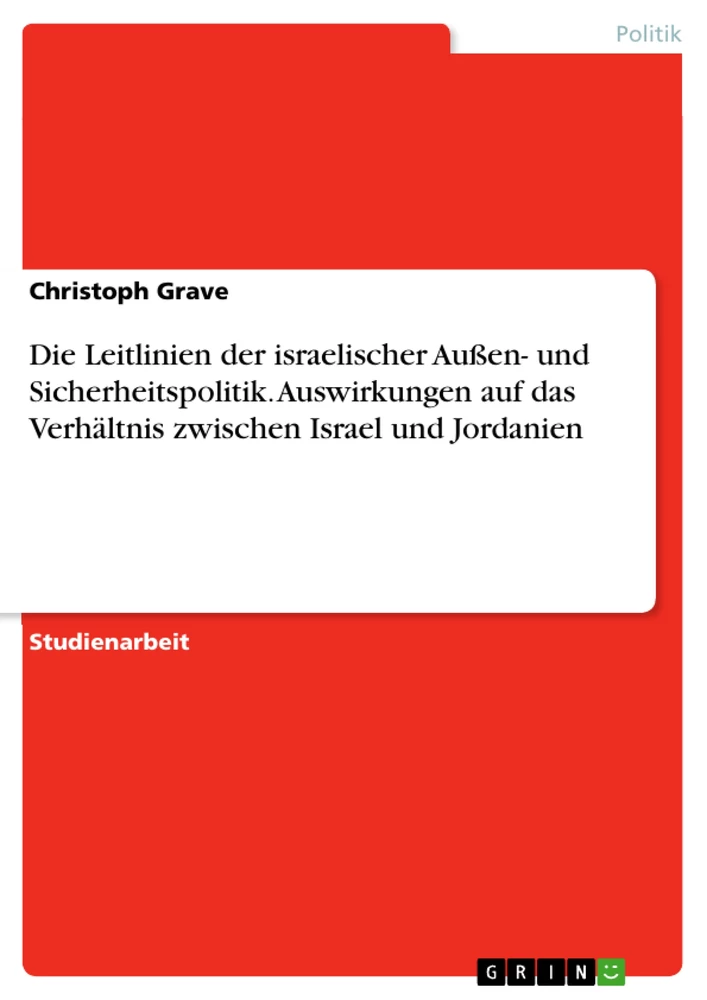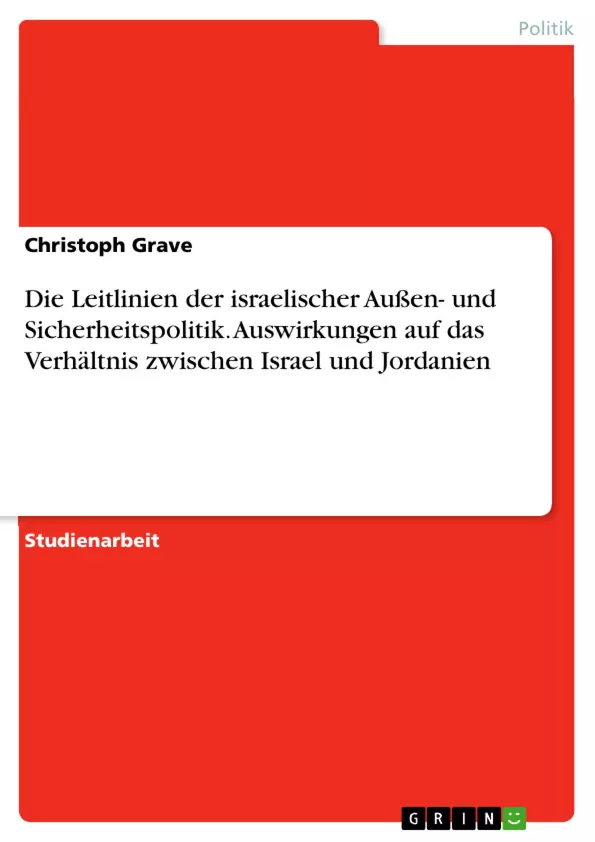Sicherheit ist ein menschliches Grundbedürfnis. Dieses im Rahmen der staatlichen Außen- und Sicherheitspolitik zu gewährleisten ist eine Grundfunktion des modernen Staates. Die Erwartungen der Bevölkerung an den Staat sind hoch, doch ist es enorm schwierig diesen gerecht zu werden. Wieso das so ist zeigt sich bereits in dem Grundproblem der Definition des Begriffs Sicherheit. „Dieser beschreibt keinen fassbaren Gegenstand, sondern ein facettenreiches Konzept, welches individuell-persönliche wie auch kollektive Dimensionen, etwa auf der nationalen bzw. gesellschaftlichen Ebene, aufweist“ (Gareis 2015: 4).
Betrachtet man vor diesem Hintergrund die israelische Außen- und Sicherheitspolitik, so wird das Erfassen des Begriffs Sicherheit nicht gerade einfacher. Die israelische Außen- und Sicherheitspolitik ist vor allem durch das Verhältnis mit den direkten Nachbarstaaten geprägt. Je nachdem in welcher Weise sich das politische Umfeld wandelt, wandelt sich auch die Außen- und Sicherheitspolitik. Sicherheit in Israel ist somit – wie auch in anderen Staaten – kein statisches sondern ein dynamisches Konstrukt. Seit den politischen Umbrüchen in Israels Nachbarstaaten Ägypten, Syrien und Jordanien, die im Dezember 2010 begannen, hat sich die außen- und sicherheitspolitische Agenda des Landes nachhaltig verändert. Während vor allem westliche Staaten die Umbrüche in der arabischen Welt begrüßten, stand Israel den neuen Entwicklungen in ihrer Nachbarschaft von Beginn an skeptisch gegenüber.
Mit Blick auf diese Veränderungen soll Ziel dieser Hausarbeit sein Leitlinien der israelischen Außen- und Sicherheitspolitik aufzuzeigen und diese am Beispiel Jordaniens zu verdeutlichen. Die Arbeit unterteilt sich hierbei in zwei Teile. Im ersten Teil werden die wichtigsten Leitlinien der israelischen Außen- und Sicherheitspolitik pointiert dargestellt. Dabei erfolgt der Zugriff durch eine kurze historische Herleitung, die oftmals die aktuellen Reaktionen Israels verdeutlichen. Im zweiten Teil werden die Beziehungen zu Jordanien näher betrachtet und versucht, die in Teil eins herausgearbeiteten Leitlinien an den bilateralen Abkommen der beiden Staaten aufzuzeigen. Im Fazit werden die wichtigsten Erkenntnisse kurz und bündig zusammengestellt und ein Ausblick auf die mögliche Entwicklung dieser Beziehung gestellt.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen und Hintergründe israelischer Außen- und Sicherheitspolitik
- 2.1. Strategische Partnerschaften
- 2.2. Die Dominanz der Sicherheitsfrage
- 2.3. Der Palästinenserkonflikt
- 2.4. Paradigmen israelischer Außen- und Sicherheitspolitik
- 3. Israel und Jordanien
- 3.1. Vom Krieg zum Frieden
- 3.2. Paradigmen der israelischen Außen- und Sicherheitspolitik am Beispiel Jordaniens seit der Unterzeichnung des Friedenvertrages 1994
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Ziel dieser Hausarbeit ist es, Leitlinien der israelischen Außen- und Sicherheitspolitik aufzuzeigen und diese am Beispiel Jordaniens zu verdeutlichen. Die Arbeit unterteilt sich hierbei in zwei Teile. Im ersten werden die wichtigsten Leitlinien der israelischen Außen- und Sicherheitspolitik pointiert dargestellt. Dabei erfolgt der Zugriff durch eine kurze historische Herleitung, die oftmals die aktuellen Reaktionen Israels verdeutlichen. Im zweiten Teil werden die Beziehungen zu Jordanien näher betrachtet und versucht, die in Teil eins herausgearbeiteten Leitlinien an den bilateralen Abkommen der beiden Staaten aufzuzeigen.
- Die Herausforderungen der israelischen Außen- und Sicherheitspolitik
- Die Rolle strategischer Partnerschaften in der israelischen Sicherheitspolitik
- Die Dominanz der Sicherheitsfrage in der israelischen Außen- und Sicherheitspolitik
- Der Einfluss des Palästinenserkonflikts auf die israelische Außen- und Sicherheitspolitik
- Die Entwicklung der israelisch-jordanischen Beziehungen
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung stellt die Bedeutung von Sicherheit als menschliches Grundbedürfnis und die zentrale Rolle der staatlichen Außen- und Sicherheitspolitik dar. Es wird auf die Komplexität des Begriffs Sicherheit und die Herausforderungen der israelischen Außen- und Sicherheitspolitik in einem unsicheren Umfeld hingewiesen.
Kapitel 2: Grundlagen und Hintergründe israelischer Außen- und Sicherheitspolitik
Dieses Kapitel beleuchtet die wichtigsten Leitlinien der israelischen Außen- und Sicherheitspolitik, die durch die Umbrüche in der Region und die Entwicklungen im Nahostkonflikt geprägt sind. Es werden die strategischen Partnerschaften, die Dominanz der Sicherheitsfrage, der Einfluss des Palästinenserkonflikts sowie die Paradigmen der israelischen Außen- und Sicherheitspolitik dargestellt.
Kapitel 3: Israel und Jordanien
Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung der israelisch-jordanischen Beziehungen vom Krieg zum Frieden und analysiert die Auswirkungen der israelischen Sicherheitspolitik auf das bilaterale Verhältnis. Es werden insbesondere die Paradigmen der israelischen Sicherheitspolitik am Beispiel Jordaniens seit der Unterzeichnung des Friedenvertrages 1994 beleuchtet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Israelische Außen- und Sicherheitspolitik, Nahostkonflikt, Palästinenserkonflikt, Strategische Partnerschaften, Sicherheitsfrage, Jordanien, Friedensprozess, bilaterale Beziehungen, regionale Konflikte.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Kernleitlinien der israelischen Sicherheitspolitik?
Die Politik ist geprägt von der Dominanz der Sicherheitsfrage, dem Streben nach strategischen Partnerschaften und der Reaktion auf Bedrohungen aus dem direkten Umfeld.
Wie hat sich das Verhältnis zwischen Israel und Jordanien entwickelt?
Das Verhältnis wandelte sich von einem Zustand des Krieges hin zu einem stabilen Frieden, der im Friedensvertrag von 1994 formalisiert wurde.
Welchen Einfluss hat der Palästinenserkonflikt auf die Außenpolitik?
Der Konflikt ist ein zentrales Element, das die Beziehungen zu allen arabischen Nachbarn, einschließlich Jordanien, und die internationale Wahrnehmung Israels maßgeblich beeinflusst.
Wie wirkte sich der „Arabische Frühling“ auf Israels Sicherheitsagenda aus?
Die politischen Umbrüche in Nachbarstaaten wie Ägypten und Syrien führten zu einer skeptischeren und dynamischeren Anpassung der israelischen Sicherheitsstrategie.
Warum gilt Sicherheit in Israel als „dynamisches Konstrukt“?
Weil sich das Konzept von Sicherheit ständig an das wandelnde politische und militärische Umfeld in der Region anpassen muss.
- Citar trabajo
- B.Ed. Christoph Grave (Autor), 2015, Die Leitlinien der israelischer Außen- und Sicherheitspolitik. Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen Israel und Jordanien, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/313664