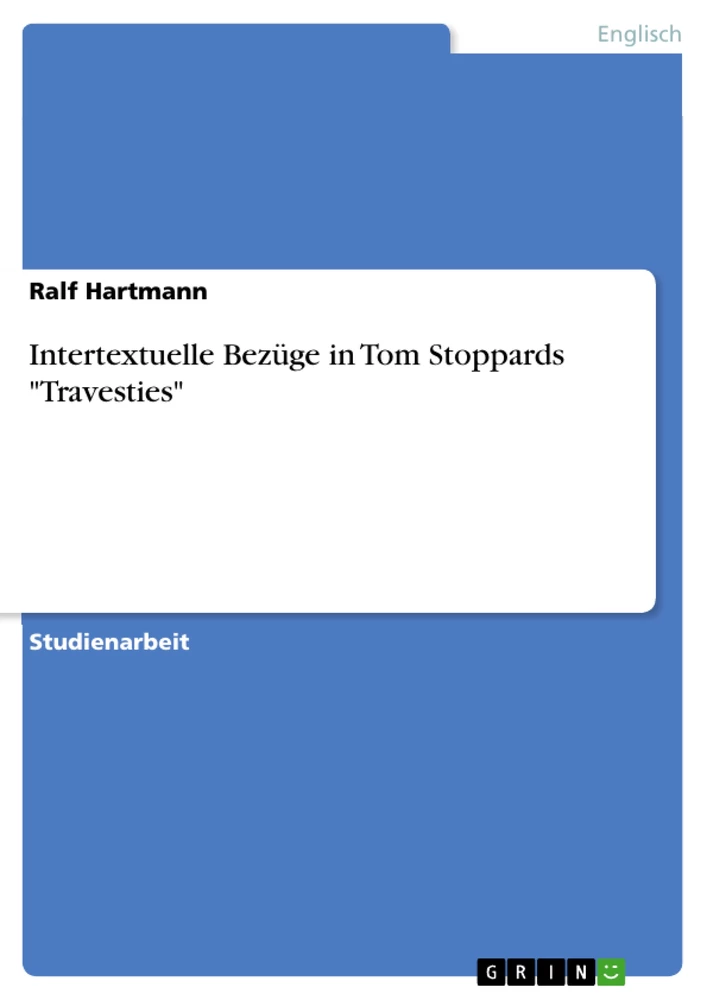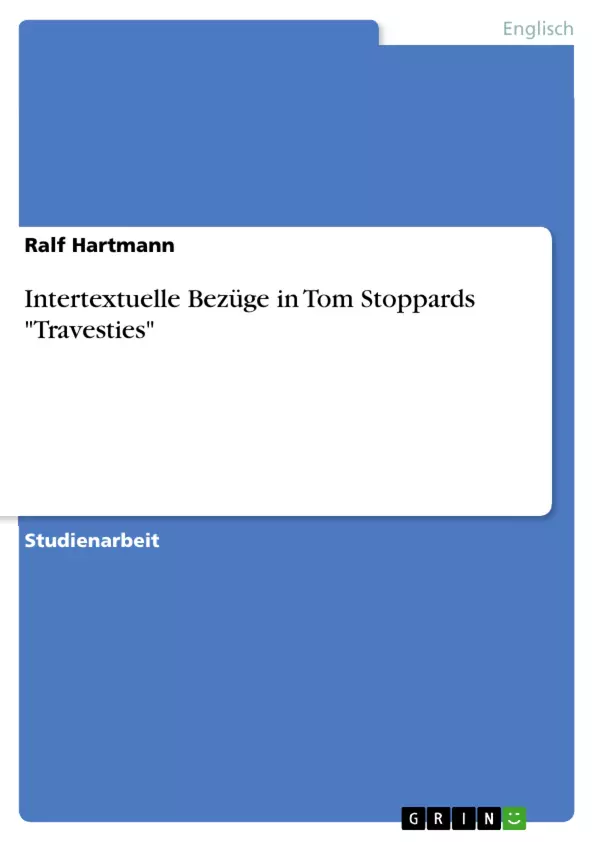Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die intertextuellen Bezüge in Tom Stoppards „Travesties“ möglichst vollständig zusammenzutragen. Zu diesem Zweck erscheint es ratsam, eine Definition des Begriffes „Intertextualität“ vorauszuschicken, da sowohl der Terminus selbst als auch ein dahinterstehendes Konzept nicht eindeutig zu bestimmen sind.
„Intertextualität“ war von Beginn an nicht klar umrissen, hat in der Folge die verschiedensten Bedeutungsnuancen aufgenommen und hat, ausgehend vom Bereich der Literaturwissenschaft über die Semiotik bis hin zur Kulturwissenschaft, vielfach Beachtung gefunden. Es ist deshalb nötig, die zugrundeliegende Problematik kurz zu besprechen und ein einigermaßen vertretbares Fundament zu finden, von dem aus das Stopparddrama auf seine Intertextualität hin analysiert werden kann.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- I. Einführung
- II. Intertextualität in der Literaturwissenschaft
- 1. Bachtin
- 2. Kristeva
- 3. Markierung von Intertextualität
- III. Intertextualität in Tom Stoppards Travesties
- 1. Sekundäre Bezüge
- 2. Shakespeare - Tzara
- 3. Joyces Ulysses
- 4. Wildes The Importance of Being Earnest
- IV. Bewertung der intertextuellen Bezüge
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Ziel dieser Arbeit ist es, die intertextuellen Bezüge in Tom Stoppards Drama Travesties möglichst vollständig zusammenzutragen. Dazu wird zunächst eine Definition des Begriffs "Intertextualität" vorgestellt, die unterschiedliche wissenschaftliche Ansätze berücksichtigt.
- Die verschiedenen Konzepte der Intertextualität im literaturwissenschaftlichen Diskurs
- Die Rezeption und Weiterentwicklung von Bachtins Dialogizität im Werk von Julia Kristeva
- Die verschiedenen Formen der Markierung intertextueller Bezüge
- Die Analyse der intertextuellen Bezüge in Stoppards Travesties anhand von Genettes Kategorien und Pfisters Kriterien
- Die Bewertung der intertextuellen Bezüge in Stoppards Travesties im Hinblick auf die Bedeutung und Funktion von Intertextualität in der Literatur
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel widmet sich der Einführung und stellt den thematischen Kontext von Stoppards Drama Travesties vor. Es beleuchtet die Problematik der Verselbstständigung von Textualität und die damit verbundene Herausforderungen für die Interpretation von kulturellen Zeichen.
Kapitel II beleuchtet das Konzept der Intertextualität in der Literaturwissenschaft. Es diskutiert die Ansätze von Michail Bachtin und Julia Kristeva, die sich mit dem Phänomen der Intertextualität auseinandersetzen. Das Kapitel thematisiert außerdem verschiedene Formen der Markierung von Intertextualität.
Kapitel III analysiert die intertextuellen Bezüge in Tom Stoppards Travesties. Es beleuchtet verschiedene Arten von sekundären Bezügen und untersucht den Einfluss von Shakespeare, Joyce und Wilde auf das Stück.
Schlüsselwörter (Keywords)
Intertextualität, Dialogizität, Travestie, Tom Stoppard, James Joyce, Oscar Wilde, Tristan Tzara, Shakespeare, Ulysses, The Importance of Being Earnest, Literaturwissenschaft, Textualität, Kultur, Semiotik, Kunst, Drama.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Intertextualität in Tom Stoppards „Travesties“?
Es beschreibt die vielfältigen Bezüge des Dramas auf andere literarische Texte, wie Werke von Shakespeare, Joyce und Wilde, die miteinander verwoben werden.
Welchen Einfluss hat James Joyces „Ulysses“ auf das Stück?
Joyce ist eine Figur im Stück, und „Travesties“ nutzt Strukturen und Motive aus „Ulysses“, um die Komplexität von Literatur und Geschichte zu thematisieren.
Wie wird Oscar Wildes „The Importance of Being Earnest“ genutzt?
Stoppard parodiert Wildes Komödie und nutzt deren Handlungsgerüst, um die Begegnung historischer Persönlichkeiten in Zürich spielerisch darzustellen.
Was ist Kristevas Konzept der Intertextualität?
Julia Kristeva prägte den Begriff und sieht jeden Text als ein Mosaik von Zitaten, das in ständigem Dialog mit anderen Texten steht.
Welche Rolle spielt Tristan Tzara in dem Drama?
Tzara repräsentiert den Dadaismus. Sein Konflikt mit Joyce über den Sinn von Kunst ist ein zentrales intertextuelles und philosophisches Thema des Stücks.
- Quote paper
- Ralf Hartmann (Author), 1998, Intertextuelle Bezüge in Tom Stoppards "Travesties", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/313678