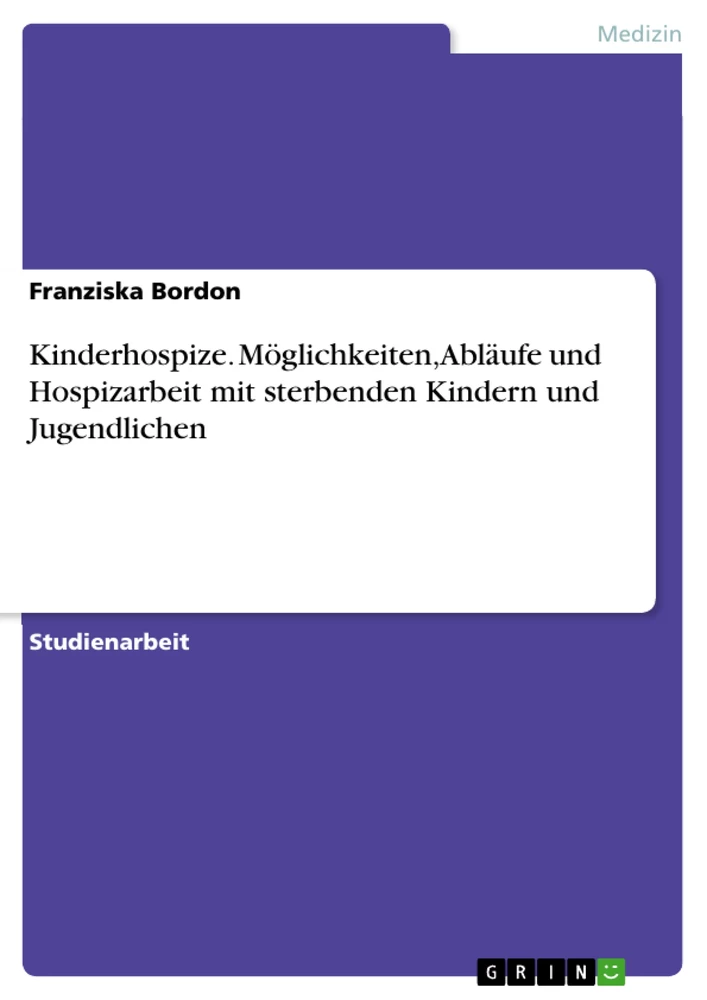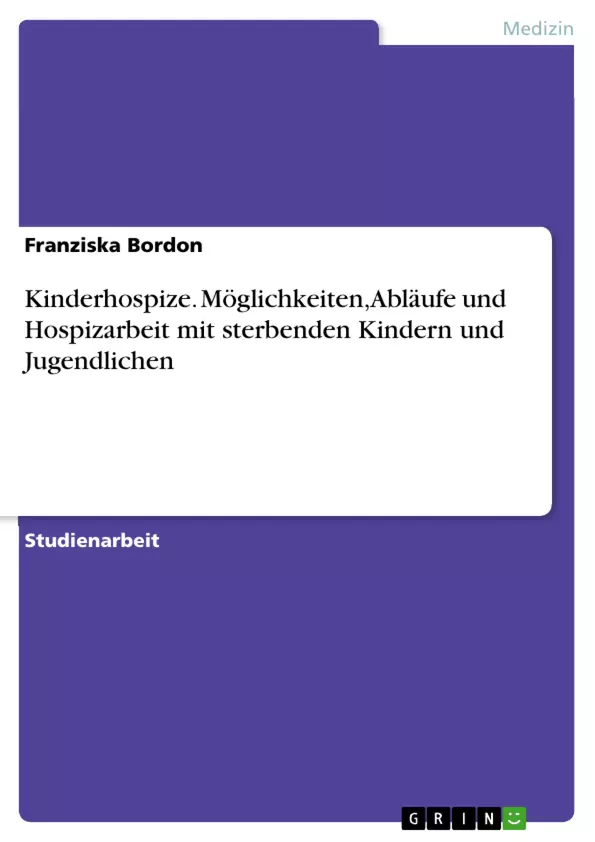Das Thema dieser wissenschaftlichen Arbeit lautet Kinderhospiz - Möglichkeiten, Abläufe und Hospizarbeit mit sterbenden Kindern und Jugendlichen.
Ich habe dieses "Schatten"-Thema gewählt, da es für viele Menschen ein Tabuthema ist. Über den Tod im Kindes- und Jugendalter wird nicht gerne gesprochen, denn, dass ein Kind oder ein Jugendlicher sterben könnte, ist für viele nicht vorstellbar und passt nicht in das vorhandene Weltbild der Menschen hinein. Dabei sterben in Deutschland jährlich rund 5000 Kinder oder Jugendliche an einer Krankheit die ihr junges Leben noch einmal verkürzt. Über diese Zahl muss nachgedacht und diskutiert werden, denn genau so wie Erwachsene haben auch Kinder und Jugendliche ein Recht auf einen angemessenen und würdevollen Ort, an dem sie friedlich und ohne Schmerzen, im Beisein ihrer Familie sterben können. Das Ziel dieser wissenschaftlichen Arbeit ist Vorurteile, Ängste und Hemmungen abzubauen und das Thema Kinderhospiz für jeden verständlich, ehrlich und offen darzustellen.
Diese Arbeit soll dem Leser einen kurzen Einblick in die Aufnahmekriterien, die Tagesstruktur und die Hilfsmöglichkeiten eines Kinderhospiz geben und die Gefühlswelten von Kindern und Jugendlichen mit einer lebensverkürzten Erkrankung aufzeigen. Neben der Hospizarbeit mit sterbenden Kindern und Jugendlichen und einer Beschreibung über die Palliativ Care Arbeit, erfolgt im letzten Abschnitt die Erläuterung der 5 Sterbephasen von Elisabeth Kübler-Ross.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Kinderhospiz
- Aufnahmekriterien
- Tagesablauf
- Hilfemöglichkeiten für Familien
- Hospizarbeit mit sterbenden Kindern und Jugendlichen
- Die Sterbephasen nach Elisabeth Kübler-Ross
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Ziel dieser wissenschaftlichen Arbeit ist es, Vorurteile, Ängste und Hemmungen im Zusammenhang mit dem Thema Kinderhospiz abzubauen und das Thema für jeden verständlich, ehrlich und offen darzustellen.
- Aufnahmebedingungen und Tagesablauf in Kinderhospizen
- Hilfestellungen für Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern und Jugendlichen
- Emotionale Aspekte der Erkrankung und des Sterbens aus der Sicht von Kindern und Jugendlichen
- Palliativ Care Arbeit in Kinderhospizen
- Die fünf Sterbephasen nach Elisabeth Kübler-Ross
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema Kinderhospiz ein und erläutert die Relevanz des Themas angesichts der Tatsache, dass jährlich rund 5000 Kinder und Jugendliche in Deutschland an einer Krankheit sterben, die ihr Leben verkürzt. Das Ziel der Arbeit ist es, ein Verständnis für Kinderhospiz und die Bedürfnisse der Familien zu fördern.
Kinderhospiz
Der Abschnitt erklärt die allgemeine Bedeutung des Wortes Hospiz als ganzheitliches Konzept für die Betreuung und Unterstützung sterbender Menschen. Es werden die Anfänge der Kinderhospizarbeit in England und Deutschland dargestellt sowie die Arbeit in einem Kinderhospiz und die Bedeutung der Familienbetreuung erläutert.
Aufnahmekriterien
Hier werden die Kriterien für die Aufnahme in ein Kinderhospiz beschrieben und die verschiedenen Phasen von lebensverkürzenden Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen, wie z.B. Krebserkrankungen, Mukoviszidose und andere schwere Erkrankungen, erläutert. Die ACT (Association for Children with life threating or terminal Conditions and their Families) klassifiziert diese Erkrankungen in vier Kategorien, die in diesem Abschnitt näher beleuchtet werden.
Schlüsselwörter (Keywords)
Kinderhospiz, lebensverkürzende Erkrankung, Palliativ Care, Sterbebegleitung, Familienbetreuung, Elisabeth Kübler-Ross, Sterbephasen, ACT (Association for Children with life threating or terminal Conditions and their Families), Interdisziplinäres Team, Familienarbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Aufgabe eines Kinderhospizes?
Ein Kinderhospiz bietet sterbenden Kindern, Jugendlichen und ihren Familien einen würdevollen Ort für die letzte Lebensphase, mit Fokus auf schmerzfreies Sterben und ganzheitliche Betreuung.
Welche Aufnahmekriterien gelten für ein Kinderhospiz?
Aufgenommen werden Kinder und Jugendliche mit lebensverkürzenden Erkrankungen (z. B. Krebs, Mukoviszidose), die nach ACT-Kriterien in vier Kategorien unterteilt werden.
Was sind die 5 Sterbephasen nach Elisabeth Kübler-Ross?
Die Phasen umfassen: Nicht-wahrhaben-Wollen/Leugnen, Zorn, Verhandeln, Depression und schließlich Hinnahme/Akzeptanz.
Wie werden die Familien im Kinderhospiz unterstützt?
Die Unterstützung umfasst psychosoziale Begleitung, Entlastung im Alltag, Geschwisterarbeit und Trauerbegleitung für die gesamte Familie.
Was bedeutet Palliative Care bei Kindern?
Es handelt sich um eine aktive, ganzheitliche Pflege und Betreuung, die körperliche Symptome lindert und psychologische sowie spirituelle Bedürfnisse berücksichtigt.
- Quote paper
- Franziska Bordon (Author), 2015, Kinderhospize. Möglichkeiten, Abläufe und Hospizarbeit mit sterbenden Kindern und Jugendlichen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/313696