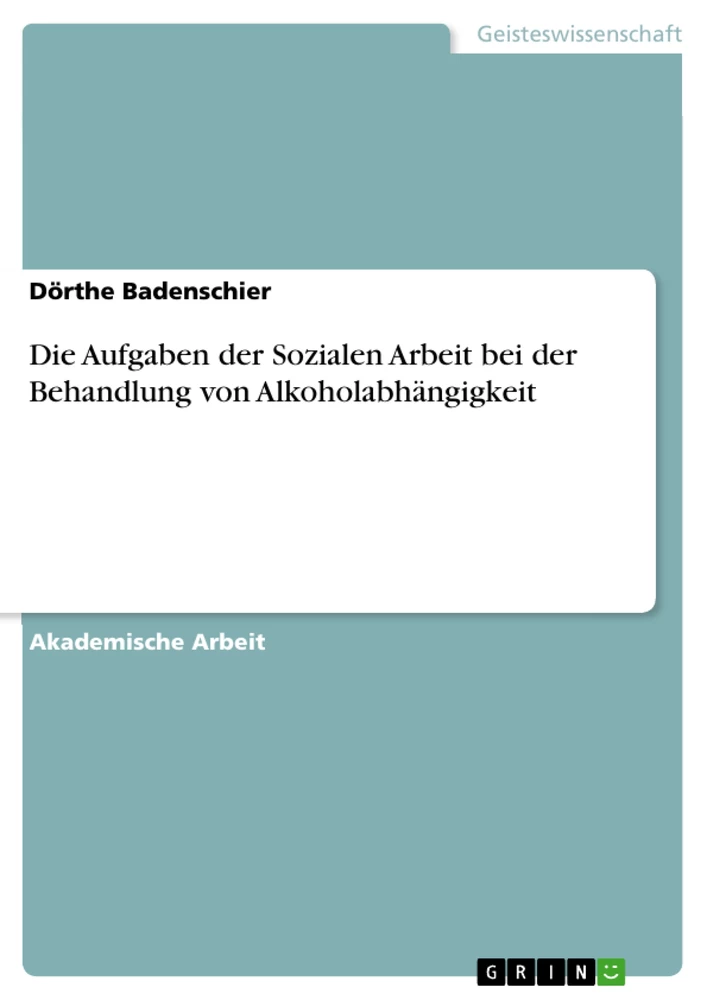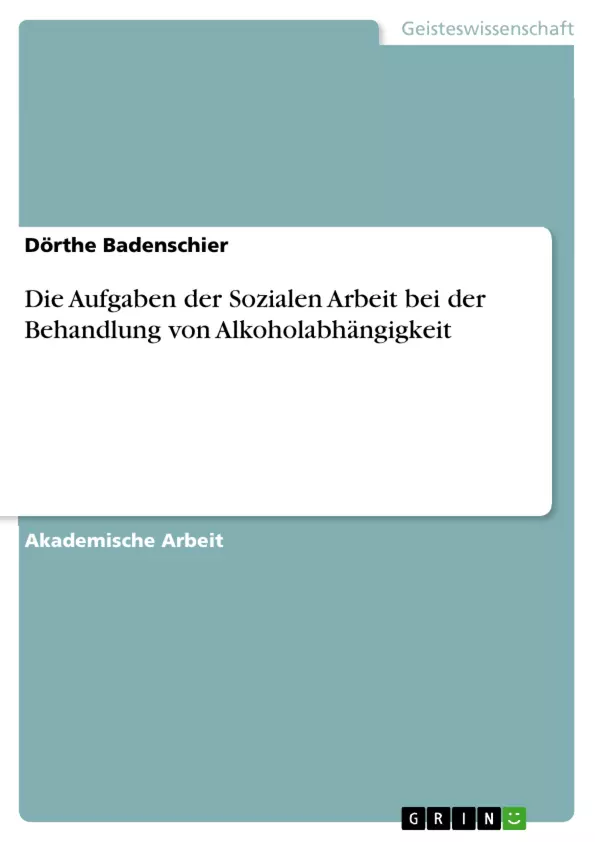Diese Arbeit stellt die Grundlagen der Sozialen Arbeit im Zusammenhang mit Alkoholabhängigkeit vor: Welche Aufgaben fallen an und was übernimmt hierbei die Soziale Arbeit? Welche Profession trägt die Verantwortung für den Behandlungsprozess? Gibt es Absprachen zwischen den Professionen, die eine gelingende Kooperation möglich machen?
Die Frage, ab wann der Genuss von Alkohol zu einer behandlungsbedürftigen Krankheit wird, stellt sich nicht nur dem einen oder anderen Konsumenten, sondern auch vielen Fachleuten. Aufgrund erheblicher Verträglichkeitsunterschiede zwischen den Konsumenten ist es nicht nur eine Frage der konsumierten Menge, ob eine Alkoholabhängigkeit entsteht.
Mit der Menge des Alkohols steigt jedoch das individuelle Risiko, alkoholbedingt zu erkranken sowie für sich und Andere physischen, psychischen und sozialen Schaden zu verursachen. Die Einstellung in der Bevölkerung zum Thema Alkohol ist ambivalent. Viele Menschen wissen wenig über das Phänomen der Alkoholabhängigkeit und können „... sich gar nicht vorstellen, dass die beruflich und gesellschaftlich anerkannten und erfolgreichen Konsumenten legaler Drogen an einer ernstzunehmenden Krankheit oder Störung leiden sollen“ (Trost 2002, S. 278). Das Thema wird unter den Konsumenten nicht ernst genug genommen, wodurch bis zu einer effektiven Behandlung oft viele Jahre vergehen.
In der Fachwelt wird die Thematik der Alkoholabhängigkeit seit einigen Jahrzehnten umfassend untersucht und ausführlich dokumentiert. Die vorliegende Diplomarbeit fügt hier einen neuen und aktuellen Baustein ein: Das aus den USA stammende verhaltenstherapeutische Konzept des Community Reinforcement Approach zur Behandlung alkoholabhängiger Menschen wird als Tätigkeitsfeld der Sozialen Arbeit im deutschen Suchthilfesystem beleuchtet.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Soziale Arbeit in der Behandlung alkoholabhängiger Menschen.
- Das Profil der Sozialen Arbeit in der Behandlung alkoholabhängiger Menschen...........
- Soziale Arbeit im Suchthilfesystem
- Klinische Sozialarbeit.
- Aufgaben der Sozialen Arbeit im Suchthilfesystem
- Soziale Arbeit in der Sucht- und Drogenberatungsstelle (Kontaktphase).………………………………..\n
- Soziale Arbeit in der Entzugsbehandlung ..
- Soziale Arbeit in der Entwöhnungsbehandlung ..
- Soziale Arbeit in der Nachsorge...\n
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Diplomarbeit untersucht den Community Reinforcement Approach (CRA) zur Behandlung alkoholabhängiger Menschen im Kontext der Sozialen Arbeit im deutschen Suchthilfesystem. Ziel ist es, das Konzept des CRA, das aus den USA stammt, mit den spezifischen Aufgaben und Herausforderungen der Sozialen Arbeit in Deutschland zu verknüpfen und praktische Einblicke in dessen Umsetzung zu gewinnen.
- Der Community Reinforcement Approach als verhaltenstherapeutisches Konzept zur Behandlung alkoholabhängiger Menschen.
- Die Rolle der Sozialen Arbeit im multiprofessionellen Team des Suchthilfesystems.
- Die Herausforderungen und Chancen des Community Reinforcement Approach im deutschen Kontext.
- Erfahrungen aus der Praxis mit der Anwendung des Community Reinforcement Approach.
- Die Bedeutung von Kooperation und Koordination zwischen verschiedenen Professionen im Suchthilfesystem.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das Kapitel 3 gibt einen Überblick über die Rolle der Sozialen Arbeit in der Behandlung alkoholabhängiger Menschen, sowohl im allgemeinen Kontext des Suchthilfesystems als auch im Bereich der Klinischen Sozialarbeit. Es beleuchtet die besonderen Herausforderungen, die diese Berufsgruppe im multiprofessionellen Team bewältigen muss.
Kapitel 4 fokussiert auf die konkreten Aufgaben der Sozialen Arbeit in den verschiedenen Phasen der Behandlung alkoholabhängiger Menschen. Dies beinhaltet die Arbeit in der Sucht- und Drogenberatungsstelle, in der Entzugsbehandlung, in der Entwöhnungsbehandlung sowie in der Nachsorge.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themengebiete Alkoholabhängigkeit, Soziale Arbeit, Suchthilfe, Community Reinforcement Approach, multiprofessionelle Zusammenarbeit, Klinische Sozialarbeit, Entzugsbehandlung, Entwöhnungsbehandlung, Nachsorge und Kooperationsprozesse.
- Quote paper
- Dörthe Badenschier (Author), 2011, Die Aufgaben der Sozialen Arbeit bei der Behandlung von Alkoholabhängigkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/313884