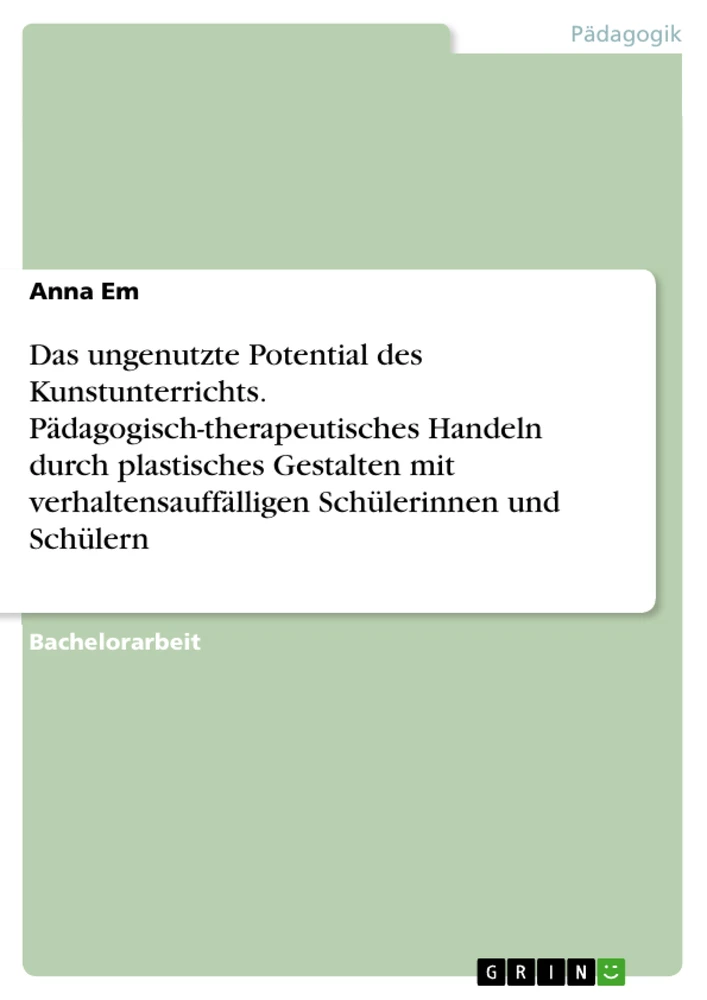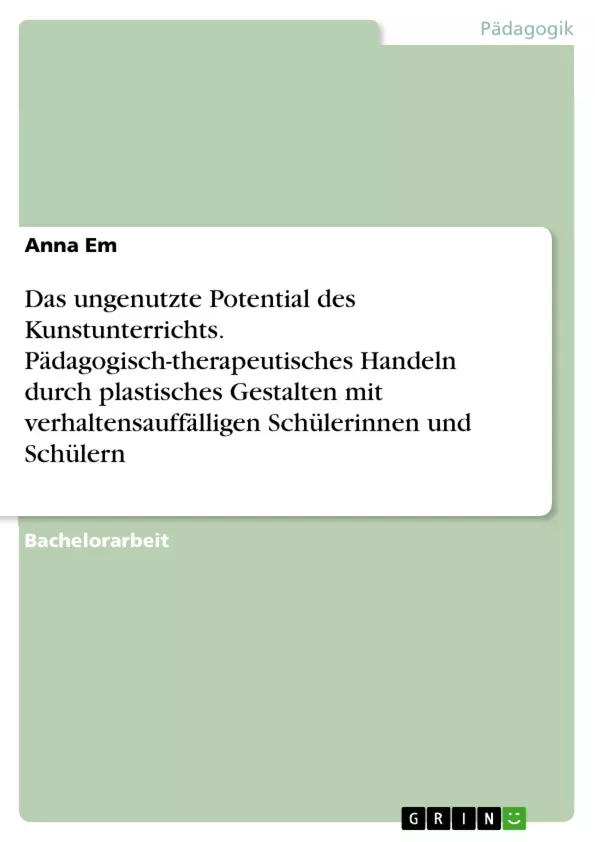Wesentlich für die Themenwahl dieser Arbeit ist die Einschätzung der gegenwärtigen Ausrichtung bei der Auswahl pädagogisch–therapeutischer Maßnahmen an deutschen Sonderschulen. Bei der Erziehung und Bildung verhaltensauffälliger Kinder und Jugendlicher ist ein zunehmender Rückgriff auf lerntheoretische Verfahren zu beobachten, deren Einsatz durchaus begründet, aber auch kritisch zu sehen ist (vgl. Ahrbeck 2009). Bei verhaltensauffälligen Schülern, die zum größten Teil ungünstigen psychosozialen Entwicklungsbedingungen ausgesetzt waren (und/oder sind) und unter einer Vielzahl von ungelösten inneren Konflikten leiden, muss sonderpädagogisches Engagement stärker auch diese innerpsychischen Konflikte wahrnehmen und im ersten Schritt auf eine tragfähigen Beziehung ausgerichtet sein. Kunsttherapeutische Angebote scheinen wertvolle Chancen zu bieten aufgrund ihres Anspruchs auf Ganzheitlichkeit im Erleben, aber auch in Anbetracht der theorieübergreifend nutzbar zu machenden Erkenntnisse.
Die Fragestellung für diese Arbeit lautet daher:
Kann das Unterrichtsfach Kunst bei verhaltensauffälligen Grundschülern unter den bestehenden institutionellen Rahmenbedingungen in Richtung eines pädagogisch – kunsttherapeutischen Unterrichts modifiziert werden und welche besonderen Chancen und Grenzen bietet die kunsttherapeutische Ausrichtung für Schüler und Pädagogen?
In Form einer Literaturarbeit werden theoretische Grundlagen für eine Modifikation des Unterrichtsfaches Kunst erschlossen und durch einige praktische Handlungsbeispiele für den Unterricht im Bereich des plastischen Gestaltens mit Ton illustriert. Diese Abschlussarbeit soll (tätigen Sonderpädagogen) ein potentielles Handlungsfeld eröffnen, Begründungen liefern, Chancen und Problemfelder herausstellen und mit dem praktischen Handlungsbeispielen zur Umsetzung anregen.
Basis der theoretischen Hintergründe bilden vorwiegend die für den Bereich Kunsttherapie und Pädagogik fundierten Konzepte von Hans - Günther Richter (1984, 1987) und Joachim Bröcher (1997, 1999a/b). Diese werden in ihrer Essenz dargestellt, durch spezifische theorieübergreifende Erkenntnisse erweitert und diskutiert. Grundlage des praktischen Leitfadens für den Bereich „Ton“ bilden die eigene langjährige praktische Tätigkeit als grundständig ausgebildete Keramikerin und Dozentin und die damit verbundenen berufsbedingten Kenntnisse, die um (sonder-)pädagogische und kunsttherapeutische Einsichten aus der Fachliteratur erweitert wurden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsbestimmungen
- 2.1. Ästhetische Bildung und Erziehung in der Grundschule / exemplarisch am Land Brandenburg
- 2.2. Kunsttherapie
- 2.3. Zusammenfassung
- 3. Ein pädagogisch-therapeutischer Kunstunterricht für verhaltensauffällige Schüler in Anlehnung an Hans Günther Richters ,,Pädagogische Kunsttherapie" (im Folgenden: PK)
- 3.1. Die ästhetische Erziehung - eine Grundlegung
- 3.2. Die besonderen Merkmale des „ästhetischen Stoffes"
- 3.3. Chancen einer allgemeinen ästhetischen Erziehung für einen therapeutisch orientierten Kunstunterricht
- 3.4. Therapeutische Aspekte
- 3.4.1. Die Offenheit der ästhetischen Sache
- 3.4.2. Der Synkretismus der ästhetischen Erfahrung
- 3.4.3. Sublimierung (nach Kramer)
- 3.5. Didaktische Ansätze zur Umstrukturierung des Unterrichts bei verhaltensauffälligen Schülern in therapeutischer Absicht
- 3.5.1. Exkurs: Grundzüge einer lebensweltorientierten Fachdidaktik für den Bereich Verhaltensgestörtenpädagogik nach Joachim Bröcher
- 3.5.1.1. Lebensweltorientierung und Entwicklungsaufgaben
- 3.5.1.2. Zugang über Bilder und Alltagsästhetisches
- 3.5.1.3. Chancen und Probleme einer lebensweltlichen Didaktik
- 3.5.2. Zusammenfassung der didaktischen Überlegungen
- 3.5.1. Exkurs: Grundzüge einer lebensweltorientierten Fachdidaktik für den Bereich Verhaltensgestörtenpädagogik nach Joachim Bröcher
- 4. Praktischer Teil am Beispiel der Arbeit mit Ton
- 4.1. Das Material
- 4.2. Grundlagen plastischen Gestaltens unter pädagogisch-therapeutischen Gesichtspunkten
- 4.2.1. Die Daumenschalentechnik
- 4.2.2. Das Modellieren
- 4.2.3. Die Aufbautechniken
- 4.2.4. Tonschlagen und -kneten
- 4.3. Unterrichtsbeispiele und Fördermaßnahmen
- 4.3.1. Entspannung & Lebensweltanalyse / Phantasiereise mit anschließendem freien Modellieren
- 4.3.2. Märchen als Verarbeitungshilfe / Gestalten von Märchenfiguren in Aufbautechnik
- 4.3.3. Ich - Identität / Das „Wunsch – Ich\" in Tierform.
- 4.3.4. Exkurs: Arbeit am Tonfeld nach Heinz Deuser (2004)
- 5. Die Rolle des kunsttherapeutisch arbeitenden Sonderpädagogen
- 6. Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht das Potenzial von Kunstunterricht als pädagogisch-therapeutische Methode für verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler. Die Arbeit analysiert die Möglichkeiten, die ästhetische Bildung und Gestaltung im Kunstunterricht bieten, um soziale, emotionale und kognitive Entwicklungsprozesse zu fördern.
- Die Relevanz von ästhetischer Bildung und Erziehung im Kontext der emotionalen und sozialen Entwicklung von Kindern
- Die Einsetzbarkeit von Kunsttherapie als pädagogisch-therapeutisches Werkzeug in der Arbeit mit verhaltensauffälligen Schülern
- Die didaktischen und methodischen Herausforderungen bei der Gestaltung eines kunsttherapeutischen Kunstunterrichts
- Die Rolle des Kunstlehrers als Begleiter und Gestalter von Lernprozessen im Kontext der Verhaltensgestörtenpädagogik
- Die spezifischen Möglichkeiten des plastischen Gestaltens mit Ton als Medium für pädagogisch-therapeutische Interventionen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und erläutert die Relevanz des Themas im Kontext der pädagogischen Arbeit mit verhaltensauffälligen Schülern. Kapitel 2 definiert die zentralen Begriffe Ästhetische Bildung, Kunsttherapie und deren Bedeutung im Schulkontext. Kapitel 3 beleuchtet die theoretischen Grundlagen eines pädagogisch-therapeutischen Kunstunterrichts, insbesondere in Anlehnung an die Pädagogische Kunsttherapie nach Hans Günther Richter. Es werden die Chancen und Herausforderungen einer allgemeinen ästhetischen Erziehung im Kontext der Verhaltensgestörtenpädagogik sowie spezifische therapeutische Aspekte des Kunstunterrichts diskutiert. Kapitel 4 widmet sich dem praktischen Teil der Arbeit, wobei der Fokus auf dem plastischen Gestalten mit Ton liegt. Es werden verschiedene didaktische Ansätze und Unterrichtsbeispiele für die Arbeit mit Ton vorgestellt, die sich an den Bedürfnissen und Entwicklungsaufgaben von verhaltensauffälligen Schülern orientieren. Kapitel 5 beleuchtet die Rolle des kunsttherapeutisch arbeitenden Sonderpädagogen und dessen Bedeutung in der pädagogisch-therapeutischen Arbeit mit verhaltensauffälligen Schülern. Die Diskussion in Kapitel 6 fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und diskutiert deren Implikationen für die Praxis.
Schlüsselwörter
Ästhetische Bildung, Kunsttherapie, Verhaltensgestörtenpädagogik, pädagogisch-therapeutischer Kunstunterricht, plastisches Gestalten, Ton, didaktische Ansätze, Unterrichtsbeispiele, Förderung, Sonderpädagogik.
Häufig gestellte Fragen
Was wird unter „pädagogisch-therapeutischem Kunstunterricht“ verstanden?
Es handelt sich um eine Modifikation des Kunstunterrichts, die kunsttherapeutische Elemente nutzt, um verhaltensauffälligen Schülern bei der Bewältigung innerpsychischer Konflikte zu helfen.
Warum eignet sich Ton besonders gut für diese Zielgruppe?
Plastisches Gestalten mit Ton bietet haptische Erfahrungen und ermöglicht durch Techniken wie Modellieren oder Tonschlagen den Ausdruck von Emotionen und die Förderung der Ich-Identität.
Auf welchen theoretischen Konzepten basiert die Arbeit?
Die Arbeit stützt sich primär auf die Konzepte der „Pädagogischen Kunsttherapie“ von Hans-Günther Richter und die lebensweltorientierte Fachdidaktik von Joachim Bröcher.
Welche Rolle spielt der Sonderpädagoge in diesem Kontext?
Der Pädagoge fungiert als Begleiter, der eine tragfähige Beziehung aufbaut und durch ästhetische Angebote soziale, emotionale und kognitive Entwicklungsprozesse fördert.
Was sind die Chancen und Grenzen dieser kunsttherapeutischen Ausrichtung?
Chancen liegen in der Ganzheitlichkeit des Erlebens und der Sublimierung von Konflikten; Grenzen ergeben sich oft durch institutionelle Rahmenbedingungen an Schulen.
- Quote paper
- Anna Em (Author), 2014, Das ungenutzte Potential des Kunstunterrichts. Pädagogisch-therapeutisches Handeln durch plastisches Gestalten mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/313909