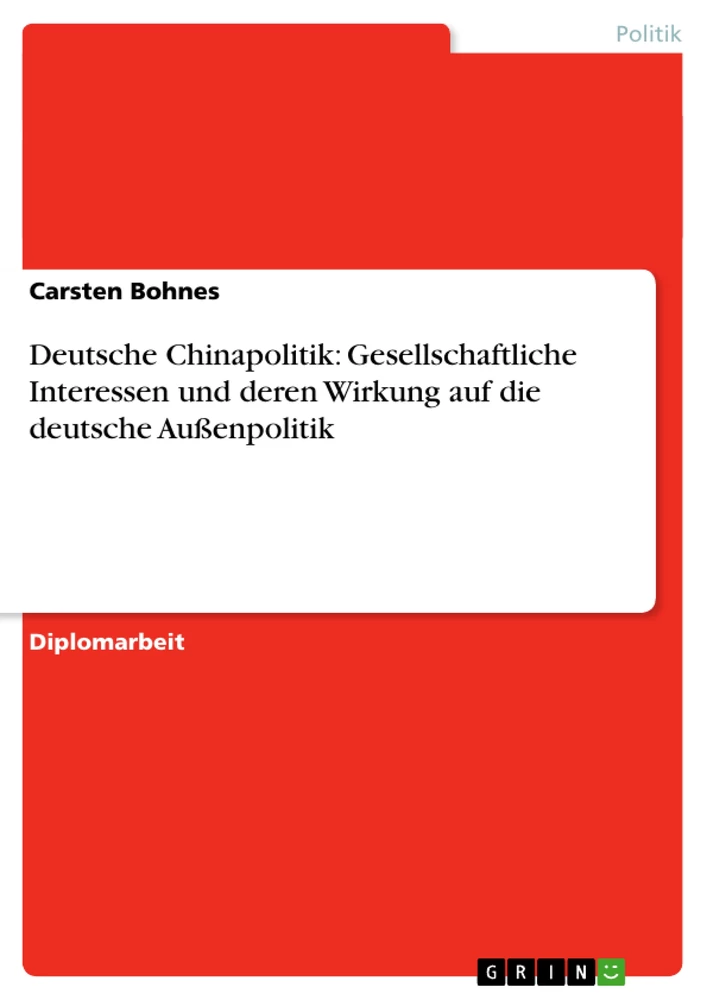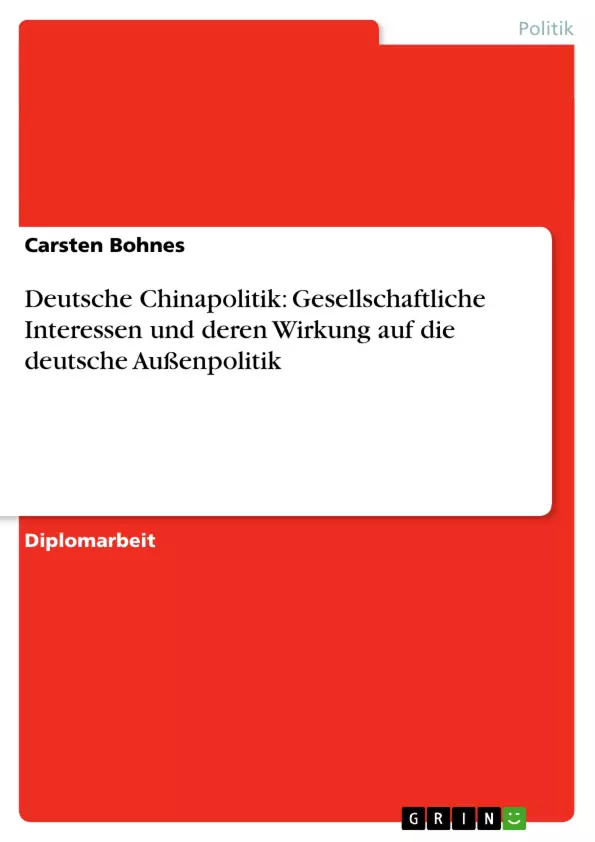Staatliches Außenpolitikverhalten wird durch viele verschiedene Faktoren beeinflusst. Sowohl systemische Faktoren (Struktur des Internationalen Systems) als auch subsystemische, innerstaatliche Faktoren können auf die Außenpolitik eines Staates ihre Wirkung entfalten. Diese Arbeit soll die wesentlichen Variablen aufzeigen, die für die deutsche Chinapolitik der Regierung Schröder ausschlaggebend sind und gegenwärtig als Hauptursache das deutsche Außenpolitikverhalten gegenüber der Volksrepublik bestimmen.
Der Fokus dieser Außenpolitikanalyse wird auf den Interessen wichtiger gesellschaftlicher Akteure innerhalb Deutschlands liegen, die als innerstaatliche Faktoren („domestic factors“) die deutsche Außenpolitik beeinflussen. Dazu scheint der Außenpolitikansatz des akteursbasierten Liberalismus – der von A. Moravcsik wieder auf die Agenda der Außenpolitikforschung gesetzt wurde1- im konkreten Fall der rot-grünen Chinapolitik das fruchtbarste Konzept zu sein, um die Zielsetzung und das strategische Verhalten der Bundesregierung gegenüber China erklären zu können: Gesellschaftliche Akteure versuchen ihre Interessen in China über die deutsche Regierung mit Hilfe der staatlichen Außenpolitik durchzusetzen und sind folglich bedeutende Faktoren, die auf das Außenpolitikverhalten eines Staates wirken. Im Falle der deutschen Chinapolitik sind diese internen Faktoren vor allen anderen Einflussvariablen sogar als die wichtigsten Ursachen für das außenpolitische Handeln Deutschlands anzusehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fragestellung
- Theorien der Außenpolitikanalyse
- Methodische Aspekte
- Deutsch-chinesische Beziehungen
- Außenpolitikanalyse: Der Liberalismus und die internen Faktoren der Außenpolitik (Theorie)
- Grundlegende Aussagen des Liberalismus
- Gesellschaftliche Akteure und deren Interessen
- Staatliche Institutionen als Transmissionsriemen
- Nationales Interesse als Zielvorstellung
- Durchsetzungsfähigkeit von gesellschaftlichen Interessen
- Deutsche gesellschaftliche Interessen in Bezug zu China (Empirie)
- Gesellschaftliche Interessengruppen I: BINGOS
- Unternehmen: das Beispiel Siemens
- Wirtschaftsverbände: BDI, DIHK, OAV
- Asien-Pazifik-Ausschuss der deutschen Wirtschaft
- Gesellschaftliche Interessengruppen II: NGOs
- Menschenrechtsorganisationen: Amnesty International
- Umweltorganisationen: Greenpeace
- Entwicklungspolitische Stiftungen: Friedrich-Ebert-Stiftung
- Zwischenfazit: Interessenkollisionen und Interessenergänzungen
- Dominante gesellschaftliche Interessen und deutsche Chinapolitik (Auswertung)
- Dominante gesellschaftliche Interessen
- Deutsches Nationales Interesse und deutsche Chinapolitik
- Rangordnung der gesellschaftlichen Interessen in der deutschen Chinapolitik
- Strategien der deutschen Chinapolitik
- Wandel durch Handel
- Staatsbesuche
- Rechtszusammenarbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der deutschen Chinapolitik unter der Regierung Schröder und untersucht, wie gesellschaftliche Interessen die deutsche Außenpolitik gegenüber China beeinflussen. Im Fokus steht der Liberalismus als außenpolitisches Theoriemodell, welches die Bedeutung gesellschaftlicher Akteure und ihrer Interessen für die Gestaltung von Außenpolitik hervorhebt.
- Einfluss gesellschaftlicher Akteure auf die deutsche Chinapolitik
- Analyse des Liberalismus als theoretisches Rahmenmodell
- Identifikation dominanter gesellschaftlicher Interessen in Bezug auf China
- Untersuchung der Strategien der deutschen Chinapolitik
- Bewertung der Rolle von Nationalinteresse und gesellschaftlichen Interessen in der deutschen Chinapolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein, stellt die Fragestellung und den methodischen Ansatz vor, beleuchtet relevante Theorien der Außenpolitikanalyse und skizziert die deutsch-chinesischen Beziehungen. Kapitel 2 analysiert den Liberalismus als theoretisches Modell, das die Rolle gesellschaftlicher Akteure und ihrer Interessen für die Außenpolitik hervorhebt. Es werden die grundlegenden Aussagen des Liberalismus erläutert, gesellschaftliche Akteure und ihre Interessen identifiziert, die Rolle staatlicher Institutionen als Vermittler von Interessen untersucht und der Einfluss des nationalen Interesses auf die Außenpolitik betrachtet. Kapitel 3 beleuchtet die deutschen gesellschaftlichen Interessen in Bezug auf China, indem es die Interessen von Wirtschaftsunternehmen, Wirtschaftsverbänden, Menschenrechtsorganisationen, Umweltorganisationen und Entwicklungshilfeorganisationen untersucht.
Schlüsselwörter
Deutsche Chinapolitik, Liberalismus, Außenpolitikanalyse, Gesellschaftliche Interessen, Wirtschaftsinteressen, Menschenrechte, Umwelt, Entwicklungshilfe, Nationalinteresse, Staatsbesuche, Wandel durch Handel, Rechtszusammenarbeit.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflussen gesellschaftliche Akteure die deutsche Chinapolitik?
Interessengruppen wie Wirtschaftsverbände und NGOs versuchen, ihre Ziele über staatliche Institutionen in die Außenpolitik einzubringen.
Was besagt der "akteursbasierte Liberalismus" in diesem Kontext?
Dieser Theorieansatz nach Andrew Moravcsik sieht den Staat als Transmissionsriemen für die Interessen dominanter gesellschaftlicher Gruppen.
Welche Wirtschaftsakteure sind für die Beziehungen zu China zentral?
Die Arbeit nennt beispielhaft Siemens sowie Verbände wie den BDI, den DIHK und den Asien-Pazifik-Ausschuss der deutschen Wirtschaft.
Welchen Einfluss haben Menschenrechtsorganisationen auf die Politik?
Organisationen wie Amnesty International bringen kritische Themen in den Diskurs ein, was oft zu Interessenkollisionen mit wirtschaftlichen Zielen führt.
Was bedeutet die Strategie "Wandel durch Handel"?
Es ist die Hoffnung, dass eine enge wirtschaftliche Verflechtung langfristig zu politischen und gesellschaftlichen Reformen in China führt.
- Citar trabajo
- Carsten Bohnes (Autor), 2004, Deutsche Chinapolitik: Gesellschaftliche Interessen und deren Wirkung auf die deutsche Außenpolitik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31391