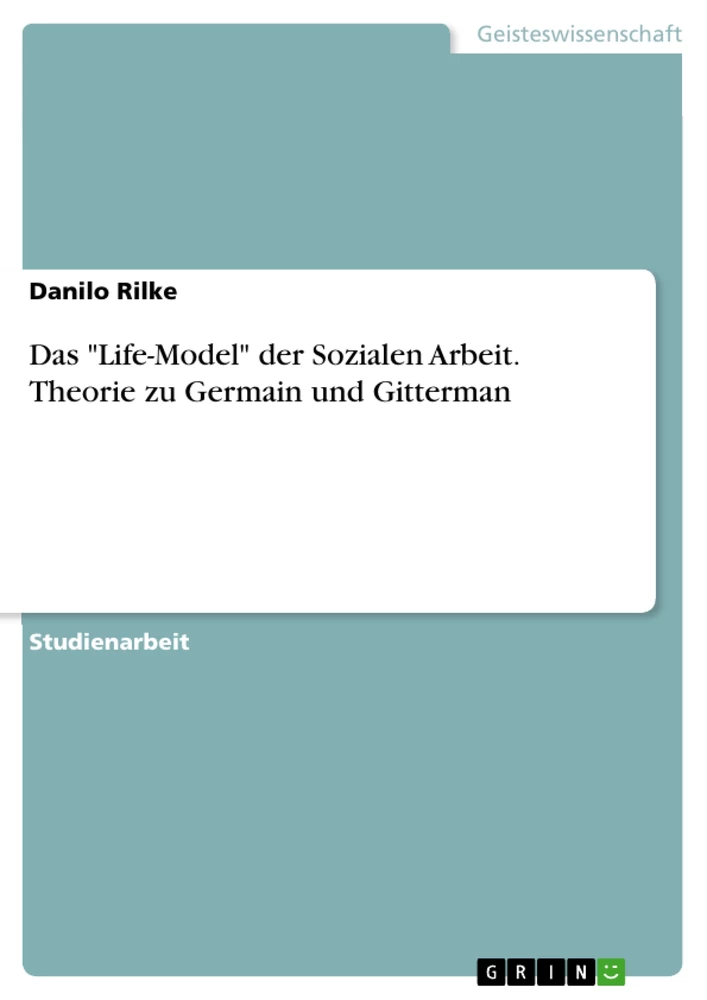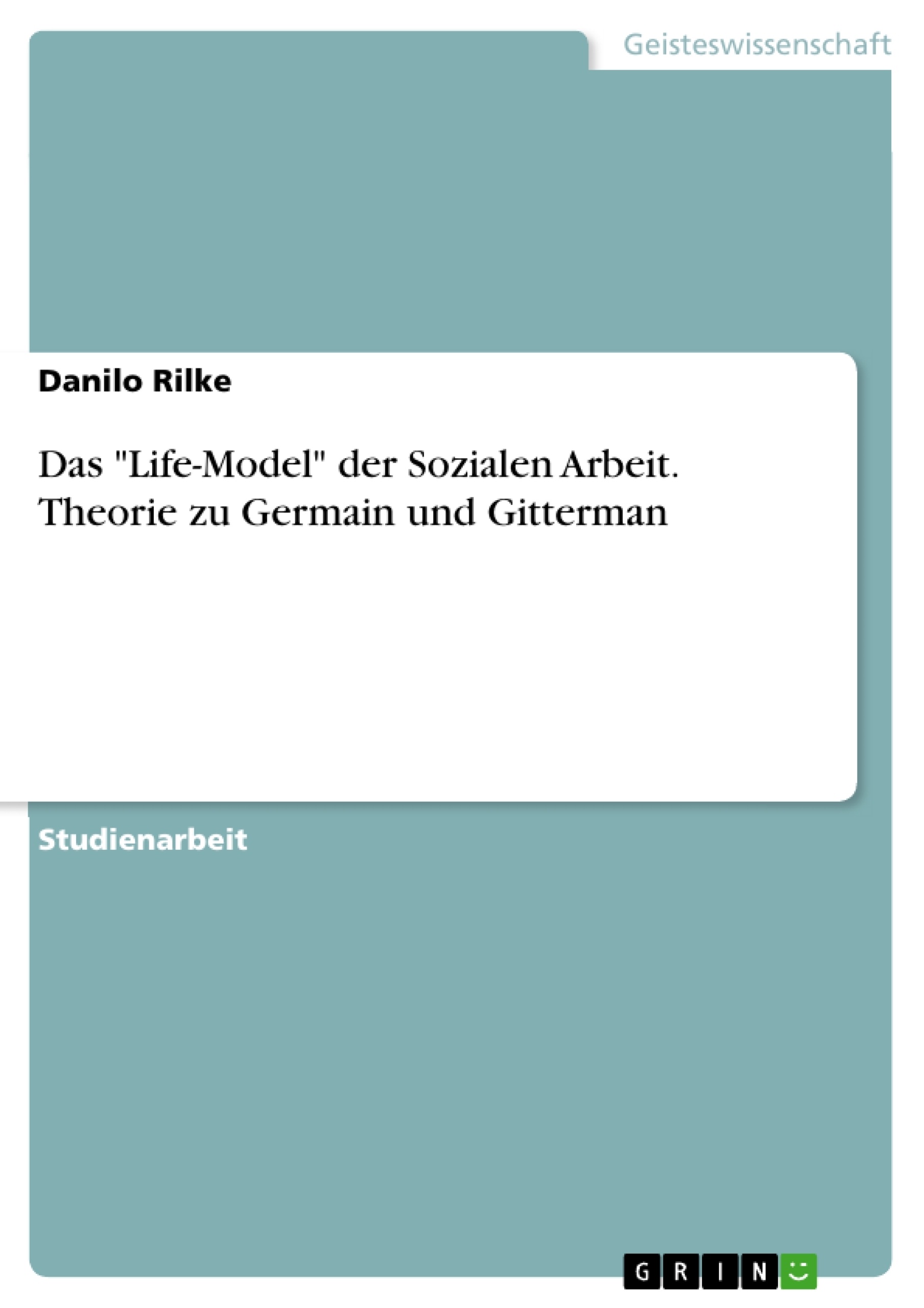Diese Facharbeit zur Wissenschaft in der Sozialen Arbeit behandelt die von Carrel B. Germain und Alex Gittermann in den USA entwickelte Theorie "Life-Modell". Die Theorie wird diskutiert und kritisch hinterfragt, auch ethische Standpunkte werden miteinbezogen. Es wird klar differenziert, weshalb diese amerikanische Theorie nicht in Deutschland angewendet werden kann.
Ich habe mich für diese Art von Theorie entschieden, da diese Theorie recht nah am Individuum geleitet erörtert wird. Zu meiner Ansicht und kritischen Begutachtung, werde ich in der eigenen Stellungnahme Bezug nehmen, da ich finde, dass diese Theorie in manchen Punkten oder Ansätzen meines Erachtens nicht ganz sinnvoll oder praktikabel erscheint. Des Weiteren lässt sich herausstellen, dass diese Theorie von den Begründern in Deutschland nicht wirklich wissenschaftlich aktuell diskutiert wird und somit auch den wissenschaftlichen Diskurs erschweren wird. Für meine Begriffe ist diese Theorie eine sehr praxisorientierte und gut nachvollziehbare. Ich werde in dem Diskurs die verschiedenen Facetten und Bestandteile der Theorie kritisch betrachten und einen Bezug zur Sozialen Arbeit herstellen und versuchen zu erläutern welchen Stellenwert ebenfalls die Ethik in der Sozialen Arbeit hat.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Die Theorie des Life Models
- 2.1 Die Soziale Arbeit im Life Model
- 2.2 Ethik in der Sozialen Arbeit
- 3. Wissenschaftlicher Diskurs
- 4. Eigene Stellungnahme
- 5. Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Facharbeit befasst sich mit der Theorie des Life Models von Carel B. Germain und Alex Gitterman, die im Kontext der Sozialen Arbeit eine wichtige Rolle spielt. Ziel der Arbeit ist es, die Theorie kritisch zu diskutieren und zu erläutern, ihren Stellenwert in der Sozialen Arbeit zu beleuchten und den wissenschaftlichen Diskurs darüber zu analysieren.
- Die Theorie des Life Models und ihre Kernelemente
- Die Rolle der Ethik in der Sozialen Arbeit im Kontext des Life Models
- Der wissenschaftliche Diskurs rund um das Life Model
- Praxisrelevanz und Anwendbarkeit des Life Models
- Kritikpunkte und Limitationen der Theorie
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in das Thema der Facharbeit ein und erläutert die Wahl des Life Models als theoretischen Rahmen. Kapitel 2 beleuchtet die Theorie des Life Models im Detail, wobei die Kernelemente und der Ansatz der Person-Umwelt-Wechselwirkung erörtert werden. Dabei wird auch die Rolle der Ethik in der Sozialen Arbeit im Kontext des Life Models betrachtet. Kapitel 3 widmet sich dem wissenschaftlichen Diskurs rund um das Life Model und analysiert die aktuelle Debatte in der Fachliteratur. Kapitel 4 bietet eine eigene Stellungnahme zur Theorie und reflektiert die Stärken und Schwächen des Life Models in der Praxis. Der letzte Abschnitt, das Quellenverzeichnis, listet die verwendeten Quellen auf.
Schlüsselwörter (Keywords)
Life Model, Soziale Arbeit, Person-Umwelt-Wechselwirkung, Ethik, wissenschaftlicher Diskurs, Praxisrelevanz, Kritikpunkte, Carel B. Germain, Alex Gitterman.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das "Life-Model" in der Sozialen Arbeit?
Das von Germain und Gitterman entwickelte Life-Model ist eine ökologisch orientierte Theorie, die die Wechselwirkung zwischen Person und Umwelt in den Mittelpunkt stellt.
Warum wird das Life-Model in Deutschland kritisch betrachtet?
Die Theorie wird in Deutschland kaum wissenschaftlich aktuell diskutiert und weist spezifische kulturelle sowie strukturelle Unterschiede zum deutschen Sozialsystem auf.
Welche Rolle spielt die Ethik im Life-Model?
Ethik ist ein zentraler Bestandteil, da die Theorie nah am Individuum arbeitet und ethische Standpunkte bei der Intervention in die Person-Umwelt-Beziehung essenziell sind.
Ist das Life-Model praxisorientiert?
Ja, es gilt als sehr praxisnahe Theorie, die hilft, komplexe Lebenssituationen von Klienten besser nachvollziehbar zu machen.
Was sind die Hauptkritikpunkte an der Theorie?
Kritisiert werden die mangelnde wissenschaftliche Aktualität im deutschen Diskurs sowie die teilweise schwierige Praktikabilität bestimmter theoretischer Ansätze.
- Quote paper
- Danilo Rilke (Author), 2015, Das "Life-Model" der Sozialen Arbeit. Theorie zu Germain und Gitterman, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/314100