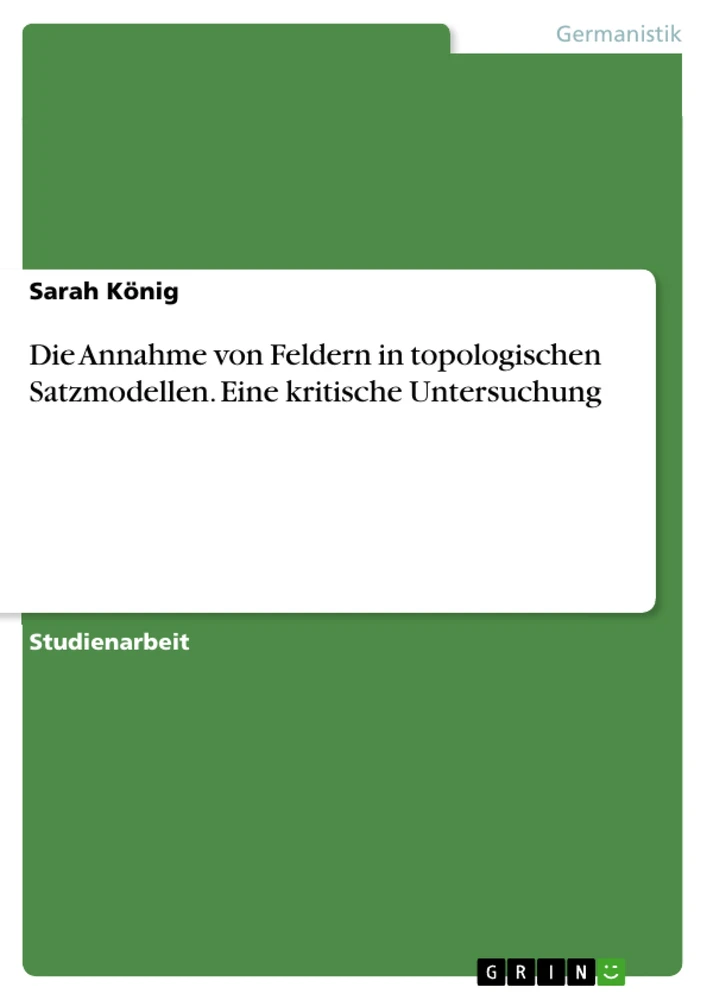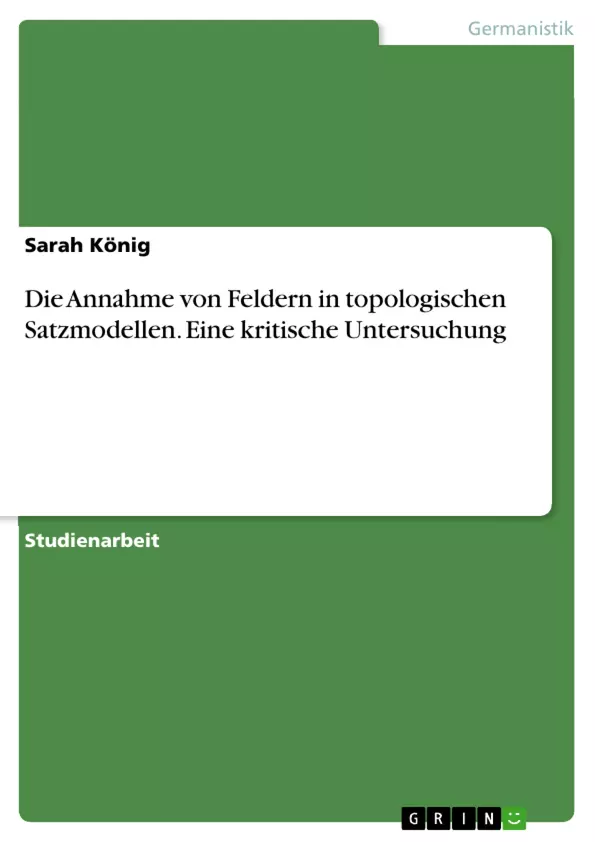Damit Sätze im Deutschen grammatisch sind müssen sie eine bestimmte lineare Abfolge aufweisen. Dabei gibt es Regeln, die die möglichen Abfolgen von Wörtern beschreiben. Um diese Regeln beschreiben zu können, sind zuerst Methoden nötig, mit deren Hilfe die Struktur von Sätzen dargestellt und untersucht werden kann. Eine mögliche Methode ist die topologische Analyse, deren zentrale Annahme die Möglichkeit der Einteilung von Sätzen in mehrere aufeinanderfolgende Bereiche, die topologische Felder genannt werden, ist.
Meibauer et al. betonen, dass „wenn man annimmt, dass Sätze aus solchen Feldern bestehen, […] man gute Gründe dafür haben [sollte]“. Bei der Betrachtung unterschiedlicher topologischer Modelle lässt sich schnell feststellen, dass sie sich unter anderem hinsichtlich der Felder, die sie annehmen, unterscheiden. Damit zeigt sich, dass es unterschiedliche Gründe zur Annahme von topologischen Feldern geben muss.
Diese Arbeit stellt zwei topologische Satzmodelle, das uniforme von Wöllstein (2014) sowie das differente von Pafel (2011), vor und untersucht sie auf ihre grundlegenden theoretischen Ziele und Annahmen hin, um davon ausgehend zu diskutieren inwiefern die Annahme und der Inhalt der topologischen Felder innerhalb der jeweiligen Theorie gut begründet und frei von Widersprüchen ist.
Es wird gezeigt, dass Wöllsteins Ziel eines uniformen Modells, das sich leicht auf das generative Strukturmodell übertragen lässt, in einer unzureichenden Konzeption des Vorfelds resultiert. Dazu gehören zwei nicht ausreichend begründete Annahmen: das obligatorisch leere Vorfeld in V1-Sätzen sowie die Einordnung von w/d-Phrasen in das Vorfeld. Im Bezug auf Pafels Modell lässt sich feststellen, dass er angibt in erster Linie einen deskriptiven Ansatz zu verfolgen und dass er Sätze in Abhängigkeit der Stellung des finiten Verbs analysiert. Des Weiteren versucht er Felder so zu konzipieren, dass eine größtmögliche Generalisierung gegeben ist. Diese Ziele und die Tatsache, dass er teils doch von einer rein deskriptiven Ebene abweicht, führen zu einer unklaren Konzeption des Verbalkomplex und der Complementizer-Position.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das uniforme Modell nach Wöllstein (2014)
- Grundlegende Annahmen und Ziele
- Felder und Klammern
- Die Satzklammer
- Problematiken bei der Einordnung satzeinleitender Elemente
- Die Problematik des obligatorisch leeren Vorfelds
- Fazit zum Modell Wöllsteins
- Das differente Modell nach Pafel (2011)
- Grundlegende Annahmen und Ziele
- Felder und Positionen
- Kritik am Verbalkomplex
- Ungereimtheiten der Complementizer-Position
- Fazit zum Modell Pafels
- Konklusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht zwei topologische Satzmodelle, das uniforme von Wöllstein (2014) und das differente von Pafel (2011), und analysiert deren grundlegende theoretische Ziele und Annahmen hinsichtlich der Konzeption von topologischen Feldern. Die Arbeit zielt darauf ab, zu erörtern, inwieweit die Annahme und der Inhalt der topologischen Felder innerhalb der jeweiligen Theorie gut begründet und frei von Widersprüchen sind.
- Bewertung der theoretischen Ziele und Annahmen der beiden Modelle
- Analyse der Begründung und Konsistenz der Annahme von topologischen Feldern
- Untersuchung der Auswirkungen des uniformen Ansatzes von Wöllstein auf die Konzeption des Vorfelds
- Bewertung der Zielsetzung des deskriptiven Ansatzes von Pafel in Bezug auf den Verbalkomplex und die Complementizer-Position
- Vergleich der beiden Modelle hinsichtlich ihrer unterschiedlichen Herangehensweise an die Beschreibung der Satzstruktur
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 widmet sich dem uniformen Modell nach Wöllstein (2014) und analysiert die grundlegenden Annahmen und Ziele dieses Modells. Im Fokus steht die Frage, ob die Annahme von topologischen Feldern in diesem Modell widerspruchsfrei und ausreichend begründet ist. Insbesondere wird die Konzeption des Vorfelds im Hinblick auf die Uniformitätshypothese kritisch beleuchtet.
Kapitel 3 behandelt das differente Modell nach Pafel (2011). Es untersucht die theoretischen Annahmen und Ziele von Pafels Modell und analysiert, inwieweit die Konzeption von Feldern in diesem Modell zu einer klaren und widerspruchsfreien Beschreibung der Satzstruktur führt. Dabei werden die Konzeption des Verbalkomplex und der Complementizer-Position im Detail betrachtet.
Schlüsselwörter
Topologische Satzmodelle, uniforme Modelle, differente Modelle, Wöllstein, Pafel, Vorfeld, Satzklammer, Verbalkomplex, Complementizer-Position, Verbstellungstypen, V1, V2, VE.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine topologische Analyse der Satzstruktur?
Die topologische Analyse teilt Sätze in aufeinanderfolgende Bereiche (Felder) ein, um die lineare Abfolge von Wörtern im Deutschen zu beschreiben. Zentrale Elemente sind dabei die Satzklammern, die durch die Stellung des Verbs gebildet werden.
Was unterscheidet das uniforme vom differenten Satzmodell?
Das uniforme Modell (z. B. nach Wöllstein) versucht, eine einheitliche Struktur für alle Verbstellungstypen zu finden. Das differente Modell (z. B. nach Pafel) hingegen ist oft deskriptiver und passt die Feldereinteilung stärker an die spezifische Stellung des finiten Verbs an.
Welche Problematik ergibt sich beim "Vorfeld" in V1-Sätzen?
In Verberst-Sätzen (V1) ist das Vorfeld leer. Kritiker hinterfragen oft, ob die Annahme eines "obligatorisch leeren Vorfelds" theoretisch sinnvoll begründet ist oder lediglich dazu dient, die Uniformität des Modells aufrechtzuerhalten.
Was ist die "Satzklammer"?
Die Satzklammer wird im Deutschen durch die Stellung der Verbteile gebildet (linke und rechte Klammer). Sie umschließt das Mittelfeld und ist das strukturelle Rückgrat des topologischen Modells.
Was sind V1, V2 und VE Stellungen?
Diese Kürzel beschreiben die Position des finiten Verbs: V1 (Verberststellung, z. B. in Fragen), V2 (Verbzweitstellung, typisch für Aussagesätze) und VE (Verbendstellung, typisch für Nebensätze).
- Quote paper
- Sarah König (Author), 2015, Die Annahme von Feldern in topologischen Satzmodellen. Eine kritische Untersuchung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/314121