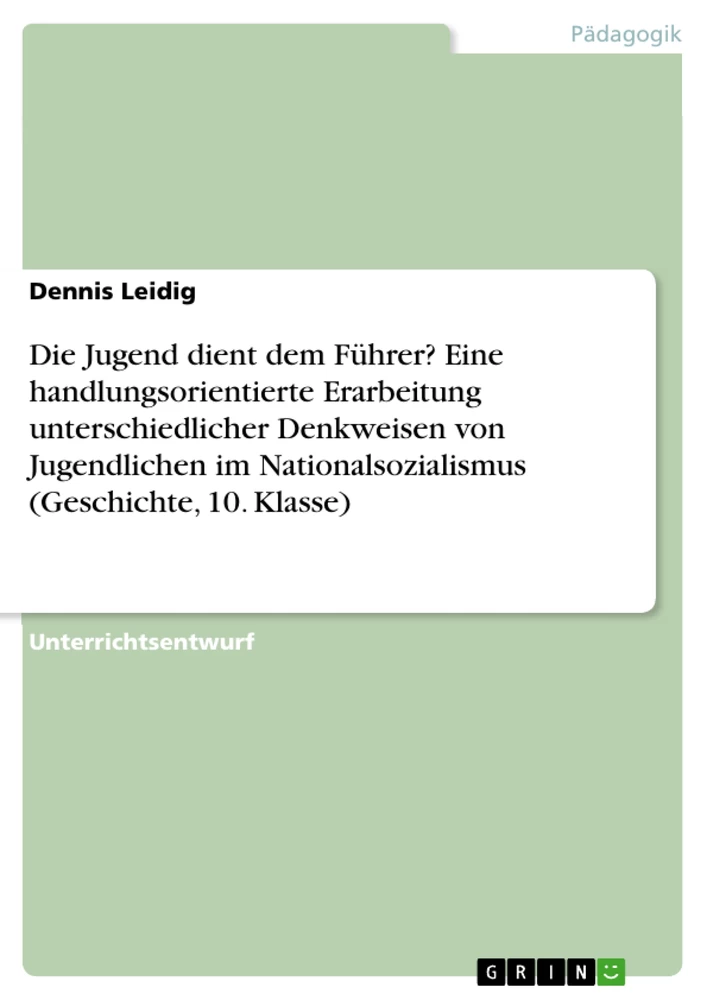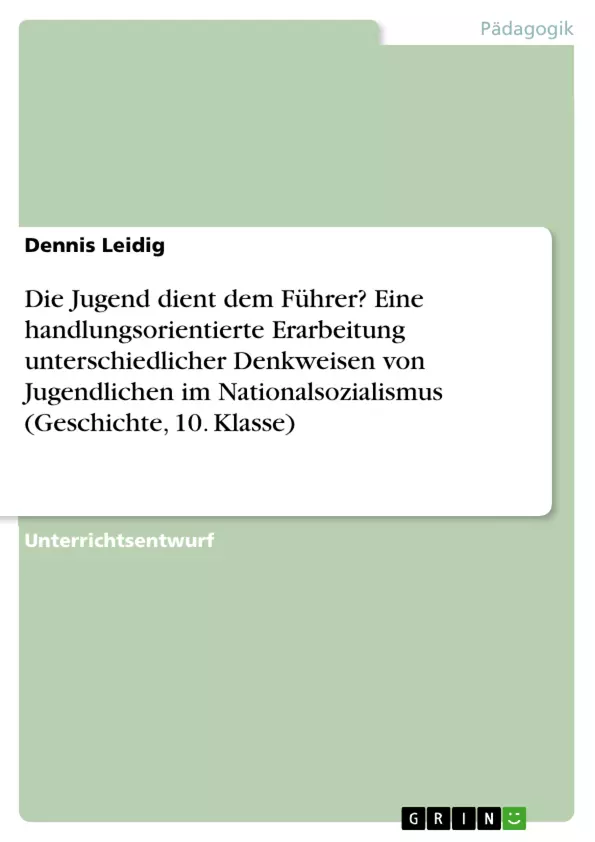Die vorliegende Unterrichtsstunde „Die Jugend dient dem Führer?“ stellt eine handlungsorientierte Vertiefung der zuvor erarbeiteten Unterrichtsinhalte dar. Daher entspricht die Legitimation dieser Stunde auch der der Reihe. Darüber hinaus legitimiert sich diese Stunde auch über ihre Bedeutung im Kontext der Unterrichtsreihe. Durch das Erarbeiten unterschiedlicher Denkweisen und dem Hineinversetzen in das Leben von Jugendlichen zur Zeit des Nationalsozialismus tauchen die Schülerinnen und Schüler tiefer in die Thematik ein. Sie betrachten die historische Situation aus verschiedenen Blickwinkeln (Multiperspektivität) und können so die Denkweisen der Jugendlichen besser nachvollziehen. Somit entwickeln sie ein besseres Verständnis für die Wirkungsweise und die Umsetzung der NS-Ideologie.
Table of Contents
- 1. Längerfristige Unterrichtszusammenhänge
- 1.1 Leitgedanken und Intentionen
- Legitimation der Unterrichtsreihe
- Lernausgangslage (Thematik/Reihe betreffend)
- Sachanalyse, didaktische Reduktion
- Konzeptionelle Anlage der längerfristigen Unterrichtszusammenhänge
- Kompetenzförderung
- 1.2 Darstellung der längerfristigen Unterrichtszusammenhänge
- 1.2.1 Tabellarische Darstellung der zugeordneten Unterrichtsreihe
- 2. Planung der Unterrichtsstunde
- 2.1 Legitimation
- 2.2 Lernvoraussetzungen
- 2.3 Lernaufgabe: Didaktische Überlegungen/methodische Entscheidungen
- 2.3 Ziele der Unterrichtsstunde / Kompetenzzuwachs
- 2.4 Verlaufsplanung
- 3. Literaturangaben
- 4. Anlagen
Objectives and Key Themes
Diese Unterrichtsreihe zielt darauf ab, den Schülerinnen und Schülern ein vertieftes Verständnis für die Funktionsweise und die Umsetzung der nationalsozialistischen Weltanschauung zu vermitteln. Der Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung der konkreten Auswirkungen der NS-Ideologie auf das Alltagsleben von Frauen und Jugendlichen, insbesondere im Hinblick auf die Hitlerjugend und den Bund Deutscher Mädel.
- Die Rolle von Frauen und Jugendlichen in der NS-Volksgemeinschaft
- Die NS-Jugendorganisationen Hitlerjugend und Bund Deutscher Mädel
- Die Etablierung der NS-Diktatur und ihre Auswirkungen auf das Leben der Menschen
- Oppositionelle Denkweisen und Jugendgruppen im Nationalsozialismus
- Die Bedeutung von kooperativen Lernformen im Geschichtsunterricht
Chapter Summaries
Das erste Kapitel behandelt die Legitimation der Unterrichtsreihe und beleuchtet die Relevanz des Themas im Hinblick auf den aktuellen Kernlehrplan und den schulinternen Lehrplan. Es werden die Lernausgangslage der Lerngruppe, die Sachanalyse und die didaktische Reduktion des Themas sowie die Kompetenzförderung durch die Unterrichtsreihe diskutiert.
Im zweiten Kapitel wird die Planung der Unterrichtsstunde im Detail dargestellt, einschließlich der Lernvoraussetzungen, der Lernaufgabe, der didaktischen Überlegungen, der methodischen Entscheidungen und der Ziele der Unterrichtsstunde.
Keywords
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Unterrichtsreihe sind: Nationalsozialismus, NS-Diktatur, Volksgemeinschaft, Hitlerjugend, Bund Deutscher Mädel, Jugend im Nationalsozialismus, Frauen im Nationalsozialismus, oppositionelle Denkweisen, kooperative Lernformen, Sachkompetenz, Urteilskompetenz.
- Quote paper
- Dennis Leidig (Author), 2014, Die Jugend dient dem Führer? Eine handlungsorientierte Erarbeitung unterschiedlicher Denkweisen von Jugendlichen im Nationalsozialismus (Geschichte, 10. Klasse), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/314246