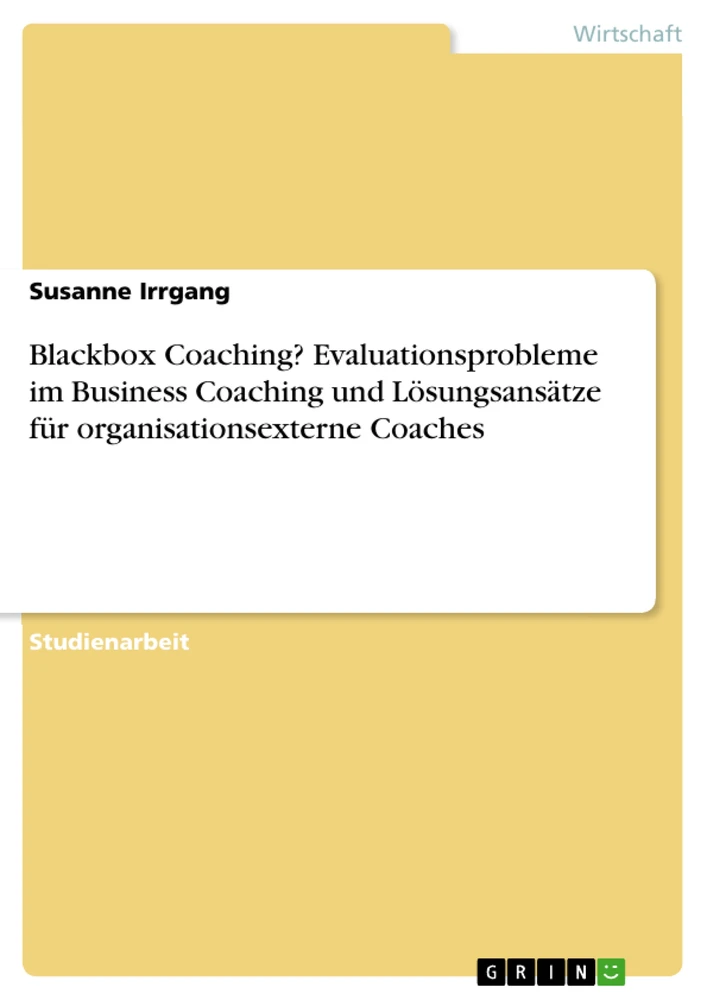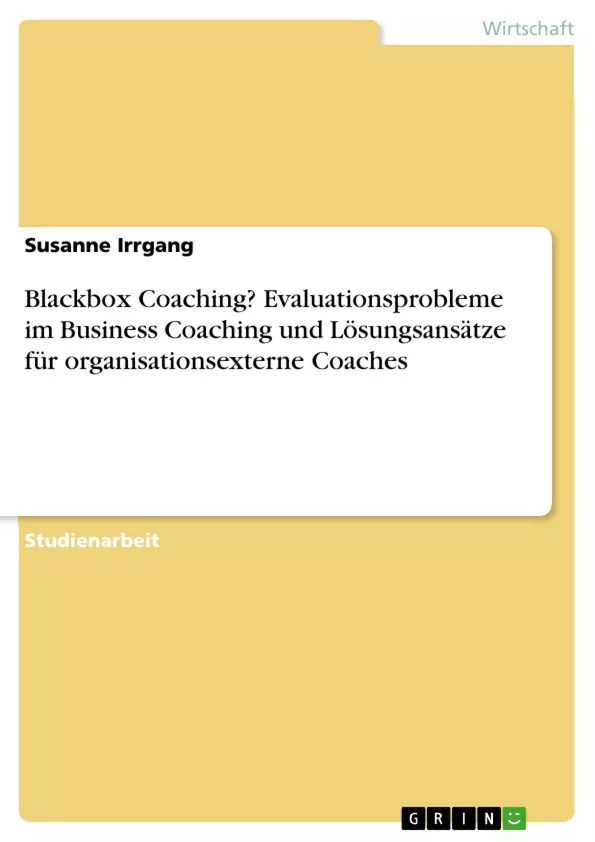Unternehmen sehen sich heutzutage zunehmend der Herausforderung gegenüber, eine stetig komplexer werdende Umwelt zu managen. Tiefgreifende Veränderungsprozesse werden immer häufiger mit Coachingmaßnahmen für Führungskräfte begleitet. Dieser massive Veränderungs- und Entwicklungsbedarf beflügelt das Coachingkonzept und verhilft der Branche derzeit zu einem großen Aufschwung. Praxisstudien sprechen Coachingprogrammen überdurchschnittliche, fast unglaubwürdige Erfolge zu. Dies lässt Forderungen nach belastbaren Evaluationsergebnissen lauter werden.
Daher setzt sich die vorliegende Arbeit mit den Stärken und Schwächen der Coachingevaluation auseinander, um hierbei erfolgversprechende Potentiale aufzudecken und realisierbare Evaluationsansätze abzuleiten.
Fest steht, dass Personalentwickler Coachingmaßnahmen nur dann argumentativ im Management vertreten und weitere Investitionen anstoßen können, wenn sie mittels fundierter Kosten-Nutzen-Betrachtung die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit von Coaching belegen können. Doch nicht in jedem Unternehmen sind Coachingevaluationen implementiert, was zur Folge hat, dass diese Aufgabe häufig beim Coach selbst verbleibt. Die Evaluation den selbständigen Coach damit allerdings vor eine nicht leicht zu bewerkstelligende Herausforderung: einerseits unterliegt der Evaluationsprozess gerade im Coaching einer Vielzahl unterschiedlicher Einflüssen, andererseits mangelt es nach wie vor an theoretisch und praktisch fundierten Evaluationsmethoden.
Dennoch belegt eine spezielle Studie zum Stundensatzvergleich, dass Coaches, die eigeninitiativ Evaluationen durchführen, einen um knapp 29% höheren Stundensatz als ihre Kollegen am Markt realisieren können. Dies unterstreicht, dass Unternehmen evaluierenden Coaches eine professionellere Arbeitsweise zuschreiben. Eine nachweisbare Evaluation gepaart mit seriösem Geschäftsgebaren stellt demnach also einen deutlichen, messbaren und geldwerten Wettbewerbsvorteil für Coaches dar.
Inhaltsverzeichnis
- Kurzbeschreibung
- Grundlegung
- Einleitung
- Ziel und Aufbau der Arbeit
- Begriffsdefinitionen und -abgrenzung
- Problemfelder bei der Evaluation von Coachingprozessen
- Einflussgrößen auf den Coachingprozess
- Einflussgrößen auf den Evaluationsprozess
- Ansätze zur Evaluation von Coachingprozessen
- Vier-Ebenen-Modell nach Kirkpatrick
- Fünf-Stufen-Modell nach Phillips
- Maßnahmen zur Qualitätssicherung im Coaching
- Beispiel eines potentiellen Selbstevaluierungsprozesses
- Flankierende Maßnahmen
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Herausforderungen der Evaluation von Coachingprozessen, insbesondere im Kontext des Business Coachings durch organisationsexterne Coaches. Sie zielt darauf ab, die Problemfelder der Evaluierung aufzuzeigen und praktikable Lösungsansätze für Einzelcoachings zu entwickeln.
- Die Bedeutung von Evaluation für die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit von Coaching
- Die Herausforderungen der Evaluierung von Coachingprozessen, insbesondere für organisationsexterne Coaches
- Die Vorstellung von etablierten Evaluierungsmodellen wie Kirkpatrick und Phillips
- Die Entwicklung von praktikablen Maßnahmen zur Qualitätssicherung im Coaching
- Die Bedeutung von Selbstevaluierung für Coaches
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema Coaching und die Notwendigkeit einer Evaluation einführt. Es wird auf die Praxisstudien hingewiesen, die überdurchschnittliche Erfolge von Coachingprogrammen belegen, jedoch gleichzeitig auf die Forderung nach belastbaren Evaluationsergebnissen verweisen.
Im Kapitel "Grundlegung" werden die zentralen Begriffe Coaching, Evaluation und Qualität definiert. Die Arbeit beleuchtet die Komplexität dieser Begriffe und die Herausforderungen, die sich aus den unterschiedlichen Definitionen und Interpretationen ergeben.
Das Kapitel "Problemfelder bei der Evaluation von Coachingprozessen" beschäftigt sich mit den Einflussgrößen, die den Coachingprozess und den Evaluationsprozess beeinflussen können. Es werden die verschiedenen Herausforderungen und Schwierigkeiten aufgezeigt, die bei der Evaluierung von Coaching auftreten können.
Im Kapitel "Ansätze zur Evaluation von Coachingprozessen" werden zwei etablierte Modelle, das Vier-Ebenen-Modell nach Kirkpatrick und das Fünf-Stufen-Modell nach Phillips, vorgestellt und im Hinblick auf ihre modelltheoretischen Eigenschaften diskutiert.
Das Kapitel "Maßnahmen zur Qualitätssicherung im Coaching" befasst sich mit der Bedeutung von Evaluation für die Qualitätssicherung im Coaching und zeigt auf, wie Coaches durch eine nachhaltige Selbstevaluierung ihre Leistungen optimieren und sich in einer wettbewerbsintensiven Branche profilieren können. Ein beispielhafter Evaluationsprozess nebst flankierenden Maßnahmen zur Qualitätssicherung wird vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Evaluation von Coachingprozessen im Business Coaching. Sie beleuchtet die Herausforderungen der Evaluierung und die Notwendigkeit von fundierten Evaluationsansätzen für Coaches. Schlüsselbegriffe sind Coaching, Evaluation, Qualitätssicherung, Kirkpatrick-Modell, Phillips-Modell, Selbstevaluierung, und Qualität im Coaching. Die Arbeit analysiert die Rolle der Evaluation im Kontext des Kosten-Nutzen-Aspekts, der Wettbewerbsvorteile, und der professionellen Arbeitsweise von Coaches.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Evaluation von Business Coaching so schwierig?
Coachingprozesse unterliegen einer Vielzahl subjektiver Einflüsse und es mangelt oft an theoretisch fundierten, einheitlichen Evaluationsmethoden.
Welche Vorteile haben Coaches, die ihre Arbeit evaluieren?
Evaluierende Coaches können laut Studien einen um bis zu 29% höheren Stundensatz realisieren, da sie als professioneller wahrgenommen werden.
Welche Evaluationsmodelle werden in der Arbeit vorgestellt?
Die Arbeit diskutiert das Vier-Ebenen-Modell nach Kirkpatrick sowie das Fünf-Stufen-Modell nach Phillips.
Was bedeutet „Blackbox Coaching“?
Der Begriff beschreibt die mangelnde Transparenz über die tatsächliche Wirksamkeit und den Kosten-Nutzen-Faktor von Coaching-Maßnahmen in Unternehmen.
Wie können organisationsexterne Coaches die Qualität sichern?
Durch die Implementierung von Selbstevaluierungsprozessen und flankierenden Maßnahmen können Coaches die Nachhaltigkeit ihrer Arbeit belegen.
- Quote paper
- Susanne Irrgang (Author), 2015, Blackbox Coaching? Evaluationsprobleme im Business Coaching und Lösungsansätze für organisationsexterne Coaches, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/314325