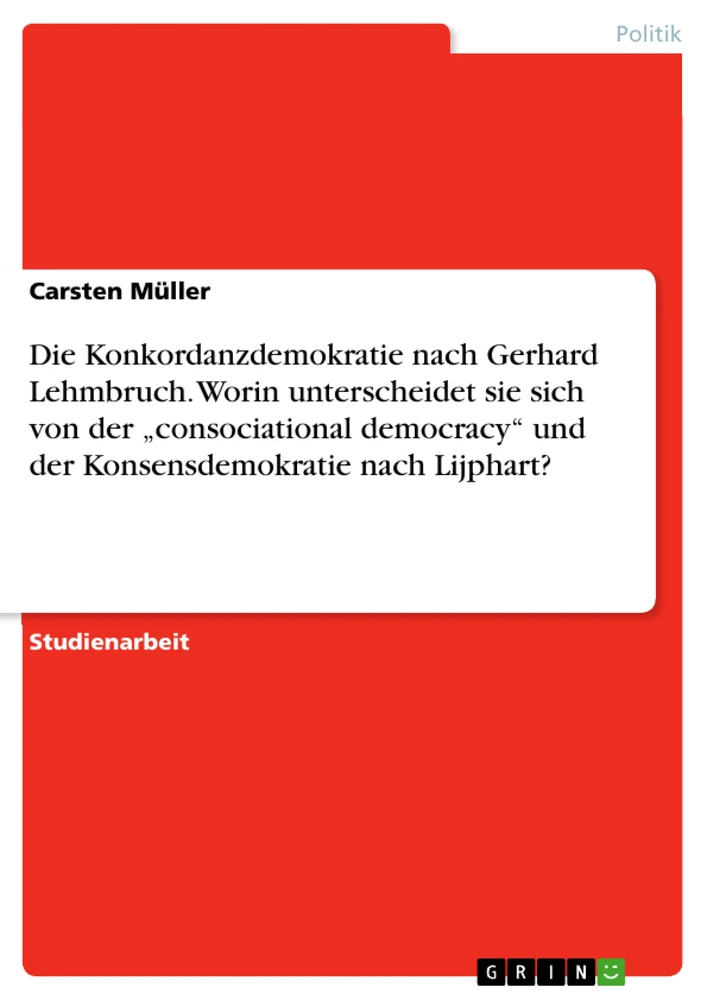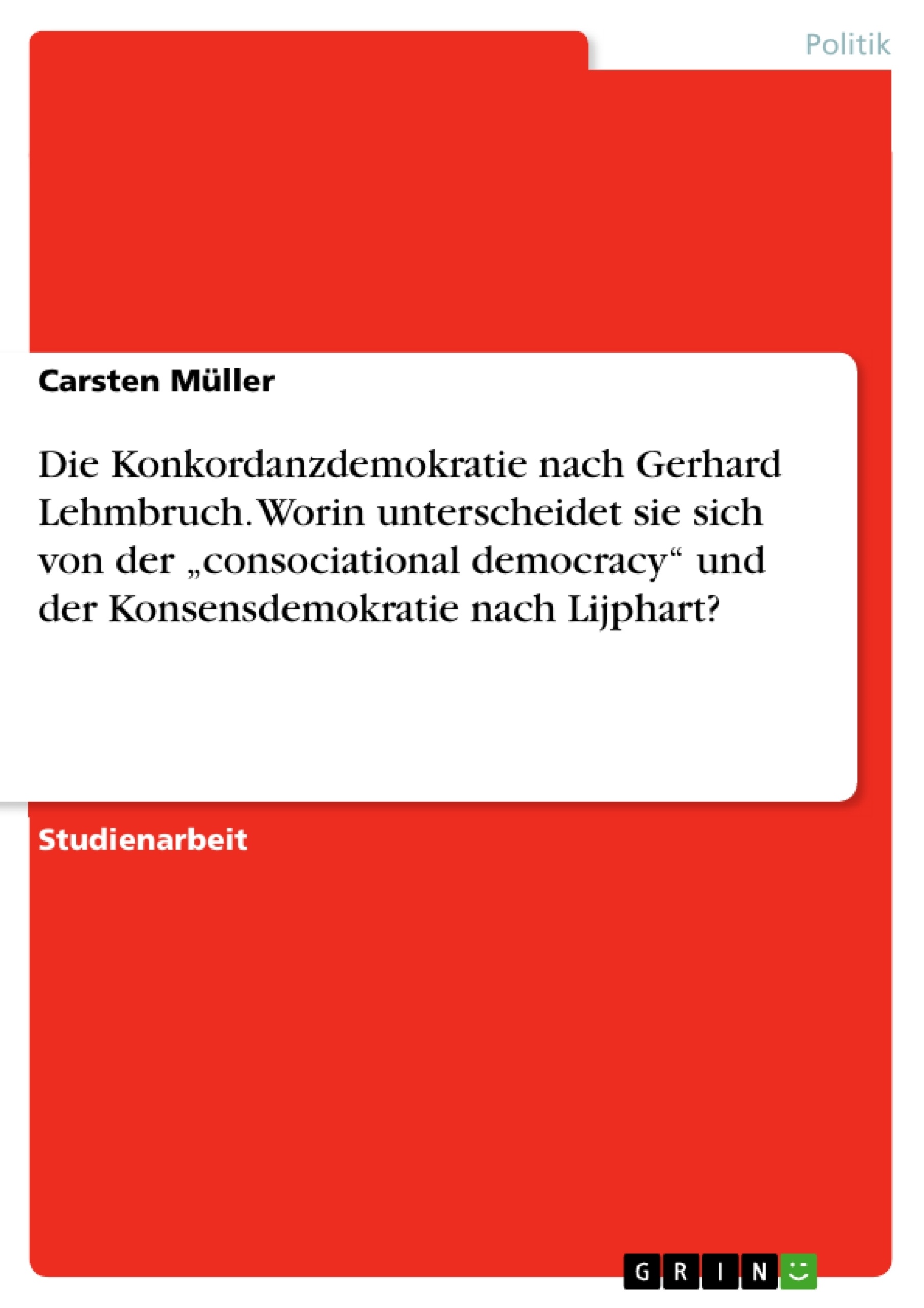Diese Arbeit geht der Forschungsfrage nach, worin sich die Theorie der Konkordanzdemokratie nach Lehmbruch von den Theorien der „consociational democracy“ und der Konsensdemokratie nach Lijphart unterscheidet. Von der Beantwortung dieser Frage lässt sich ein besseres Verständnis über die Entwicklung von konkordanzdemokratischen Verfahren erwarten.
Wie werden in modernen Demokratien Konflikte gelöst und wer entscheidet letztendlich darüber? In den sozial sehr homogenen, anglo-amerikanischen Gesellschaften ist das die Mehrheit der Staatsbürger. In den religiös und kulturell stark fragmentierten kontinentaleuropäischen Gesellschaften haben sich stattdessen Verhandlungs-und Konkordanzdemokratien als eine besondere Form der Konfliktbewältigung herausgebildet.
Die Forschung zu diesem Demokratie-Typ hat sich in zwei Lager, nämlich der entwicklungs-historischen und der quantitativ-institutionellen Perspektive, aufgeteilt. Ziel dieser Arbeit ist es, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Forschungsstränge herauszuarbeiten und festzustellen, worin sich die bekannten Vertreter der beiden Strömungen, Gerhard Lehmbruch und Arend Lijphart, in ihren Forschungsansätzen unterscheiden.
Anhand des Fallbeispiels, der Schweizer Konkordanzdemokratie mit ihren direktdemokratischen Verfahren, sollen die Ergebnisse anschließend näher untersucht werden. Es hat sich gezeigt, dass die Entwicklung der Konkordanzdemokratie in der Schweiz kein bewusster, sondern vielmehr ein notwendiger Schritt war. Für neu entstehende Demokratien bieten sich konkordanzdemokratische Verfahren durchaus als Alternative zur gängigen Form der Mehrheitsdemokratie an.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Konkordanzdemokratie
- Konsensdemokratie
- Das politische System der Schweiz
- Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Forschungsansätzen von Gerhard Lehmbruch und Arend Lijphart zur Konkordanzdemokratie. Sie analysiert die Entwicklung und die Charakteristika der Konkordanzdemokratie im Vergleich zur Mehrheitsdemokratie und Konsensdemokratie. Die Schweiz dient als Fallbeispiel.
- Theorie der Konkordanzdemokratie nach Lehmbruch
- Theorie der Konsensdemokratie nach Lijphart
- Vergleich der Ansätze von Lehmbruch und Lijphart
- Konfliktlösung in Konkordanzdemokratien
- Das Schweizer politische System als Fallbeispiel
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach den Unterschieden zwischen Lehmbruchs Konkordanzdemokratietheorie und Lijpharts Theorien zur Konsens- und Verhandlungsdemokratie. Sie argumentiert, dass die Beantwortung dieser Frage zu einem besseren Verständnis der Entwicklung konkordanzdemokratischer Verfahren und zur Identifizierung stabilisierender Faktoren für junge Demokratien beitragen kann. Die Arbeit skizziert ihren Aufbau und die zu untersuchenden Aspekte. Der Fokus liegt auf der Konfliktlösung in modernen pluralistischen Demokratien, insbesondere im Vergleich zwischen Mehrheits- und Konkordanzdemokratien. Die Einleitung hebt die Bedeutung der Arbeiten von Lehmbruch und Lijphart hervor und beschreibt den Aufbau der vorliegenden Arbeit.
Konkordanzdemokratie: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Konkordanzdemokratie, der sich auf Verhandlungs- und Kompromisstechniken zur Konfliktlösung konzentriert. Es hebt den Unterschied zur Mehrheitsdemokratie hervor und diskutiert den historischen Kontext, in dem die Konkordanzdemokratie als Alternative zum "Westminster-Modell" entstand. Die Entstehung dieses Demokratiemodells wird im Kontext der sozialen und religiösen Fragmentierung in kontinentaleuropäischen Gesellschaften erklärt. Der Fokus liegt auf der Rolle von Kompromisstechniken und der Einbeziehung aller relevanten gesellschaftlichen Gruppen zur Konfliktlösung.
Schlüsselwörter
Konkordanzdemokratie, Konsensdemokratie, Mehrheitsdemokratie, Gerhard Lehmbruch, Arend Lijphart, Konfliktlösung, Kompromiss, Verhandlung, Schweiz, Fallbeispiel, Institutionen, politische Systeme.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Konkordanz- und Konsensdemokratie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die Theorien von Gerhard Lehmbruch (Konkordanzdemokratie) und Arend Lijphart (Konsensdemokratie) und analysiert Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Die Schweiz dient als Fallbeispiel zur Illustration der Konzepte.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Charakteristika von Konkordanz- und Konsensdemokratie im Vergleich zur Mehrheitsdemokratie. Sie untersucht die Konfliktlösung in diesen Systemen, die Rolle von Kompromiss und Verhandlung, und beleuchtet die historischen und sozialen Kontexte, in denen diese Modelle entstanden sind. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Vergleich der theoretischen Ansätze von Lehmbruch und Lijphart.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zu Konkordanzdemokratie und Konsensdemokratie, ein Kapitel zum politischen System der Schweiz als Fallbeispiel und abschließende Schlussfolgerungen. Jedes Kapitel fasst die wesentlichen Aspekte des jeweiligen Themas zusammen.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein besseres Verständnis der Konkordanzdemokratie zu entwickeln, indem sie die theoretischen Ansätze von Lehmbruch und Lijphart vergleicht. Sie will die Entwicklung und die stabilisierenden Faktoren konkordanzdemokratischer Verfahren analysieren und den Beitrag dieser Modelle zur Konfliktlösung in pluralistischen Gesellschaften aufzeigen.
Welche Rolle spielt die Schweiz in dieser Arbeit?
Die Schweiz dient als empirisches Fallbeispiel, um die theoretischen Konzepte der Konkordanz- und Konsensdemokratie zu illustrieren und deren praktische Anwendung in einem konkreten politischen System zu analysieren.
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Arbeit verwendet?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Konkordanzdemokratie, Konsensdemokratie, Mehrheitsdemokratie, Gerhard Lehmbruch, Arend Lijphart, Konfliktlösung, Kompromiss, Verhandlung, Schweiz, Fallbeispiel, Institutionen und politische Systeme.
Wie ist der Aufbau der Arbeit?
Die Arbeit folgt einem logischen Aufbau mit Einleitung, Kapitel zur Theorie, Fallbeispiel und Schlussfolgerungen. Die Einleitung formuliert die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz. Die einzelnen Kapitel befassen sich detailliert mit den jeweiligen Themen. Schließlich werden die Ergebnisse zusammengefasst und Schlussfolgerungen gezogen.
- Quote paper
- Carsten Müller (Author), 2015, Die Konkordanzdemokratie nach Gerhard Lehmbruch. Worin unterscheidet sie sich von der „consociational democracy“ und der Konsensdemokratie nach Lijphart?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/314379