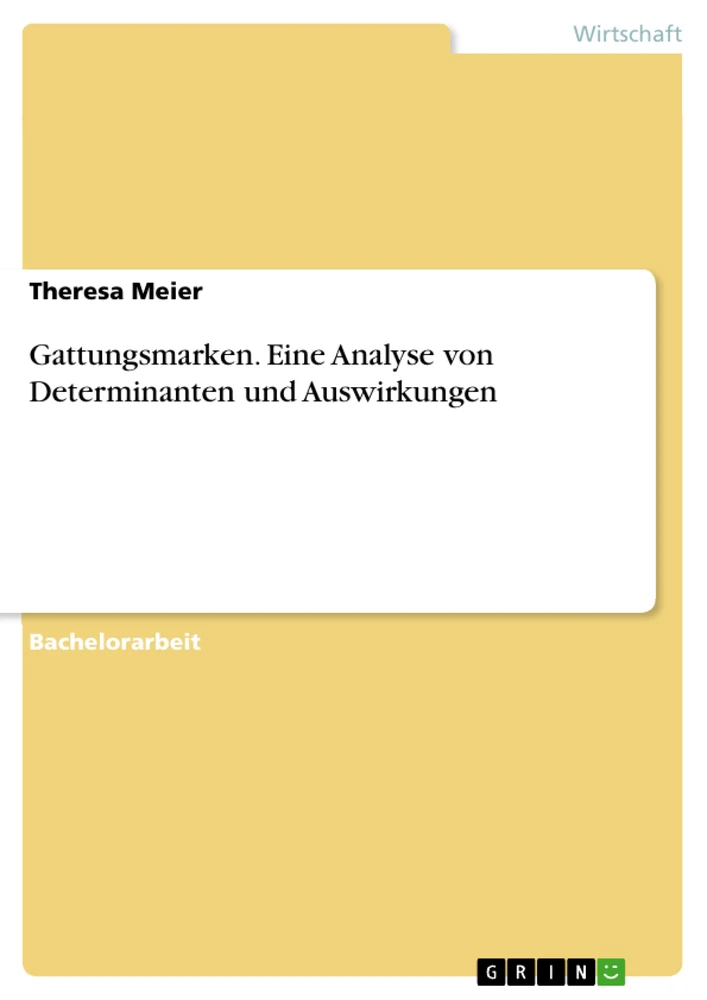Ziel dieser Arbeit ist es, den Vorgang und die Auswirkungen der Entwicklung einer Marke zum Gattungsbegriff zu veranschaulichen, zu analysieren und zu zeigen, welche Maßnahmen Markeninhaber treffen können, um dem Verlust des Markenschutzes entgegen zu wirken.
Jedes Unternehmen strebt an, einen hohen Absatz zu generieren. Es ist allgemein bekannt, dass der Absatz eines Unternehmens von Markennamen beeinflusst wird. Dabei kommt es nicht in erster Linie darauf an, ob das angebotene Produkt oder die angebotene Dienstleistung hohe Qualität und Effektivität verspricht. Namenhafte Marken werden ausgewählt, und unbekannte Marken werden von diesen „starken“ Marken in die Namenslosigkeit verdrängt. Ob eine Marke einen gewissen Wiedererkennungswert erzielt, hängt davon ab, inwieweit Konsumenten in der Lage sind, einen Markennamen mit einem bestimmten Produkt zu assoziieren. Insbesondere ob ein bestimmter Markenname mit dem angebotenen Produkt oder der angebotenen Dienstleistung des Herstellers in Verbindung gebracht wird. (Laforet, 2011, 18)
So sind vor allem einprägsame Markennamen in der heutigen Werbewelt ein beliebtes Instrument geworden, die Aufmerksamkeit der Konsumenten zu wecken und sich von der Konkurrenz zu differenzieren (Dick, 2004, 509). Werbende Unternehmen sind also einerseits bestrebt, ihren Markenwert kontinuierlich zu steigern, während sie aber auf der anderen Seite gleichfalls das Risiko einer arttypischen Verwendung des Begriffes als Synonym für alle ähnlichen Produkte zu tragen haben. Dieses Risiko kann sich ebenfalls negativ auf das Unternehmen und das beworbene Produkt auswirken und resultiert im Extremfall in der Aberkennung des Markenschutzes (Cohen, 2007).
Nicht selten ist es schwer, den Unterschied zwischen Produkt und Marke zu durchschauen. Nach Kapferer (1992, 163 ff) ist ein Produkt das, was ein Unternehmen herstellt und eine Marke das, was der Kunde kauft. Somit wird dem Produkt durch die Marke Identität verliehen. Was geschieht jedoch, wenn für die Marke eines neuen Produktes noch keine Produktkategorie existiert? Oder Konsumenten den Markennamen mit der Vorstellung der ganzen Produktkategorie assoziieren, da sie sich mit dem Namen besser identifizieren können?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffliche und theoretische Grundlagen
- 2.1. Definition Marke
- 2.2. Gattungsmarkenbegriff im deutschen und anglo-amerikanischen Kontext
- 2.3. Juristische Betrachtung des Gattungsmarkenphänomens
- 3. Theoretische Herleitung von Determinanten und Auswirkungen
- 3.1. Identifizierung der wichtigsten Determinanten von Gattungsmarken
- 3.1.1. Marktbezogene Determinanten
- 3.1.2. Linguistische Determinanten
- 3.1.3. Marketing-Mix bezogene Determinanten
- 3.2. Auswirkungen der Existenz von Gattungsmarken
- 3.2.1. Marktbezogene Auswirkungen
- 3.2.2. Nachfragebezogene Auswirkungen
- 3.2.3. Rechtliche Auswirkungen
- 3.3. Schutzmaßnahmen der Gattungsmarkenpolitik
- 4. Empirische Analyse
- 4.1. Fallstudie 1: Die Marke „Google“ als Repräsentant internationaler Gattungsmarken
- 4.1.1. Unternehmens- und Marktportrait
- 4.1.2. Entwicklung zur Gattungsmarke und Umgang mit der Gattungsmarkenproblematik
- 4.2. Fallstudie 2: Die Marke „Tempo“ als Repräsentant nationaler Gattungsmarken
- 4.2.1. Unternehmens- und Marktportrait
- 4.2.2. Entwicklung zur Gattungsmarke und Umgang mit der Gattungsmarkenproblematik
- 5. Fazit
- 6. Implikationen für die Forschung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Entwicklung von Marken zu Gattungsbegriffen (Genericisierung). Ziel ist die Analyse der Determinanten und Auswirkungen dieses Prozesses, sowie die Darstellung möglicher Schutzmaßnahmen für Markeninhaber. Die Arbeit beleuchtet sowohl theoretische Grundlagen als auch empirische Beispiele.
- Definition und Abgrenzung des Gattungsmarkenbegriffs
- Identifizierung der Faktoren, die zur Genericisierung beitragen
- Auswirkungen der Genericisierung auf Markt, Nachfrage und Recht
- Strategien zum Schutz vor Genericisierung
- Analyse von Fallbeispielen (Google und Tempo)
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt das Phänomen der Gattungsmarken anhand von Beispielen wie Tempo und Aspirin vor. Sie hebt den Widerspruch zwischen dem Wunsch nach hohem Markenwert und dem Risiko der Genericisierung hervor. Die Arbeit untersucht die Voraussetzungen für die Entwicklung einer Marke zu einem Gattungsbegriff und mögliche Gegenmaßnahmen. Das Hauptziel ist die Veranschaulichung des Prozesses und seiner Auswirkungen, sowie die Präsentation von Schutzmaßnahmen für Markeninhaber.
2. Begriffliche und theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel liefert eine Definition des Markenbegriffs aus juristischer und wirtschaftlicher Sicht. Es beleuchtet den Gattungsmarkenbegriff im deutschen und angloamerikanischen Kontext und analysiert die juristischen Aspekte des Phänomens. Es legt die Grundlage für das Verständnis der folgenden Kapitel, indem es verschiedene Definitionen und Perspektiven auf Marken und deren Genericisierung aufzeigt.
3. Theoretische Herleitung von Determinanten und Auswirkungen: Dieses Kapitel identifiziert die Determinanten der Gattungsmarkenbildung, unterteilt in marktbezogene, linguistische und Marketing-Mix-bezogene Faktoren. Es analysiert die Auswirkungen der Existenz von Gattungsmarken auf Markt, Nachfrage und Recht. Schließlich werden Schutzmaßnahmen der Gattungsmarkenpolitik erörtert. Dieses Kapitel liefert ein umfassendes theoretisches Modell zur Entstehung und Wirkung von Gattungsmarken.
4. Empirische Analyse: Dieses Kapitel präsentiert zwei Fallstudien – Google als internationale und Tempo als nationale Gattungsmarke – um die theoretischen Überlegungen zu illustrieren. Für jede Marke werden Unternehmens- und Marktportrait sowie die Entwicklung zur Gattungsmarke und der Umgang mit der Problematik analysiert. Die Fallstudien liefern konkrete Beispiele für die theoretischen Konzepte und zeigen unterschiedliche Strategien im Umgang mit der Genericisierung.
Schlüsselwörter
Gattungsmarken, Genericisierung, Markenwert, Markenschutz, Marketing, Markenname, Fallstudien, Google, Tempo, Linguistik, Marktforschung.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Gattungsmarken - Entwicklung, Auswirkungen und Schutzmaßnahmen
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung von Marken zu Gattungsbegriffen (Genericisierung). Im Fokus stehen die Analyse der Determinanten und Auswirkungen dieses Prozesses sowie die Darstellung möglicher Schutzmaßnahmen für Markeninhaber. Die Arbeit kombiniert theoretische Grundlagen mit empirischen Beispielen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Abgrenzung des Gattungsmarkenbegriffs, die Identifizierung der Faktoren, die zur Genericisierung beitragen, die Auswirkungen der Genericisierung auf Markt, Nachfrage und Recht, Strategien zum Schutz vor Genericisierung und die Analyse von Fallbeispielen (Google und Tempo).
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit legt begriffliche und theoretische Grundlagen zum Markenbegriff aus juristischer und wirtschaftlicher Sicht dar. Sie beleuchtet den Gattungsmarkenbegriff im deutschen und angloamerikanischen Kontext und analysiert die juristischen Aspekte. Es werden verschiedene Definitionen und Perspektiven auf Marken und deren Genericisierung aufgezeigt.
Welche Determinanten der Gattungsmarkenbildung werden identifiziert?
Die Arbeit identifiziert marktbezogene, linguistische und Marketing-Mix-bezogene Faktoren als Determinanten der Gattungsmarkenbildung. Diese Faktoren werden im Detail analysiert und ihre Bedeutung für den Prozess der Genericisierung erläutert.
Welche Auswirkungen von Gattungsmarken werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die Auswirkungen der Existenz von Gattungsmarken auf den Markt, die Nachfrage und das Recht. Die jeweiligen Auswirkungen werden detailliert beschrieben und mit theoretischen Modellen untermauert.
Welche Schutzmaßnahmen gegen Genericisierung werden vorgestellt?
Die Arbeit erörtert verschiedene Schutzmaßnahmen der Gattungsmarkenpolitik, die Markeninhabern helfen können, die Genericisierung ihrer Marken zu verhindern oder zu verlangsamen. Diese Maßnahmen werden im Kontext der theoretischen Analyse und der empirischen Fallstudien diskutiert.
Welche Fallstudien werden in der Arbeit präsentiert?
Die Arbeit präsentiert zwei Fallstudien: Google als internationale und Tempo als nationale Gattungsmarke. Für jede Marke werden Unternehmens- und Marktportrait, die Entwicklung zur Gattungsmarke und der Umgang mit der Problematik analysiert. Die Fallstudien illustrieren die theoretischen Konzepte und zeigen unterschiedliche Strategien im Umgang mit der Genericisierung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gattungsmarken, Genericisierung, Markenwert, Markenschutz, Marketing, Markenname, Fallstudien, Google, Tempo, Linguistik, Marktforschung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Einleitung, theoretische Grundlagen, theoretische Herleitung von Determinanten und Auswirkungen, empirische Analyse, Fazit und Implikationen für die Forschung gegliedert. Jedes Kapitel baut auf dem vorherigen auf und trägt zum Gesamtverständnis des Themas bei.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende, Wissenschaftler und Praktiker im Bereich des Markenmanagements, des Marketings und des Rechts. Sie bietet einen umfassenden Überblick über das Phänomen der Gattungsmarken und liefert wertvolle Erkenntnisse für die Praxis.
- Citation du texte
- Theresa Meier (Auteur), 2012, Gattungsmarken. Eine Analyse von Determinanten und Auswirkungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/314393