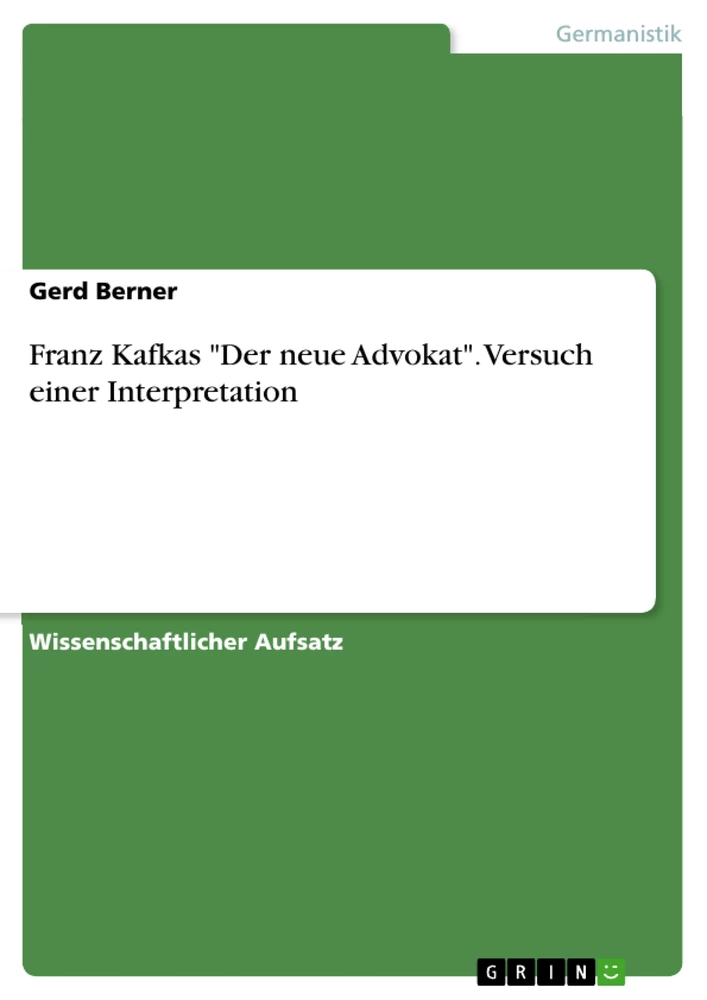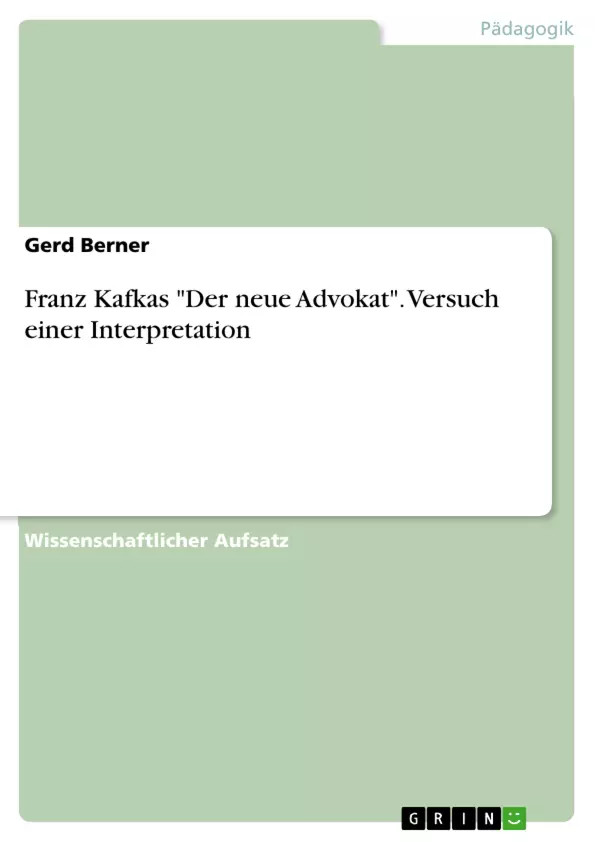Der Text beginnt mit der Aussage "Wir haben einen neuen Advokaten, [...]." Das sprechende Subjekt "wir" ist der Narrator, der in dem den inneren Monolog einleitenden Hauptsatz zwar in der 1. Person Singular Präsens sprechen sollte, die Ich-Aussage des Erzählers aber umgeht und statt "ich" zunächst "wir" sagt. Der Plural "wir" des Personalpronomens zeigt, dass die namen-lose Erzählinstanz denjenigen angehört, die das "Barreau" bilden, also einer Gruppe von Advokaten, die in einem "Bureau" zusammenarbeiten und jetzt einen neuen Mitarbeiter haben.
Dessen Name lautet "Dr. Bucephalus". Der Bucephalus war vor seiner Verwandlung in einen Juristen in grauen Vorzeit das "Streitroß Alexanders von Mazedonien". Dieses Halbwesen aus Pferd und Mensch beobachtet der Ich-Erzähler nun und macht sich so seine Gedanken. Den echten Bucephalus hat der große Alexander auf seinem Asienfeldzug geritten, das "Königsschwert" in der Hand mit Zielrichtung auf "Indiens Tore".
Da es in der heutigen Gesellschaftsordnung, d.h. der Gegenwart des Ich-Erzählers, Indien aber nicht mehr zu erobern gilt, bleibt dem Bucephalus nichts anderes übrig, als sich "in die Gesetzbücher zu versenken".
Der Narrator monologisiert in "Der neue Advokat" nur eingangs über den Dr. Bucephalus, der das alte Streitross auch in seiner transformierten Gestalt als Anwalt nicht verleugnen kann. Der Zwiespalt zwischen menschlicher und tierischer Identität dient dem Erzähler jedoch lediglich als Auslöser einer Reflexion über die Richtungslosigkeit der modernen Zeit. Das erzählende Ich räsoniert über die von ihm erlebte "Gesellschaftsordnung". Bei der Beurteilung seiner heutigen Zeit hat das Ich den Buce-phalus als agierendes Subjekt an den Rand gedrängt. Im Mittelpunkt seiner Gesellschaftskritik steht die Klage des Ich-Erzählers, heute gebe es keinen großen Alexander mehr und "niemand, niemand kann nach Indien führen."
Hinter dem Räsonnement des Narrators steht nach meiner Deutung Kafkas Diagnose seiner Zeit. Aufgrund dieser Diagnose einer fundamentalen Orientierungslosigkeit,, die man auch ontologische Bodenlosigkeit nennen könnte, verbinden sich in "Der neue Advokat" Kafkas Kritik an der Neuzeit und sein messianischer Anspruch. Wenn sich das Ich am Textende, wie der Buce-phalus, in die stille Stube zurückzieht, wird der Ich-Erzähler zu einer Figur des Scheiternden. Abgesehen von den minimalen narrativen Zügen am Anfang besteht der Text also im Wesentlichen aus einer "aporetischen Selbstdiagnose" (Binder).
Inhaltsverzeichnis
- Einordnung des Textes Der neue Advokat in Kafkas Gesamtwerk
- Ich-Erzählform und personales Erzählverhalten
- formale und inhaltliche Analyse des Textes Der neue Advokat
- 1. Absatz
- 2. Absatz
- 3. Absatz
- (m)eine hermeneutische Deutung
- Deutungen anderer Interpreten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, Franz Kafkas Erzählung "Der neue Advokat" im Kontext seines Gesamtwerks zu analysieren und zu interpretieren. Die Untersuchung betrachtet die Erzählperspektive, die formale Struktur und den inhaltlichen Aufbau der Erzählung, um zu einer umfassenden Deutung zu gelangen. Dabei wird auch die Interpretation anderer Wissenschaftler berücksichtigt.
- Kafkas Schreibstil und Erzähltechnik
- Die Einordnung von "Der neue Advokat" in Kafkas Gesamtwerk
- Die biographischen Hintergründe der Entstehung der Erzählung
- Mögliche Interpretationen der Erzählung
- Vergleich mit anderen Interpretationen
Zusammenfassung der Kapitel
Einordnung des Textes Der neue Advokat in Kafkas Gesamtwerk: Dieses Kapitel untersucht die Entstehungsgeschichte von Kafkas "Der neue Advokat", platziert die Erzählung innerhalb seines Gesamtwerks und beleuchtet den biographischen Kontext ihrer Entstehung. Es analysiert verschiedene Quellen, darunter die Nachworte von Max Brod und Paul Raabe, sowie Forschungsliteratur zu Kafkas Schaffensphase im Winter 1916/17 in der Alchimistengasse in Prag. Der Fokus liegt auf der Einbettung der Erzählung in Kafkas Arbeitsweise und Lebensumständen während dieser Zeit, insbesondere seiner Beziehung zu Felice Bauer und dem Einfluss des Ersten Weltkriegs. Die unterschiedlichen Angaben zum genauen Entstehungszeitraum werden kritisch betrachtet und gegeneinander abgewogen.
Ich-Erzählform und personales Erzählverhalten: (Anmerkung: Da der Text keine weiteren Kapitelüberschriften mit substantiellem Inhalt aufweist, wird hier keine weitere Zusammenfassung erstellt. Die weiteren Kapitelpunkte 3, 4 und 5 bieten zu wenig Textmaterial für eine aussagekräftige Zusammenfassung.)
Schlüsselwörter
Franz Kafka, Der neue Advokat, Erzähltechnik, Biographischer Kontext, Interpretation, Hermeneutik, Gesamtwerk, Entstehungsgeschichte, Prag, Winter 1916/17, Erzählperspektive.
Franz Kafkas "Der neue Advokat": Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit analysiert und interpretiert Franz Kafkas Erzählung "Der neue Advokat" im Kontext seines Gesamtwerks. Die Analyse umfasst die Erzählperspektive, die formale Struktur und den inhaltlichen Aufbau der Erzählung, um zu einer umfassenden Deutung zu gelangen. Dabei werden auch Interpretationen anderer Wissenschaftler berücksichtigt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Kafkas Schreibstil und Erzähltechnik, die Einordnung von "Der neue Advokat" in Kafkas Gesamtwerk, die biographischen Hintergründe der Entstehung der Erzählung, mögliche Interpretationen der Erzählung und ein Vergleich mit anderen Interpretationen. Der Fokus liegt insbesondere auf der Ich-Erzählform und dem personalen Erzählverhalten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einordnung des Textes "Der neue Advokat" in Kafkas Gesamtwerk, Ich-Erzählform und personales Erzählverhalten, eine formale und inhaltliche Analyse der Erzählung (unterteilt in Absätze), eine hermeneutische Deutung und eine Darstellung der Deutungen anderer Interpreten. Leider sind die Kapitel 3, 4 und 5 zu kurz für eine aussagekräftige Zusammenfassung.
Was wird im Kapitel "Einordnung des Textes Der neue Advokat in Kafkas Gesamtwerk" behandelt?
Dieses Kapitel untersucht die Entstehungsgeschichte von "Der neue Advokat", platziert die Erzählung innerhalb von Kafkas Gesamtwerk und beleuchtet den biographischen Kontext. Es analysiert Quellen wie die Nachworte von Max Brod und Paul Raabe sowie Forschungsliteratur zu Kafkas Schaffensphase im Winter 1916/17. Die Beziehung zu Felice Bauer und der Einfluss des Ersten Weltkriegs werden ebenfalls betrachtet. Unterschiedliche Angaben zum Entstehungszeitraum werden kritisch geprüft.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Franz Kafka, Der neue Advokat, Erzähltechnik, Biographischer Kontext, Interpretation, Hermeneutik, Gesamtwerk, Entstehungsgeschichte, Prag, Winter 1916/17, Erzählperspektive.
Welche Art von Text ist dies?
Dies ist eine umfassende Vorschau auf eine sprachwissenschaftliche Arbeit, welche Titel, Inhaltsverzeichnis, Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Der Text stammt von einem Verlag und dient der akademischen Nutzung zur Analyse von Themen.
- Citar trabajo
- M.A. Gerd Berner (Autor), 2016, Franz Kafkas "Der neue Advokat". Versuch einer Interpretation, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/314498