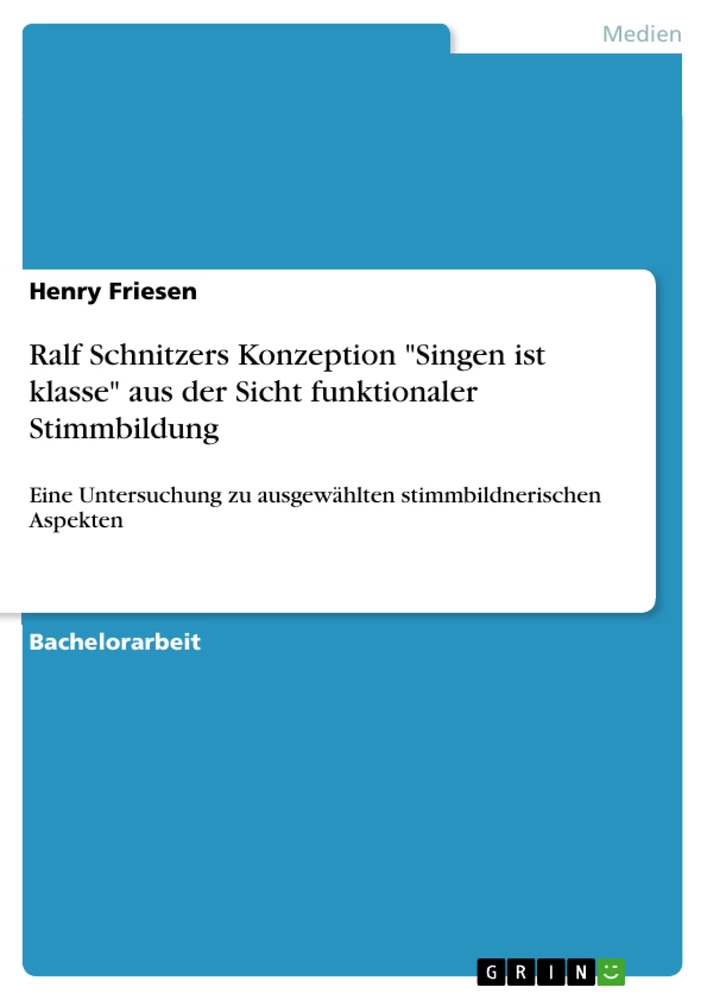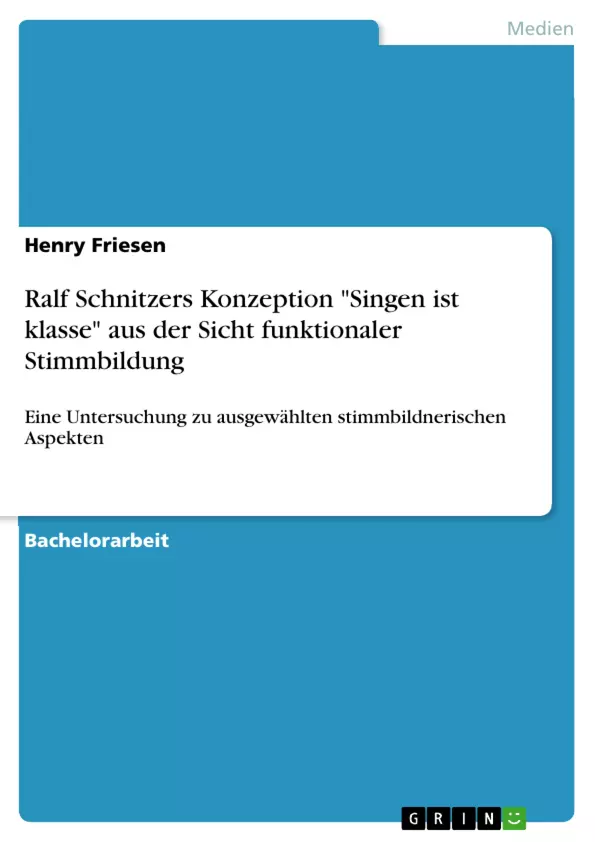Drei Fragestellungen möchte ich in der vorliegenden Arbeit nachgehen: Zum ersten, welche Ziele mit Ralf Schnitzers Konzeption „Singen ist klasse“ und mit dessen Stimmbildung verfolgt werden, zum zweiten, wie die Stimmbildung des Konzepts konkret aussieht und zum dritten, ob die genannten Ziele durch diese Stimmbildung erreichbar sind.
Um die Frage nach den Zielen zu beantworten, wird im ersten Teil dieser Arbeit eine in der Konzeption dargestellte Beschreibung der musikalischen Entwicklung und die daraus gezogenen Unterrichtskonsequenzen Aufschluss auf die gesamtkonzeptionelle Zielsetzung geben. Diese Darstellung wird allerdings nur ein grober Abriss bleiben und kann deshalb dem Anspruch auf Vollständigkeit nicht gerecht werden. Jedoch soll die Grundausrichtung dieser Konzeption deutlich werden.
Nachdem die gesamtkonzeptionelle Orientierung aufgezeigt wurde, möchte ich ein stimmbildnerisches Ziel hervorheben, das im besonderen Maße auf die gesamtkonzeptionelle Zielsetzung ausgerichtet ist. Daraufhin soll dargestellt werden, wie die Stimmbildung dieser Konzeption konkret aussieht. Da jedoch durch den begrenzten Rahmen dieser Arbeit nicht die gesamte Stimmbildung betrachtet werden kann, werde ich mich auf zwei stimmbildnerische Aspekte beschränken und diese wie folgt vorstellen:
1. die Nutzung des Vokals „i“ und 2. die impulsfördernden Zwerchfellübungen. Auf der einen Seite sollen diese Aspekte die Stimmbildung beschreiben, auf der anderen einen Untersuchungsgegenstand darstellen, an dem im dritten Teil dieser Arbeit die Stimmbildung genauer betrachtet werden soll. Um jedoch diese untersuchen zu können, wird zunächst ein Instrumentarium benötigt, mit dessen Hilfe eine Untersuchung überhaupt möglich ist. Dies soll im zweiten Teil dieser Arbeit aus der von Eugen Rabine beschriebenen Theorie zur Stimmfunktion zusammengestellt werden.
Die eigentliche Untersuchung soll dann im dritten Teil der Arbeit durchgeführt werden. Da eine umfassende Betrachtung der im Konzept „Singen ist klasse“ vertretenden Stimmbildung zwar mit der Funktionalen Stimmbildung möglich wäre, jedoch ebenfalls den Rahmen dieser Arbeit weit übersteigen würde, werde ich mich auf die zuvor genannten Aspekte beschränken. So soll in dieser Untersuchung gezeigt werden, ob die ausgewählten Aspekte das Erreichen der Zielsetzungen fördern und welche Potenziale aus der Sicht der Funktionalen Stimmbildung nach Eugen Rabine noch ungenutzt sind.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Das Konzept „Singen ist klasse“ und seine Stimmbildung
- 2.1 Die Entstehung und die gesamtkonzeptionelle Zielsetzung
- 2.2 Die Stimmbildung und ihre Zielsetzung
- 2.3 Ausgewählte stimmbildnerische Aspekte
- 2.3.1 Der Vokal „i“ und die hochfrequenten Klanganteile
- 2.3.2 Impulshafte Atemübungen und der körperliche Klang
- 2.3.3 Zusammenführung von zwei stimmbildnerischen Aspekten
- 2.4 Zusammenfassung
- 3. Die Funktionale Stimmbildung - Zusammenstellung eines Untersuchungsinstrumentariums
- 3.1 Die Funktionale Stimmbildung und ihre stimmbildnerische Ausrichtung
- 3.2 Begriffsdefinition
- 3.3 Das Untersuchungsinstrumentarium
- 3.3.1 Der Vokaltrakt als Resonator
- 3.3.2 Der Vokaltrakt als Artikulator
- 3.3.3 Das Doppelventil des Kehlkopfs
- 3.3.4 Zusammenfassung
- 4. Untersuchung der ausgewählten stimmbildnerischen Aspekte
- 4.1 Der Vokal „i“ – eine Untersuchung
- 4.1.1 Der Vokal „i“ und der Vokaltrakt als Resonator
- 4.1.2 Der Vokal „i“ und der Vokaltrakt als Artikulator
- 4.2 Impulshafte Atemübungen – eine Untersuchung
- 4.2.1 Impulshafte Atemübungen und das Doppelventil des Kehlkopfs
- 4.1 Der Vokal „i“ – eine Untersuchung
- 5. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit untersucht ausgewählte stimmbildnerische Aspekte des Konzepts „Singen ist klasse“ aus der Sicht funktionaler Stimmbildung. Ziel ist es, die Bedeutung der Stimmbildung im Rahmen des Konzepts zu beleuchten und zu analysieren, inwiefern die stimmbildnerische Zielsetzung zur Erreichung der gesamtkonzeptionellen Ziele beiträgt.
- Bedeutung der Stimmbildung im Konzept „Singen ist klasse“
- Analyse ausgewählter stimmbildnerischer Aspekte aus der Sicht funktionaler Stimmbildung
- Zusammenhang zwischen Stimmbildung und den gesamtkonzeptionellen Zielen des Konzepts
- Potenziale und Optimierungsmöglichkeiten der Stimmbildung im Rahmen des Konzepts
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in das Thema Singen in der Schule und dessen Entwicklung ein und stellt die Relevanz des Konzepts „Singen ist klasse“ im Kontext historischer und aktueller Strömungen dar. Im zweiten Kapitel werden das Konzept „Singen ist klasse“ sowie dessen gesamtkonzeptionelle Zielsetzung und die Bedeutung der Stimmbildung innerhalb des Konzepts näher beleuchtet. Hier werden auch ausgewählte stimmbildnerische Aspekte vorgestellt und diskutiert. Das dritte Kapitel erläutert die Funktionale Stimmbildung und stellt ein Untersuchungsinstrumentarium vor, das zur Analyse der stimmbildnerischen Aspekte verwendet wird.
Das vierte Kapitel konzentriert sich auf die Untersuchung der ausgewählten stimmbildnerischen Aspekte aus der Sicht funktionaler Stimmbildung. Hier werden der Vokal „i“ und die impulshaften Atemübungen unter verschiedenen Aspekten beleuchtet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Stimmbildung, Funktionale Stimmbildung, Konzept „Singen ist klasse“, Vokal „i“, Impulshafte Atemübungen, Resonanz, Artikulation, Doppelventil des Kehlkopfs, gesamtkonzeptionelle Zielsetzung, Musikunterricht, Grundmusikalisierung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Konzepts „Singen ist klasse“?
Das von Ralf Schnitzer entwickelte Konzept zielt auf eine musikalische Grundausbildung und Stimmbildung in der Schule ab, um Kindern einen gesunden und freudvollen Zugang zum Singen zu ermöglichen.
Welche Rolle spielt der Vokal „i“ in Schnitzers Stimmbildung?
Der Vokal „i“ wird genutzt, um hochfrequente Klanganteile in der Stimme zu fördern und den Vokaltrakt optimal als Resonator einzusetzen.
Was bewirken impulshafte Atemübungen für die Stimme?
Diese Übungen aktivieren das Zwerchfell und unterstützen die Funktion des Kehlkopfs, was zu einem stabileren und körperlich fundierten Klang führt.
Was versteht man unter „Funktionaler Stimmbildung“ nach Eugen Rabine?
Es ist ein wissenschaftlich fundierter Ansatz, der die physiologischen Abläufe beim Singen (Resonanz, Artikulation, Kehlkopffunktion) in den Mittelpunkt stellt.
Wie hängen Stimmbildung und musikalischer Erfolg im Unterricht zusammen?
Eine fundierte Stimmbildung ermöglicht es Schülern, ihre stimmlichen Potenziale auszuschöpfen, was die Qualität des gemeinsamen Singens und die individuelle Motivation steigert.
Gibt es Optimierungsmöglichkeiten für das Konzept „Singen ist klasse“?
Die Arbeit untersucht aus Sicht der funktionalen Stimmbildung, welche Potenziale (z.B. im Bereich des Kehlkopf-Doppelventils) noch ungenutzt sind.
- Quote paper
- Henry Friesen (Author), 2015, Ralf Schnitzers Konzeption "Singen ist klasse" aus der Sicht funktionaler Stimmbildung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/314766