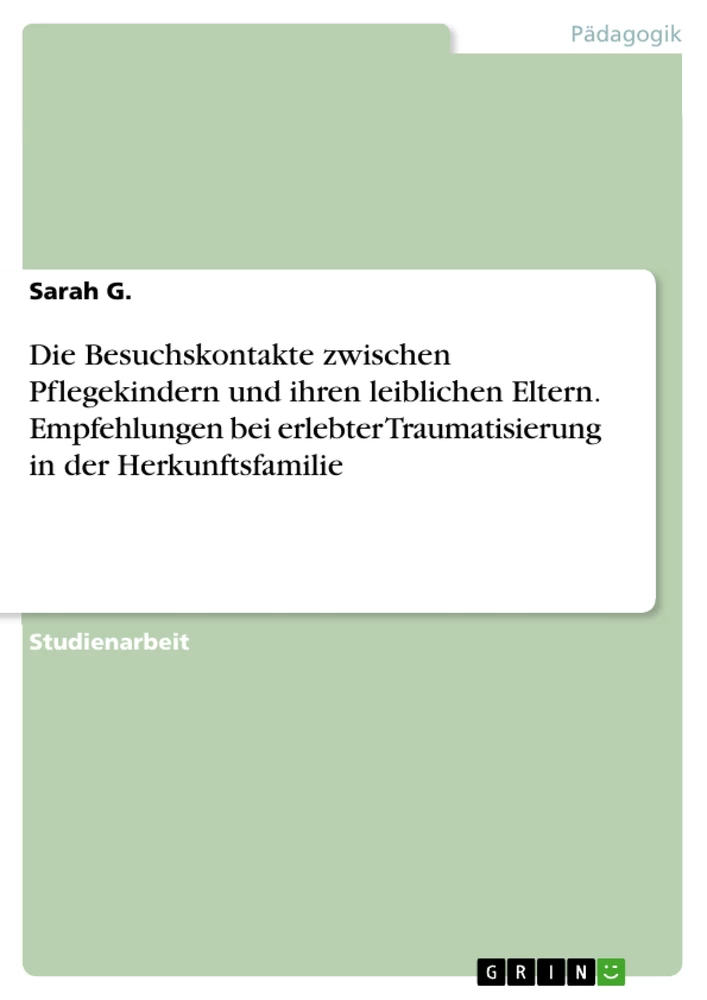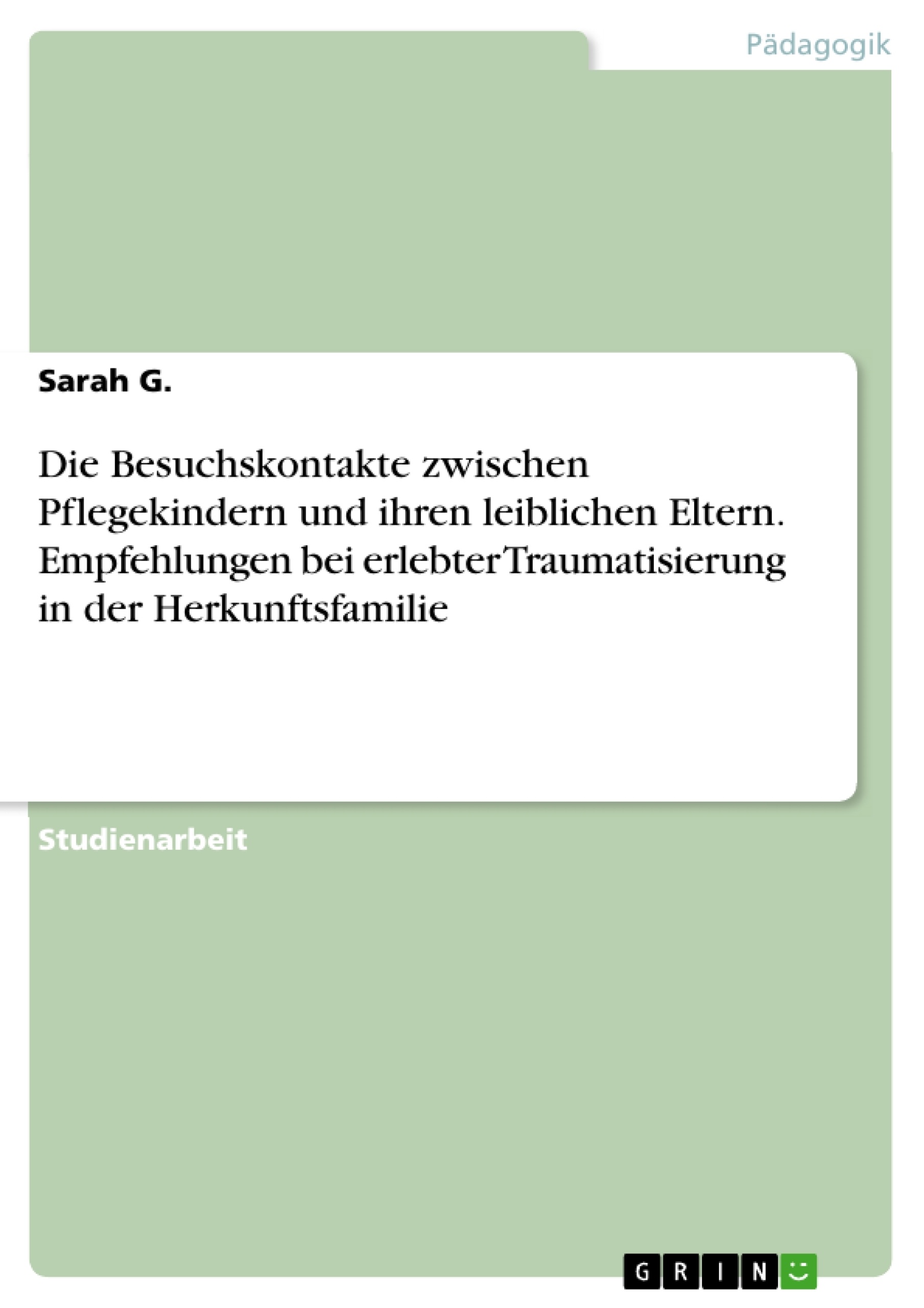Durch erlebte Traumatisierungen kann die Entwicklung von Pflegekindern behindert und durch Besuchskontakte der leiblichen Eltern eventuell weiter beeinträchtigt werden. Die Ergebnisse der Auseinandersetzung zum Thema Besuchskontakte bei Pflegekindern könnten vor allem PädagogInnen und BeraterInnen als Orientierungshilfe für die eigene pädagogische Praxis dienen.
Mit Hilfe einer Analyse von Fachliteratur zum Thema Besuchskontakte von Nienstedt und Westermann wird die Bedeutung von Besuchskontakten für Pflegekinder im Allgemeinen und für Pflegekinder mit erlebter Traumatisierung im Besonderen herausgearbeitet. Schließlich können auf dieser Basis Überlegungen getroffen bzw. Empfehlungen zu Besuchskontakten zwischen traumatisierten Pflegekindern und ihren leiblichen Eltern gegeben werden. Da sich Westermann und Nienstedt seit Jahrzehnten sowohl auf praktischer als auch auf theoretischer Ebene mit der Thematik der Heim-, Pflege-, und Adoptionskinder auseinandersetzen, werden diese Autoren als ExpertInnen zur Beantwortung unserer Forschungsfrage herangezogen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Die Bedeutung von Besuchskontakten
- 3. Empfehlung zu Besuchskontakten bei Pflegekindern mit erlebter Traumatisierung in der Herkunftsfamilie.
- 4. Résumé
- 5. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Seminararbeit untersucht die Empfehlungen von Monika Nienstedt und Arnim Westermann hinsichtlich Besuchskontakten zwischen Pflegekindern und ihren leiblichen Eltern im Fall von erlebter Traumatisierung in der Herkunftsfamilie. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie Besuchskontakte in solchen Fällen gestaltet werden sollten und welche Begründungen die Autoren für ihre Empfehlungen anführen. Das Ziel ist, einen Beitrag zur bildungswissenschaftlichen Forschung zu leisten, indem die Erkenntnisse von Nienstedt und Westermann analysiert und für die pädagogische Praxis nutzbar gemacht werden.
- Die Bedeutung von Besuchskontakten für Pflegekinder.
- Die Definition von "Trauma" und "Traumatisierung" nach Nienstedt und Westermann.
- Empfehlungen und Begründungen von Nienstedt und Westermann für Besuchskontakte zwischen traumatisierten Pflegekindern und ihren leiblichen Eltern.
- Die Auswirkungen von Besuchskontakten auf die Aufarbeitung von Traumatisierungen und die Entwicklung des Kindes.
- Die Bedeutung von differenzierten Empfehlungen für die Gestaltung von Besuchskontakten in Abhängigkeit vom individuellen Fall.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Im ersten Kapitel wird die Bedeutung von Besuchskontakten für Pflegekinder im Allgemeinen beleuchtet. Es werden die positiven Aspekte von Besuchskontakten für die Verarbeitung von Trennungserfahrungen, die Bewältigung von Gefühlen, die Reduzierung von magischem Denken und die Unterstützung der Identitätsfindung aufgezeigt. Im zweiten Kapitel werden die Definitionen von "Trauma" und "Traumatisierung" nach Nienstedt und Westermann vorgestellt. Das dritte Kapitel widmet sich den Empfehlungen von Nienstedt und Westermann für die Gestaltung von Besuchskontakten im Fall von erlebter Traumatisierung in der Herkunftsfamilie.
Schlüsselwörter (Keywords)
Besuchskontakte, Pflegekinder, Traumatisierung, Herkunftsfamilie, Entwicklung, Identitätsfindung, pädagogische Praxis, Empfehlungen, Nienstedt, Westermann.
Häufig gestellte Fragen
Sollten traumatisierte Pflegekinder Kontakt zu ihren leiblichen Eltern haben?
Die Arbeit untersucht Empfehlungen von Nienstedt und Westermann, die betonen, dass Besuchskontakte die Entwicklung behindern können, wenn sie das Kind erneut traumatisieren.
Welchen Nutzen haben Besuchskontakte im Idealfall?
Sie können bei der Verarbeitung von Trennungserfahrungen helfen, magisches Denken reduzieren und die Identitätsfindung unterstützen.
Was verstehen Nienstedt und Westermann unter einem Trauma?
Die Autoren definieren Trauma im Kontext von Vernachlässigung, Misshandlung oder massiven Störungen in der Herkunftsfamilie, die tiefe Spuren in der Psyche des Kindes hinterlassen.
Welche Empfehlungen gibt es für die pädagogische Praxis?
Besuchskontakte müssen hochgradig differenziert und am Wohl des Kindes orientiert gestaltet werden; in manchen Fällen ist ein zeitweiliger Ausschluss zum Schutz des Kindes nötig.
Wie wirken sich die Kontakte auf die Identitätsfindung aus?
Sie ermöglichen dem Kind, die Realität der leiblichen Eltern mit seinen inneren Bildern abzugleichen, was für die Entwicklung eines realistischen Selbstbildes wichtig sein kann.
- Arbeit zitieren
- Sarah G. (Autor:in), 2015, Die Besuchskontakte zwischen Pflegekindern und ihren leiblichen Eltern. Empfehlungen bei erlebter Traumatisierung in der Herkunftsfamilie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/314822