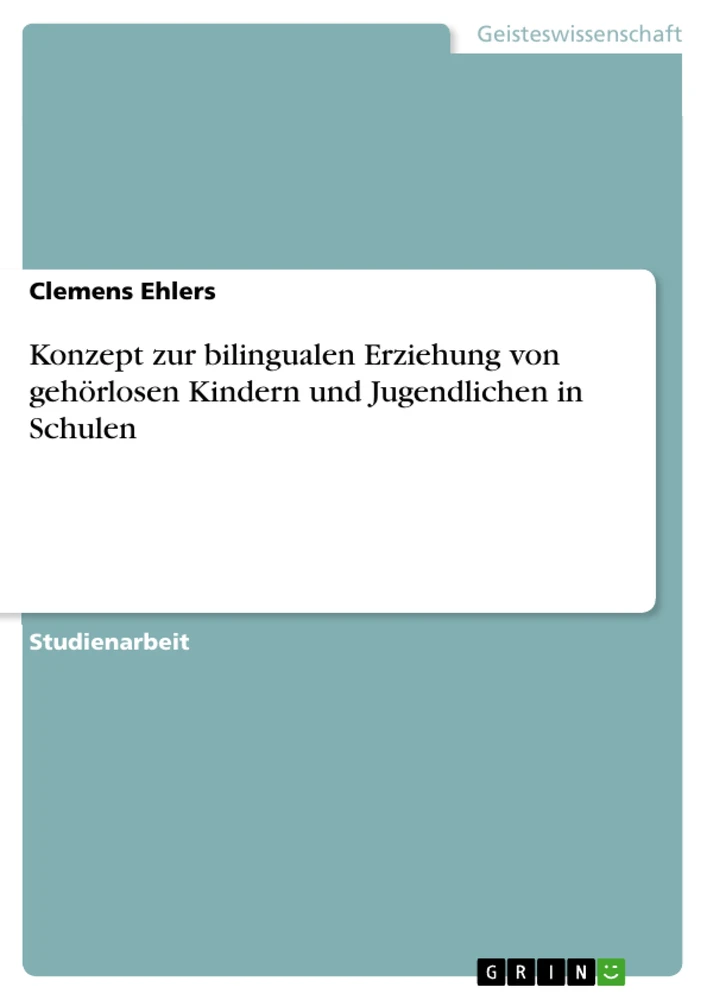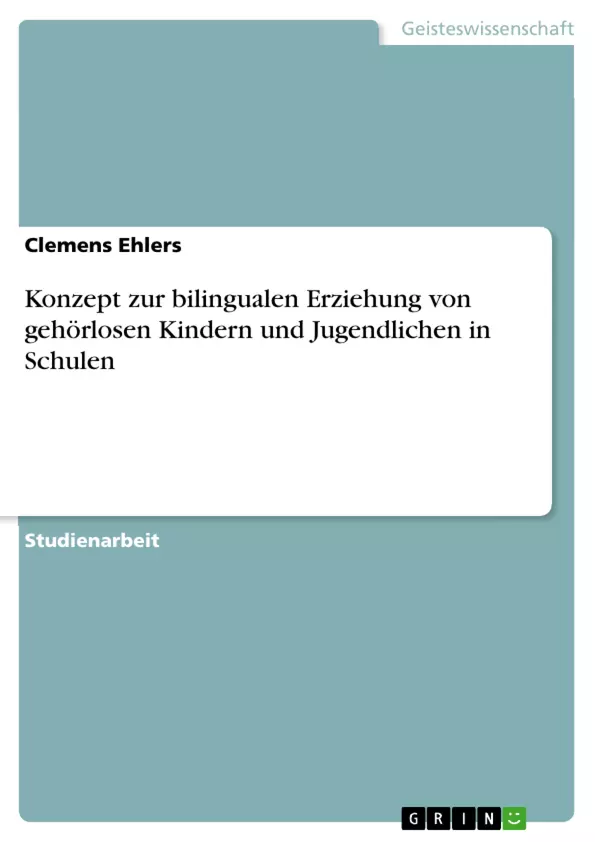Die vorliegende Arbeit thematisiert das Konzept der bilingualen Erziehung von gehörlosen Kindern und Jugendlichen in Schulen. Hierfür wurde ein Interview durchgeführt. Dabei hatte der Autor Einblicke in das Schulleben gewinnen können und mit Lehrkräften über den Unterricht sprechen können, welche die Grundlage dieser Arbeit bilden. Im ersten Teil der Arbeit wird auf Definitionen der Gehörlosenkultur eingegangen, wobei im Voraus zu sagen ist, dass es keine einheitlichen Definitionen, sondern gegenwärtig, nebeneinander stehende und teilweise sich überlappende Ansätze gibt. Der zweite Teil widmet sich dem Bilingualismus und dem Konzept der A-Schule sowie den Konzepten und Schulversuchen in anderen Ländern.
Zur besseren Lesbarkeit der vorliegenden Arbeit wurde auf die gleichzeitige Verwendung von männlicher und weiblicher Sprachform bei den Worten „gehörloser“ und „gehörlosen“ verzichtet. Gemeint sind beide Geschlechter. Mit dem Wort „Gehörloser“ werden auch die Menschen mit inbegriffen welche schwerhörig sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition Gehörlosigkeit
- Taubstumm, Gehörlos, Schwerhörig
- Gehörlosigkeit als Behinderung
- Die Sprachen der Gehörlosen
- Deutsche Gebärdensprache (DGS)
- Lautsprache
- Lautsprachbegleitende Gebärden (LBG)
- Bilingualismus
- Bilingualismus in der Gehörlosenpädagogik
- Konzept zur Bilingualen Erziehung an der A-Schule
- Auswertungen des Konzepts der A-Schule
- Internationaler Blick
- Österreich
- Niederlande
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht das Konzept der bilingualen Erziehung von gehörlosen Kindern und Jugendlichen in Schulen. Im Mittelpunkt steht die Analyse des Konzepts der A-Schule und dessen Anwendung in der Praxis. Die Arbeit befasst sich außerdem mit Definitionen der Gehörlosenkultur, den unterschiedlichen Sprachen der Gehörlosen sowie mit der Integration von bilingualen Konzepten in anderen Ländern.
- Definition der Gehörlosigkeit und ihrer verschiedenen Facetten
- Die Bedeutung der Deutschen Gebärdensprache (DGS) für die Bildung und Kultur der Gehörlosen
- Die Anwendung des bilingualen Konzepts in der A-Schule
- Internationale Beispiele für bilinguale Erziehung von Gehörlosen
- Die Herausforderungen und Chancen der Inklusion von gehörlosen Kindern und Jugendlichen im Bildungssystem
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Begriff des Bilingualismus im Kontext der Gehörlosenpädagogik vor und erläutert die Bedeutung der Gebärdensprache für die Bildung von Gehörlosen. Im zweiten Kapitel werden verschiedene Definitionen der Gehörlosigkeit beleuchtet, wobei medizinische, audiologische und pädagogische Perspektiven auf die Thematik einbezogen werden. Das dritte Kapitel widmet sich den Sprachen der Gehörlosen, wobei die Deutsche Gebärdensprache, die Lautsprache und die Lautsprachbegleitenden Gebärden (LBG) näher betrachtet werden. Kapitel vier befasst sich mit dem Konzept des Bilingualismus in der Gehörlosenpädagogik, insbesondere mit dem Modell der A-Schule. In diesem Kapitel werden die Ziele und die Umsetzung des Konzepts der A-Schule analysiert.
Schlüsselwörter
Gehörlosigkeit, Gebärdensprache, Bilingualismus, A-Schule, inklusive Bildung, Sonderpädagogik, Gehörlosenpädagogik, Hörschaden, Lautsprache, Lautsprachbegleitende Gebärden, DGS, ÖGS, ASL, AusLan, Inklusion.
Häufig gestellte Fragen
Was ist bilinguale Erziehung bei Gehörlosen?
Es ist ein pädagogisches Konzept, bei dem sowohl die Deutsche Gebärdensprache (DGS) als auch die Lautsprache (meist in schriftlicher Form) gleichberechtigt im Unterricht genutzt werden.
Was ist das Konzept der „A-Schule“?
Die A-Schule ist ein spezifisches Schulmodell, das bilinguale Konzepte in der Praxis umsetzt und in dieser Arbeit durch Interviews mit Lehrkräften analysiert wird.
Was sind lautsprachbegleitende Gebärden (LBG)?
LBG unterstützen die Lautsprache durch Gebärden, folgen aber der Grammatik der gesprochenen Sprache, im Gegensatz zur eigenständigen Grammatik der DGS.
Wie wird Gehörlosigkeit in der Gehörlosenkultur definiert?
Gehörlosigkeit wird nicht nur als medizinische Behinderung, sondern oft als kulturelle Identität mit einer eigenen Sprache und Gemeinschaft verstanden.
Welche internationalen Beispiele für bilinguale Erziehung gibt es?
Die Arbeit wirft einen Blick auf Konzepte und Schulversuche in den Niederlanden und in Österreich (ÖGS).
Welche Herausforderungen bietet die Inklusion für gehörlose Kinder?
Die Arbeit diskutiert die Chancen der Integration ins allgemeine Bildungssystem und die Notwendigkeit spezieller sonderpädagogischer Unterstützung.
- Quote paper
- Clemens Ehlers (Author), 2013, Konzept zur bilingualen Erziehung von gehörlosen Kindern und Jugendlichen in Schulen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/314951