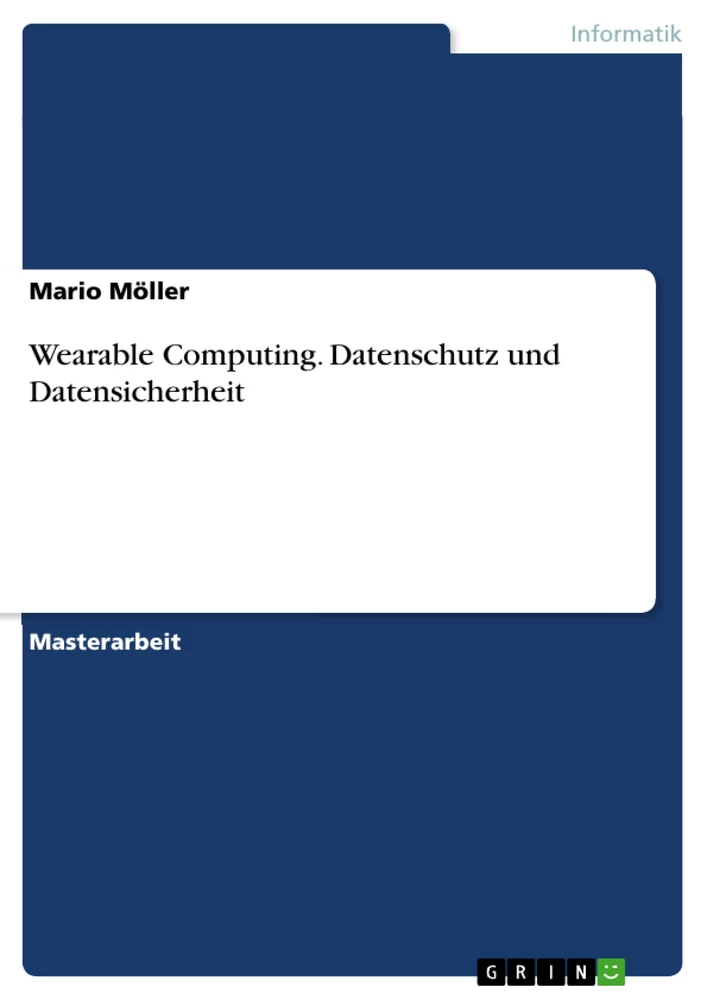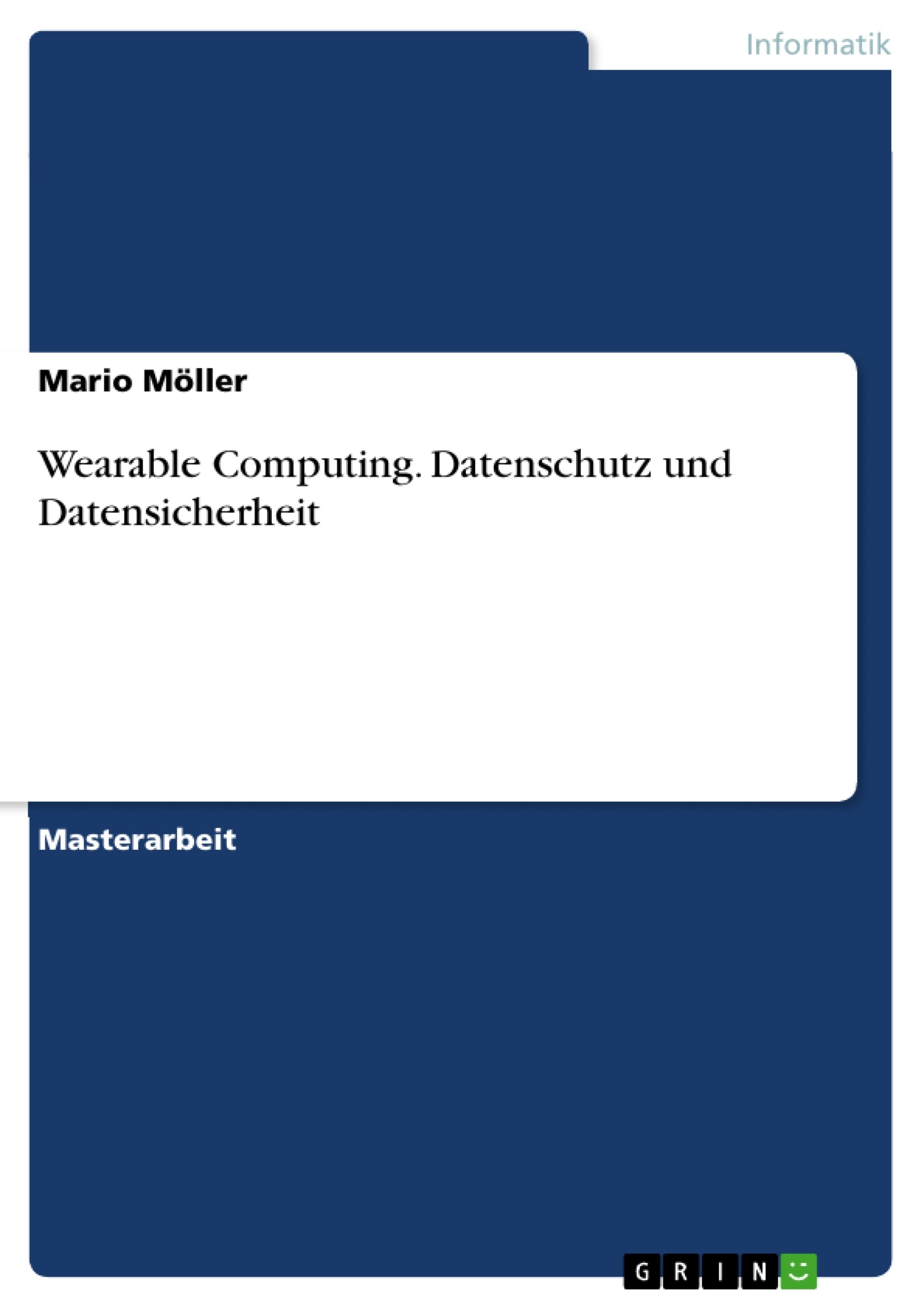Die technologische Entwicklung ist einer rasanten Beschleunigung unterworfen, die nicht nur die Geschwindigkeit der einzelnen Komponenten betrifft, sondern auch deren
Vernetzung und Kommunikationsfähigkeit. Neben der Miniaturisierung und dem Hinzugewinn von Mobilität verringerte sich auch die körperliche Distanz bei der Computernutzung durch den Menschen. Zudem erhöhte sich der Zeitraum, in dem das Gerät sich in unmittelbarer körperliche Nähe zum Nutzer befindet. Es ist nicht länger nötig, spezielle Räume für Datenverarbeitung aufzusuchen. Es genügt ein Griff in die Hosentasche, um das Smartphone nutzen zu können, das den Charakter eines vernetzen mobilen Computers mit Telefoniefunktion besitzt. Das Smartphone hilft so im Alltag bei der mobilen Kommunikation und der Beschaffung von Informationen. Häufig wird es aber in den unpassendsten Momenten zu einem akustischen Ärgernis und erfordert zudem
bei der Bedienung die volle Aufmerksamkeit.
Das Wearable Computing setzt an dieser Stelle an. Es verändert entscheidend die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, wobei für das Gerät erkennbar wird, wann jemand Informationen benötigt oder wann er gestört werden kann. Das Gerät wird am Körper getragen, ist permanent aktiv und stellt dem Träger unmittelbar und dezent Informationen zum Abruf bereit. Die Herausforderung liegt darin, dass es die Umwelt
und den Träger (er-)kennen muss, um situationsbedingte Entscheidungen treffen zu können. Dazu greift das Gerät auf Sensoren zurück, die unter anderem Vitaldaten des Trägers oder audiovisuelle Daten der Umwelt erfassen. Bietet diese Technologie damit ein großes Potential, das es auszuloten gilt, stellen sich zugleich die Fragen, ob Wearable Computing als Innovation die Menschen einen Schritt weiter in die totale Digitalisierung führt und es damit zum informationellen Kontrollverlust kommt oder ob der Datenschutz und die Datensicherheit sich vor dem immer lauter schallenden „Code is Law!“ behaupten kann.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1 Einleitung
- 1.1 Problem- und Aufgabenstellung
- 1.2 Zielsetzung der Arbeit
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 2 Datenschutz und Datensicherheit
- 2.1 Daten und Informationen
- 2.1.1 Daten im juristischen Sinne
- 2.1.2 Daten in der Computerwissenschaft
- 2.1.3 Informationen
- 2.2 Datenschutz
- 2.2.1 Motivation zur Schaffung von Datenschutz
- 2.2.2 Datenschutz in Deutschland
- 2.2.3 Datenschutz in Europa
- 2.2.4 Datenschutz International
- 2.2.5 Datenschutz Grundprinzipien
- 2.2.6 Safe-Harbor-Abkommen
- 2.3 Datensicherheit
- 2.3.1 Schutzziele
- 2.3.2 Datensicherheit operationalisieren
- 2.4 Soziologische Aspekte von Datenschutz und Datensicherheit
- 3 Wearable Computing
- 3.1 Einführung
- 3.1.1 Attribute des Wearable Computing
- 3.1.2 Augmented Reality
- 3.1.3 Interessenvertreter und treibende Faktoren
- 3.2 Abgrenzung zu anderen Technologien
- 3.2.1 Ubiquitous Computing und Wearable Computing
- 3.2.2 Mobile Computing und Wearable Computing
- 3.3 Klassifikation von Wearables
- 3.3.1 Einteilung nach Körperteil und Anwendungsbereich
- 3.3.2 Einteilung nach technologischer Entwicklung
- 3.4 Technische Daten
- 3.4.1 Hardwarearchitektur
- 3.4.2 Sensoren
- 3.4.3 Betriebsdauer
- 3.4.4 Speicherkapazität
- 3.5 Evaluation des Datenschutzes
- 3.5.1 Anwendung im Sport und Fitnessbereich
- 3.5.2 Anwendung in der Medizin
- 3.5.3 Anwendung in der Versicherungsbranche
- 3.5.4 Anwendung bei der Polizei und der Strafverfolgung
- 3.5.5 Anwendung in der Industrie
- 3.5.6 Wearable Computing und die Prinzipien des Datenschutzes
- 3.6 Evaluation der Datensicherheit
- 3.6.1 Ermitteln des Schutzbedarfs
- 3.6.2 Ermitteln des Informationsflusses
- 3.6.3 Sicherheit der Kommunikation
- 3.6.4 Sicherheit von Wearable-Betriebssystemen
- 3.6.5 Risiken für die Datensicherheit
- 3.6.6 Datensicherheit im Privat- und Geschäftsumfeld
- Datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen des Wearable Computing
- Datensicherheitsrisiken im Zusammenhang mit Wearables
- Technische und organisatorische Maßnahmen zur Sicherung von Daten im Wearable Computing
- Soziokulturelle Auswirkungen von Wearable Computing auf Datenschutz und Datensicherheit
- Zukünftige Entwicklungen und Trends im Bereich Wearable Computing und Datenschutz
- Kapitel 1: Einleitung
Dieses Kapitel führt in das Thema Wearable Computing ein und erläutert die Problem- und Aufgabenstellung der Arbeit. Es definiert die Zielsetzung und den Aufbau der Master-Thesis. - Kapitel 2: Datenschutz und Datensicherheit
Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse des Datenschutzes und der Datensicherheit im Kontext von Wearable Computing. Es behandelt die Definition von Daten und Informationen, die rechtlichen Rahmenbedingungen des Datenschutzes und die wichtigsten Datensicherheitskonzepte. - Kapitel 3: Wearable Computing
Dieses Kapitel analysiert die Technologie des Wearable Computing. Es beschreibt die Attribute, Anwendungsbereiche und technischen Eigenschaften von Wearables. Zudem werden die Abgrenzung zu anderen Technologien, die Klassifikation von Wearables und die Evaluation des Datenschutzes und der Datensicherheit im Kontext von Wearable Computing behandelt.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Master-Thesis befasst sich mit dem Thema Wearable Computing und untersucht die damit verbundenen Datenschutz- und Datensicherheitsaspekte. Ziel der Arbeit ist es, die Herausforderungen und Chancen des Wearable Computing im Kontext von Datenschutz und Datensicherheit zu analysieren und Lösungsansätze zu entwickeln.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Schlüsselwörter (Keywords)
Wearable Computing, Datenschutz, Datensicherheit, Augmented Reality, Ubiquitous Computing, Mobile Computing, Sensoren, Datenverarbeitung, Rechtliche Rahmenbedingungen, Datensicherheitsrisiken, Schutzmaßnahmen, Soziokulturelle Auswirkungen, Zukünftige Entwicklungen
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet Wearable Computing von Smartphones?
Wearables werden direkt am Körper getragen, sind permanent aktiv und agieren situationsabhängig, während Smartphones oft die volle Aufmerksamkeit des Nutzers für die Bedienung erfordern.
Welche Datenschutzrisiken birgt Wearable Computing?
Da Wearables Vitaldaten und Umgebungsdaten über Sensoren erfassen, besteht die Gefahr eines informationellen Kontrollverlusts und einer totalen Digitalisierung des Privatlebens.
In welchen Bereichen werden Wearables eingesetzt?
Typische Anwendungsbereiche sind Sport und Fitness, Medizin, die Versicherungsbranche, die Industrie sowie Polizei und Strafverfolgung.
Was bedeutet der Begriff „Code is Law“ in diesem Kontext?
Er beschreibt die Fragestellung, ob technische Algorithmen die Regeln des Datenschutzes faktisch ersetzen oder ob rechtliche Rahmenbedingungen weiterhin die Oberhand behalten.
Wie wird die Datensicherheit bei Wearables gewährleistet?
Durch die Ermittlung des Schutzbedarfs, die Sicherung des Informationsflusses und der Kommunikation sowie die Analyse der Sicherheit von Wearable-Betriebssystemen.
- Quote paper
- Mario Möller (Author), 2015, Wearable Computing. Datenschutz und Datensicherheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/315001