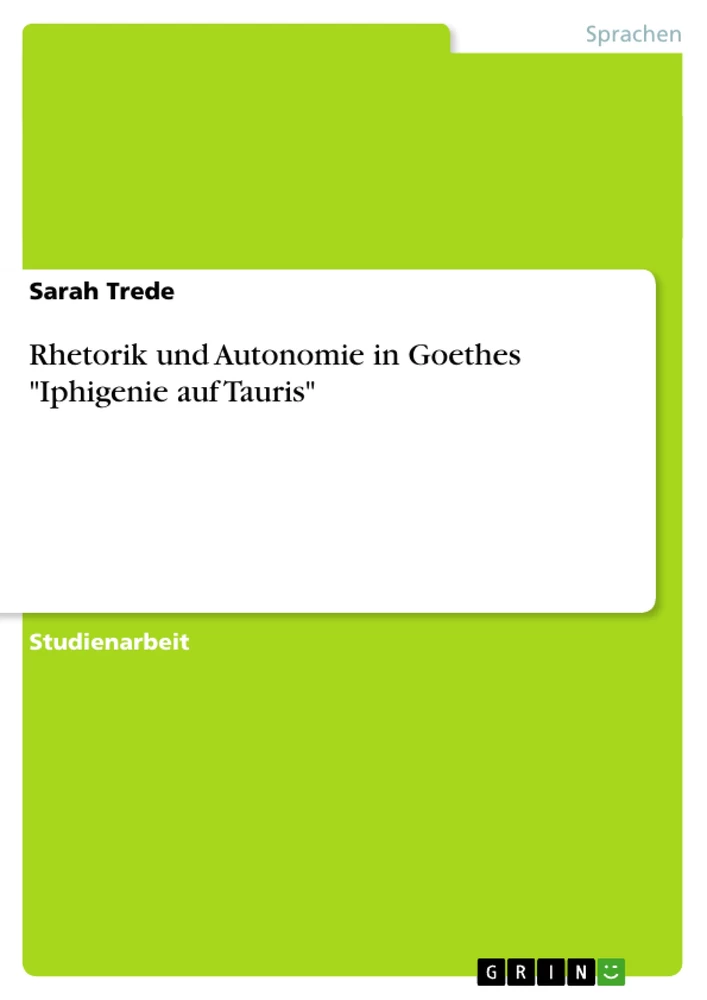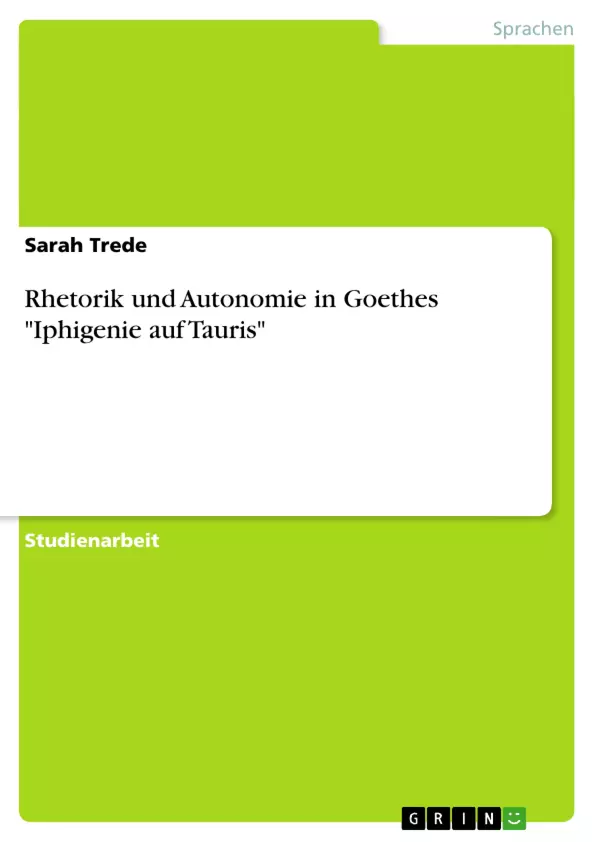„Was der Dichter diesem Bande/ Glaubend, hoffend anvertraut,/ Werd’ im Kreise deutscher Lande/ Durch des Künstlers Wirken laut./ So im Handeln, so im Sprechen/ Liebevoll verkünd’ es weit:/ Alle menschlichen Gebrechen/ sühnet reine Menschlichkeit.“
Diese Verse Goethes, die er für einen Schauspieler, der den Orest spielte, in dessen Exemplar von „Iphigenie auf Tauris“ schrieb, wurden von der Literaturwissenschaft über einen langen Zeitraum hinweg dahingehend ausgelegt, im Zentrum des Stückes stehe der Triumph der Humanität. Und Goethe stelle dies durch seine Figur der Iphigenie, quasi als Personifikation der Menschlichkeit, dar, wobei diese Grundthese der meisten Interpretationen nur selten hinterfragt wurde.
Genau das jedoch macht W. Rasch in seinem Buch „Goethes ‚Iphigenie auf Tauris’ als Drama der Autonomie“, daß eine moderne Deutung des Stücks darstellt und sowohl die Aussagen Goethes zu seinem Werk als auch die daraus folgenden traditionellen Forschungsergebnisse kritisch betrachtet. Er kommt daraufhin zu dem Schluß, daß als zentrales Thema nicht die Humanität Iphigenies, sondern vielmehr der Autonomiegedanke, den Goethe in diesem Werk ausführt und seinem Publikum vermitteln will, in den Mittelpunkt der Interpretation gerückt werden muß, eine Ansicht, die wiederum von Literaturwissenschaftlern kritisiert wird.
Die Unabhängigkeit der Figuren beschränkt sich aber nicht nur auf das persönliche Verhalten des Einzelnen, sondern zeigt sich zusätzlich dadurch, daß der Umgang mit den Göttern durch die menschliche Autonomie verändert wird, und in ein neues, gleichberechtigteres Verhältnis gesetzt wird.
Die Interpretation des Schauspiels durch Rasch will ich im folgenden in ihren Grundzügen darstellen, sowie dadurch auch die Unterschiede zwischen dieser und der traditionellen Sichtweise deutlich machen.
Danach möchte ich auf die rhetorischen Theorien in „Iphigenie auf Tauris“ eingehen, wobei der Rhetorikbezug Goethes, den wir im Verlauf des Seminars in allen behandelten Werken herausgearbeitet haben, hier sehr eng mit der neueren Deutung zusammenhängt. Denn um wirklich autonom agieren zu können, bedarf der Mensch der rhetorischen Mittel, da er nur, wenn er seinen Willen sich selbst und anderen gegenüber auszudrücken in der Lage ist, diesen daraufhin auch in die Tat umsetzen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Interpretation von Rasch im Vergleich zur traditionellen Sichtweise
- Autonomie und die rhetorischen Strategien der Figuren
- Die Rhetoriktheorie unter dem Aspekt Blumenbergs
- Schlußbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht Goethes „Iphigenie auf Tauris“ unter dem Aspekt der Autonomie und der Rhetorik. Sie stellt die Interpretation des Stücks durch W. Rasch in den Vordergrund, der den Autonomiegedanken als zentrales Thema des Werks hervorhebt und damit von traditionellen Interpretationen abweicht, die den Triumph der Humanität in den Mittelpunkt stellen.
- Die Relevanz des Autonomiebegriffs in „Iphigenie auf Tauris“
- Die kritische Auseinandersetzung mit den Aussagen Goethes und den daraus folgenden Interpretationen
- Die Rolle der Rhetorik im Hinblick auf die Autonomie der Figuren
- Die Analyse der rhetorischen Strategien der Charaktere im Drama
- Der Einfluss der Rhetoriktheorie auf die Interpretation des Stücks
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung beleuchtet die bisherige Interpretation von Goethes „Iphigenie auf Tauris“ und stellt die Kernaussagen von W. Rasch in seinem Werk „Goethes,Iphigenie auf Tauris' als Drama der Autonomie“ vor. Rasch argumentiert, dass nicht die Humanität Iphigenies, sondern der Autonomiegedanke im Mittelpunkt des Werks steht.
Die Interpretation von Rasch im Vergleich zur traditionellen Sichtweise
Dieses Kapitel vertieft die Analyse von Raschs Interpretation und setzt sie in Beziehung zu traditionellen Ansichten. Rasch interpretiert Goethes Zitat über die „reine Menschlichkeit“ nicht als Bezug auf Iphigenie, sondern als Hinweis auf Orests Verantwortung für seinen Muttermord. Dabei wird der Unterschied zwischen der göttlichen und menschlichen Sühne hervorgehoben, der in Raschs Sichtweise eine zentrale Rolle spielt.
Autonomie und die rhetorischen Strategien der Figuren
Dieses Kapitel untersucht die Rhetorik im Drama und ihren Zusammenhang mit dem Autonomiebegriff. Es wird argumentiert, dass die Fähigkeit zur Rhetorik für die Figuren von entscheidender Bedeutung ist, um ihren Willen zu artikulieren und zu verwirklichen.
Die Rhetoriktheorie unter dem Aspekt Blumenbergs
Dieses Kapitel befasst sich mit den rhetorischen Theorien, die in „Iphigenie auf Tauris“ zum Ausdruck kommen. Hierbei wird ein Aufsatz von Hans Blumenberg miteinbezogen, der die rhetorischen Strategien der Charaktere im Drama untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Schlüsselbegriffe Autonomie, Rhetorik, Humanität, Iphigenie auf Tauris, Goethes Werke, Interpretation, traditionelle Ansichten, W. Rasch, Hans Blumenberg. Sie analysiert die Bedeutung dieser Begriffe im Kontext des Stücks und erforscht ihre Wechselwirkungen.
- Citar trabajo
- Sarah Trede (Autor), 2003, Rhetorik und Autonomie in Goethes "Iphigenie auf Tauris", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31500