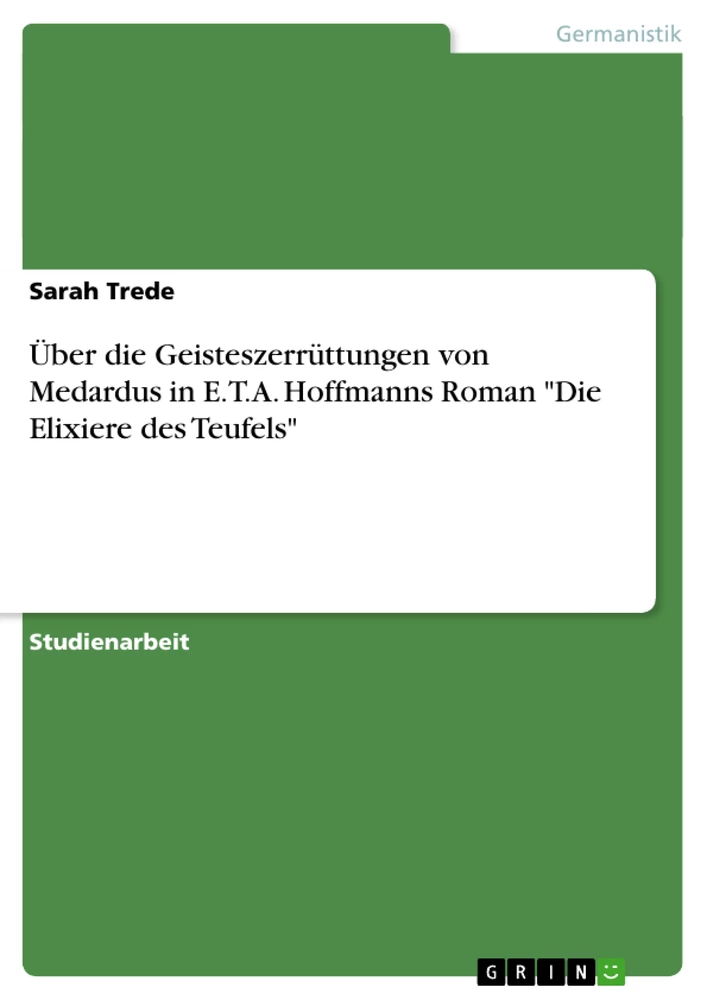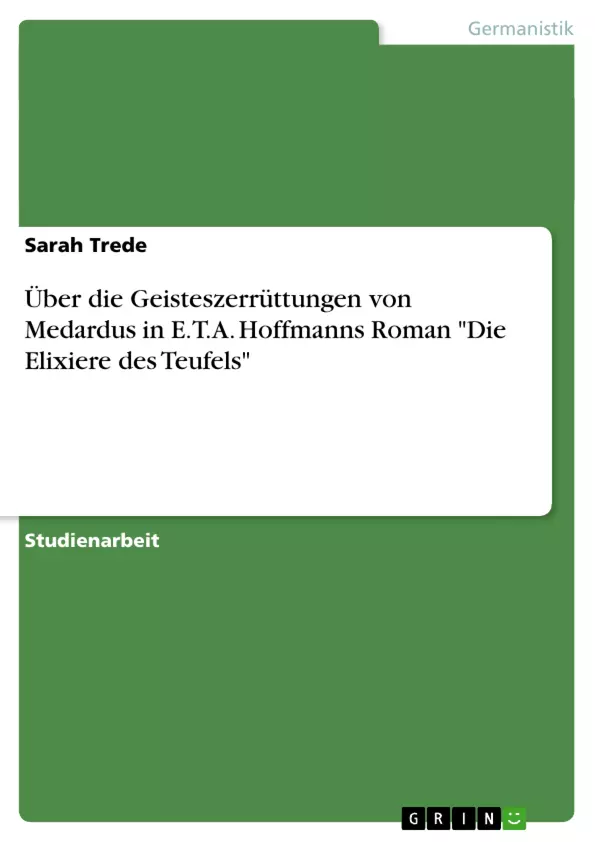„..., da erhob sich plötzlich ein nackter Mensch bis an die Hüfte aus der Tiefe empor und starrte mich gespenstisch an mit des Wahnsinns grinsendem, entsetzlichem Gelächter. Der volle Schein der Lampe fiel auf das Gesicht – ich erkannte mich selbst – mir vergingen die Sinne.“
In derart furchterregenden Bildern schildert E.T.A. Hoffmann in seinem Roman „Die Elixiere des Teufels“ (erschienen 1815/1816), der zum Genre des Schauerromans gezählt wird, den Wahnsinn seiner Hauptfigur Medardus, einem Kapuzinermönch. Durch den autobiographischen Erzählstil und immer wiederkehrende unheimliche Motive werden dessen psychische Grenzerfahrungen dem Leser sehr eindrücklich vermittelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Melancholie bzw. Fixer Wahnsinn
- Ursachen der Melancholie
- Reil
- Hoffmann
- Äußerungsformen der Melancholie
- Reil
- Hoffmann
- Kur der Melancholie
- Reil
- Hoffmann
- Ursachen der Melancholie
- Manie bzw. Tobsucht
- Reil
- Hoffmann
- Exkurs: Die Bedeutung von Schlaf und Traum in den Geisteszerrüttungen
- Reil
- Hoffmann
- Zusammenfassung und Schlußbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, die Darstellung des Wahnsinns in E.T.A. Hoffmanns Roman „Die Elixiere des Teufels“ im Kontext der medizinischen und psychologischen Ansätze der Romantik zu analysieren. Dabei wird untersucht, inwiefern Hoffmanns Beschreibungen des Wahnsinns auf medizinische und psychologische Theorien der Zeit zurückgreifen oder diese adaptieren, aber auch, inwieweit sie als literarisches Stilmittel eingesetzt werden, um beim Leser ein starkes Gefühl des Grusels zu erzeugen.
- Medizinischer und psychologischer Kontext des Wahnsinns in der Romantik
- Vergleich von Hoffmanns Beschreibungen mit den Ausführungen von Johann Christian Reil in „Rhapsodieen über die Anwendung der psychischen Curmethode auf Geisteszerrüttungen“
- Die Rolle der Melancholie und der Manie in der Geisteszerrüttung Medardus’
- Literarische Stilmittel zur Darstellung des Wahnsinns
- Bedeutung von Schlaf und Traum in der psychischen Verfassung Medardus’
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Der Roman „Die Elixiere des Teufels“ schildert den Wahnsinn des Kapuzinermönchs Medardus. Die Arbeit untersucht, inwiefern Hoffmanns Darstellung des Wahnsinns an den medizinischen und psychologischen Kontext der Romantik anlehnt und die Rolle von literarischen Stilmitteln bei der Vermittlung des Grusels.
- Melancholie bzw. Fixer Wahnsinn: Dieses Kapitel analysiert die Ursachen, Äußerungsformen und die Kur der Melancholie, sowohl nach Reil als auch in Hoffmanns Roman. Reils Theorie wird gegenübergestellt mit Hoffmanns Darstellung des Wahnsinns Medardus’.
- Manie bzw. Tobsucht: Hier werden Reils Ausführungen zur Manie und Tobsucht mit Hoffmanns Darstellung des Wahnsinns verglichen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten.
- Exkurs: Die Bedeutung von Schlaf und Traum in den Geisteszerrüttungen: Dieser Abschnitt untersucht die Rolle von Schlaf und Traum in der Entstehung und Bewältigung von Geisteszerrüttungen, sowohl aus Reils Sicht als auch in Hoffmanns Roman.
Schlüsselwörter
Wahnsinn, Hysterie, Verbrechen, Aufklärung, Romantik, Medizin, Psychologie, E.T.A. Hoffmann, „Die Elixiere des Teufels“, Medardus, Johann Christian Reil, „Rhapsodieen über die Anwendung der psychischen Curmethode auf Geisteszerrüttungen“, Melancholie, Manie, Fixer Wahnsinn, Tobsucht, Schlaf, Traum, Grusel, Literatur, Stilmittel.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Wahnsinn in E.T.A. Hoffmanns 'Die Elixiere des Teufels' dargestellt?
Hoffmann nutzt furchterregende, unheimliche Bilder und einen autobiographischen Erzählstil, um die psychischen Grenzerfahrungen und die Identitätskrise der Hauptfigur Medardus für den Leser greifbar zu machen.
Welchen Einfluss hatte Johann Christian Reil auf das Werk?
Reils Werk 'Rhapsodieen über die Anwendung der psychischen Curmethode' lieferte den medizinisch-psychologischen Kontext der Zeit. Hoffmann adaptierte Reils Theorien über Melancholie und Manie für seine literarische Darstellung.
Was ist der Unterschied zwischen Melancholie und Manie im Roman?
Melancholie wird oft als 'fixer Wahnsinn' mit tiefen psychischen Ursachen beschrieben, während Manie sich als Tobsucht und unkontrollierter Ausbruch äußert. Beide Zustände spiegeln Medardus' Zerrüttung wider.
Welche Rolle spielen Schlaf und Traum bei Medardus?
Schlaf und Traum dienen im Roman als Übergangszustände, in denen das Unbewusste und der Wahnsinn hervorbrechen. Sie sind entscheidend für die Entstehung seiner psychischen Zerrüttung.
Warum gilt der Roman als Schauerroman?
Wegen der Verwendung unheimlicher Motive, der Darstellung von Wahnsinn, Verbrechen und Doppelgängertum, die darauf abzielen, beim Leser Grusel und psychologisches Unbehagen zu erzeugen.
- Citar trabajo
- Sarah Trede (Autor), 2003, Über die Geisteszerrüttungen von Medardus in E.T.A. Hoffmanns Roman "Die Elixiere des Teufels", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31501