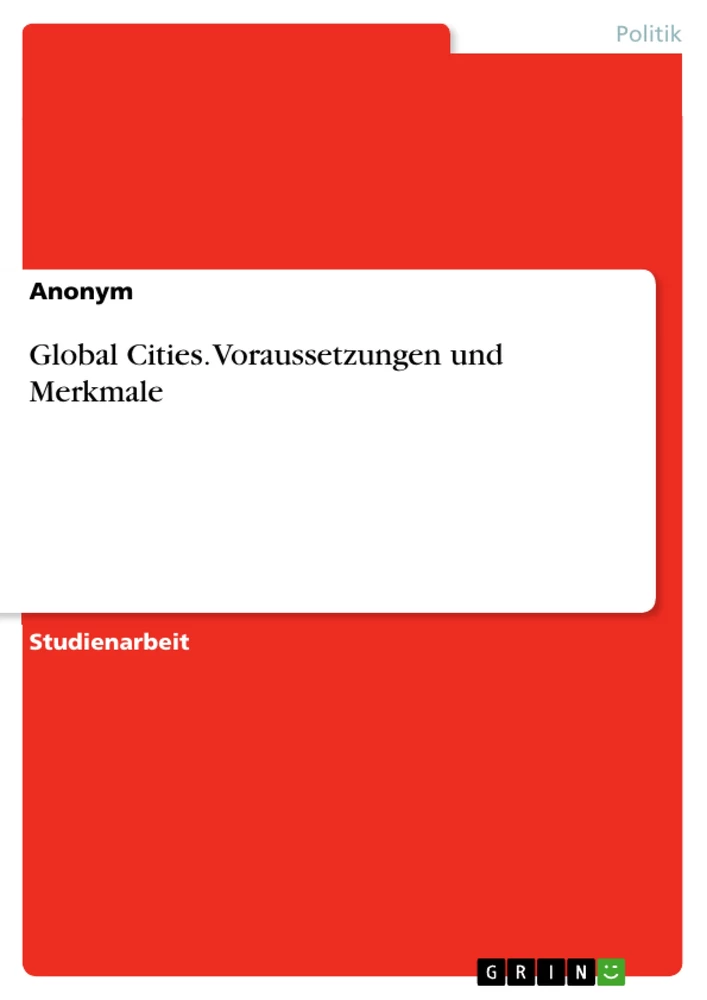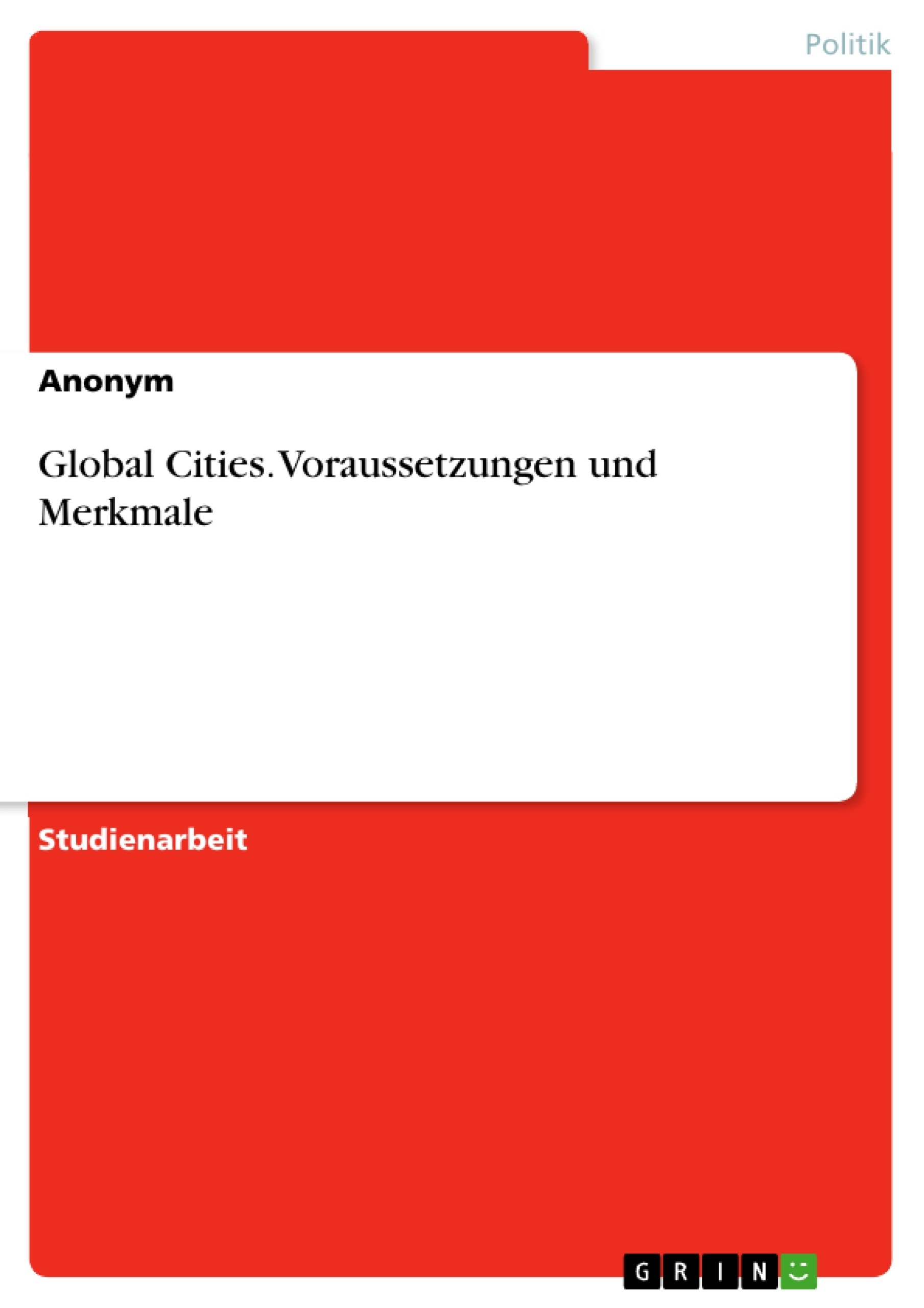Aufgrund der immer weiter voranschreitenden Globalisierung der Weltwirtschaft hat der Begriff der Globalisierung in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, werden immer mehr Unternehmen weltweit tätig oder schließen sich zu Konzernen zusammen. Die Produktion wird ausgelagert in Länder, in denen es sich am kostengünstigsten produzieren lässt. Immer mehr Unternehmen siedeln sich in anderen Ländern beziehungsweise grenzübergreifend an, um dem hohen Wettbewerbsdruck stand zu halten. Für dieses Phänomen werden sog. Knotenpunkte benötigt, in denen sich das Management sammelt und von denen aus die globale Tätigkeit gesteuert wird.
Diese Knotenpunkte stellen die sog. Global Cities dar. Ein neuer Stadttyp, der aufgrund der Globalisierung entstanden ist. In ihnen scheint sich alles zu sammeln wie z.B. die großen Finanzzentren, die großen Börsen etc. Vor allem für den Begriff der Globalisierung scheint es keine allgemein gültige Definition zu geben. Für den Begriff der Global Cities gibt es auch eine Fülle an Definitionen, die allerdings alle eines gemeinsam haben, Global Cities sind von großer Bedeutung als Knotenpunkte für den weltweiten Handel.
In dieser Arbeit wird zunächst auf den Begriff der Globalisierung eingegangen, der für Global Cities von großer Bedeutung ist. Anschließend wird auf den Begriff der Global Player eingegangen. Schließlich wird sich mit Global Cities beschäftigt, sowohl dem Begriff, als auch die Voraussetzung, die Merkmale, die Forschungsgeschichte, den Global Cities der Gegenwart und abschließend mit der Kritik. Anschließend wird der Begriff Global Cities von dem der Megastadt abgegrenzt. Zudem wird ein kurzer Einblick in Global Cities der Dritten Welt gewährt, bevor das Fazit den Abschluss dieser Arbeit bildet.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Globalisierung
- Global Players
- Global Cities
- Voraussetzung
- Merkmale
- Zur Forschungsgeschichte
- Global Cities der Gegenwart
- Kritik
- Global Cities in der Dritten Welt
- Abgrenzung zur Megastadt
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit befasst sich mit dem Begriff der Global Cities und untersucht deren Entstehung und Bedeutung im Kontext der Globalisierung. Sie beleuchtet die Merkmale und Voraussetzungen für die Entwicklung von Global Cities, sowie deren Rolle als Knotenpunkte für den weltweiten Handel.
- Die Bedeutung von Global Cities im Kontext der Globalisierung
- Die Merkmale und Voraussetzungen für die Entwicklung von Global Cities
- Die Rolle von Global Cities als Knotenpunkte für den weltweiten Handel
- Die Abgrenzung von Global Cities zu Megastädten
- Die Bedeutung von Global Cities in der Dritten Welt
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Global Cities ein und erläutert die Relevanz des Begriffs im Kontext der Globalisierung. Sie gibt einen Überblick über die behandelten Themen und die Struktur der Arbeit.
- Globalisierung: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Begriff der Globalisierung, die als ein bedeutender Treiber der Entstehung von Global Cities angesehen wird. Es werden verschiedene Aspekte der Globalisierung beleuchtet, darunter die Verflechtung von Volkswirtschaften, der grenzüberschreitende Handel und die Bewegung von Kapital und Arbeitskräften.
- Global Players: Das Kapitel „Global Players“ befasst sich mit den Akteuren, die die Globalisierung vorantreiben. Es werden Unternehmen, Organisationen und Institutionen beleuchtet, die durch ihre grenzüberschreitende Tätigkeit und ihre globale Vernetzung die Entwicklung von Global Cities beeinflussen.
- Global Cities: Dieses Kapitel widmet sich dem Begriff der Global Cities und analysiert die Merkmale und Voraussetzungen für deren Entstehung. Es befasst sich mit der Forschungsgeschichte des Themas, betrachtet die Global Cities der Gegenwart und analysiert kritisch die Auswirkungen dieser Entwicklungen.
- Global Cities in der Dritten Welt: Das Kapitel befasst sich mit der Bedeutung von Global Cities in der Dritten Welt. Es untersucht die Herausforderungen und Chancen, die sich aus der Entstehung von Global Cities in Entwicklungsländern ergeben.
- Abgrenzung zur Megastadt: Dieses Kapitel grenzt den Begriff der Global Cities von dem der Megastadt ab. Es werden die Unterschiede zwischen diesen beiden Stadttypen im Hinblick auf ihre Merkmale, ihre Funktionen und ihre Rolle in der Globalisierung herausgearbeitet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Global Cities, Globalisierung, Global Players, Megastädte, Weltwirtschaft, Handel, Finanzzentren, Knotenpunkte, Entwicklung, Dritte Welt, Forschungsgeschichte, Kritik.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Begriff "Global Cities"?
Global Cities sind ein neuer Stadttyp, der als Knotenpunkt für den weltweiten Handel, Finanzzentren und Börsen fungiert und die globale Wirtschaftstätigkeit steuert.
Welche Rolle spielt die Globalisierung bei der Entstehung von Global Cities?
Die Globalisierung treibt die Verflechtung von Volkswirtschaften voran, was zentrale Orte (Knotenpunkte) für das Management globaler Konzerne und Handelsströme notwendig macht.
Was unterscheidet eine Global City von einer Megastadt?
Während Megastädte primär über ihre enorme Einwohnerzahl definiert werden, zeichnen sich Global Cities durch ihre funktionale Bedeutung und Vernetzung im weltweiten Wirtschaftssystem aus.
Wer sind die sogenannten "Global Players"?
Global Players sind Unternehmen, Organisationen und Institutionen, die weltweit tätig sind und durch ihre grenzüberschreitende Vernetzung die Entwicklung von Global Cities maßgeblich beeinflussen.
Gibt es Global Cities auch in der Dritten Welt?
Ja, die Arbeit untersucht auch die Entstehung und Bedeutung von Global Cities in Entwicklungsländern sowie die damit verbundenen spezifischen Herausforderungen und Chancen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2015, Global Cities. Voraussetzungen und Merkmale, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/315104