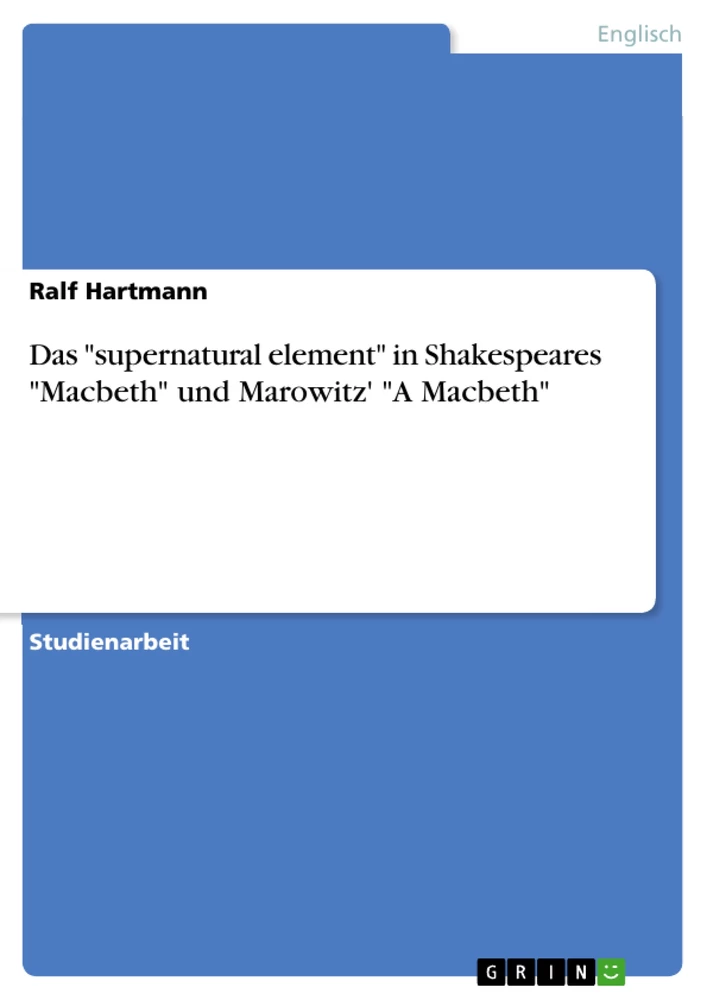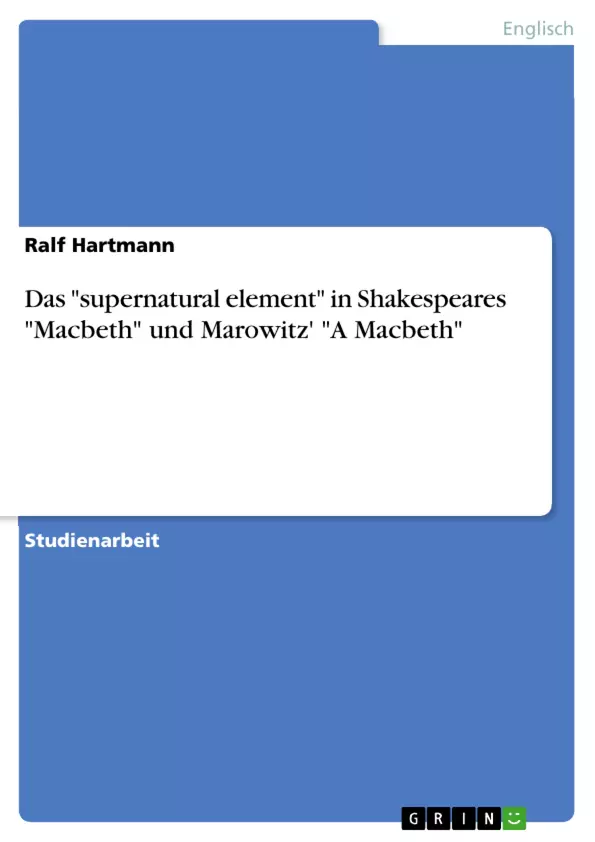Die vorliegende Arbeit will versuchen, die jeweilige Gestaltung des supernatural element in den beiden Macbeth-Dramen von William Shakespeare und Charles Marowitz zu vergleichen. Anders als manche Regisseure des Macbeth, die die Hexenszenen als überflüssig erachteten und deshalb kurzerhand strichen, hat Marowitz sie durchaus beibehalten, wenngleich er Veränderungen vornahm. Zudem wird deutlich werden, dass Marowitz in seiner modernen Version nicht die Erkenntnisse unserer Zeit berücksichtigt, sondern dass er in seiner Darstellung des Übernatürlichen auf sehr archaische Vorstellungen zurückgreift, die sich unter anderem auch in Shakespeares wichtigster Quelle für Macbeth, Raphael Holinsheds Chronicles of England, Scotland, and Ireland aus dem Jahr 1577, finden.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- I. Einführung
- II. Shakespeares Macbeth
- 1. Hexen bei Holinshed und zu Shakespeares Zeit
- 1.1. Holinshed
- 1.2. Hexenwahn unter Elisabeth I. und James I.
- 2. Die Hexen - Witches or Weird Sisters?
- 2.1. Walter Clyde Curry (1933).
- 2.2. Peter Stallybrass (1982).
- 2.3. Henry N. Paul (1978).
- 3. Gestaltung des supernatural element im Stück
- 3.1. Interpolierte Szenen - Thomas Middleton
- 3.2. Geschickte Anwendung durch Shakespeare
- III. Charles Marowitz: A Macbeth
- 1. Collage und 'debunking'
- 1.1. Verschränkung von Handlungssträngen
- 1.2. Verstärkte Bedeutung der Hexen und Lady Macbeths
- 2. Umbewertung des supernatural element durch Marowitz
- 2.1. Holinshed
- 2.2. Bedeutung des Voodoozaubers - 'Effigies'
- 2.3. Sieg des Bösen über die göttliche Ordnung
- IV. Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit vergleicht die Gestaltung des supernatural element in Shakespeares Macbeth und Marowitz' Adaption A Macbeth. Sie analysiert die Verwendung des Übernatürlichen in beiden Werken und setzt sie in den Kontext der Zeit Shakespeares und Marowitz' sowie ihrer jeweiligen Quellen.
- Die Rolle des Übernatürlichen in Shakespeares Macbeth
- Der Einfluss der Zeit Shakespeares auf die Darstellung des Übernatürlichen
- Die Adaption des supernatural element durch Marowitz
- Die Bedeutung von Quellen wie Holinshed und Voodoozauber in Marowitz' A Macbeth
- Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Gestaltung des Übernatürlichen in beiden Werken
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung (Kapitel I) stellt den Kontext des Übernatürlichen in Shakespeares Zeit dar und erklärt die Relevanz dieses Themas im Werk des Dramatikers. Kapitel II untersucht die Darstellung des Übernatürlichen in Shakespeares Macbeth, einschließlich der historischen und literarischen Quellen, insbesondere Holinsheds Chronicles, und der verschiedenen Interpretationen des supernatural element durch Kritiker. Kapitel III analysiert Marowitz' Adaption A Macbeth, die eine collageartige Struktur aufweist und die Bedeutung des Übernatürlichen neu interpretiert.
Schlüsselwörter (Keywords)
Shakespeare, Macbeth, supernatural, Übernatürliches, Hexen, Voodoozauber, Holinshed, Marowitz, A Macbeth, Adaptation, Collage, Debunking, Zeitgeschichte, Quellenkritik, Interpretation
Häufig gestellte Fragen
Was ist das „supernatural element“ in Shakespeares Macbeth?
Es bezeichnet die übernatürlichen Aspekte des Stücks, insbesondere die Hexen und deren Prophezeiungen, die das Schicksal der Protagonisten beeinflussen und die Atmosphäre des Grauens schaffen.
Wie unterscheidet sich Marowitz' Adaption „A Macbeth“ vom Original?
Charles Marowitz nutzt eine collageartige Struktur und Techniken des „debunking“. Er verstärkt die Bedeutung der Hexen und greift auf archaische Vorstellungen wie Voodoozauber zurück, um das Böse modern zu interpretieren.
Welche Rolle spielen die Hexen bei Shakespeare?
Die Hexen werden oft als „Weird Sisters“ (Schicksalsschwestern) interpretiert. Ihr Erscheinen reflektiert den Hexenwahn unter den Herrschern Elisabeth I. und James I. sowie literarische Quellen wie Holinsheds Chronicles.
Warum nutzt Marowitz Voodoozauber in seinem Stück?
Marowitz verwendet Elemente wie „Effigies“ (Puppenzauber), um das Übernatürliche als eine unaufhaltsame, bösartige Macht darzustellen, die über die göttliche Ordnung siegt.
Wer war Raphael Holinshed?
Raphael Holinshed verfasste die „Chronicles of England, Scotland, and Ireland“, die Shakespeare als wichtigste historische Quelle für Macbeth dienten.
- Quote paper
- Ralf Hartmann (Author), 1997, Das "supernatural element" in Shakespeares "Macbeth" und Marowitz' "A Macbeth", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/315112