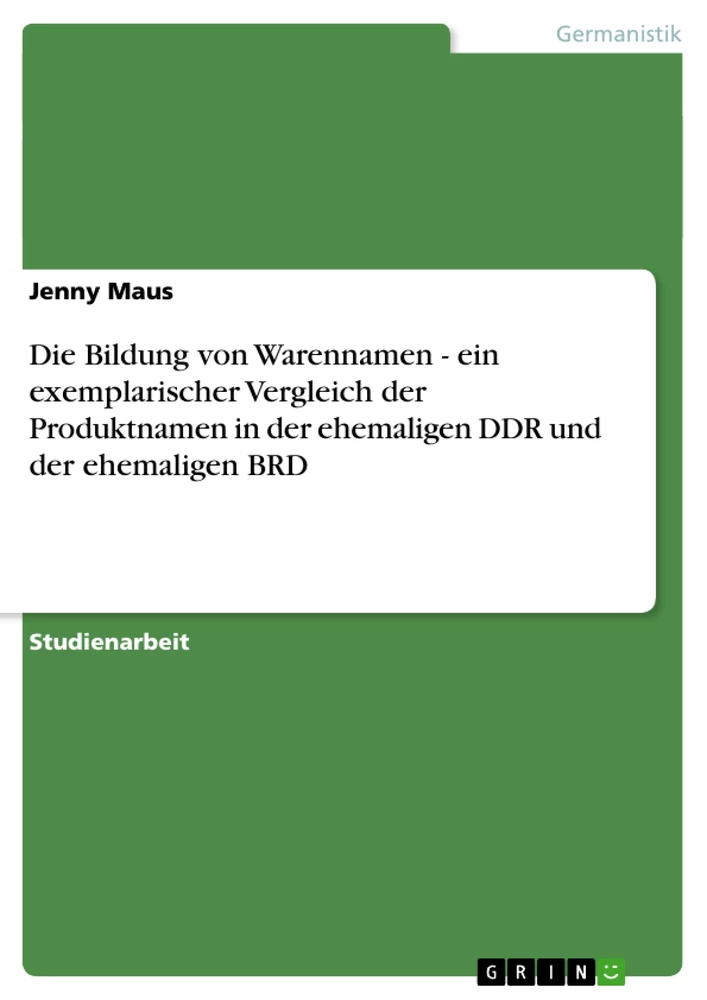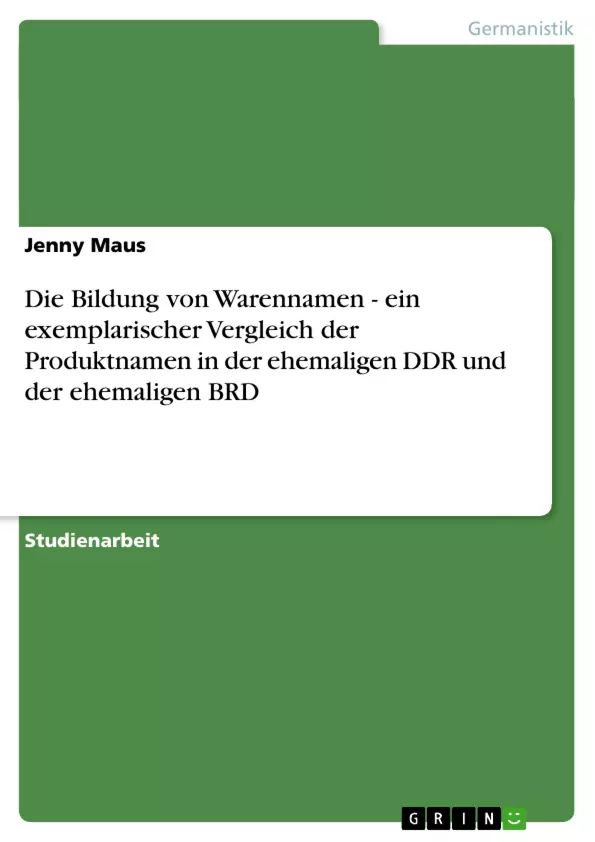Warennamen wirken auf den ersten Blick vollkommen unmotiviert und arbiträr gebildet, doch ihre Bildung folgt einer bestimmten Systematik. Schon allein aus marketingtechnischen Gründen ist dies notwendig.
In dieser Arbeit möchte ich zum einen die Systematik zur Bildung von Produktnamen darstellen und zum anderen diese auch an Beispielen aus der ehemaligen DDR und der ehemaligen BRD belegen. Letztlich läuft dieser Weg auf einen Vergleich der Struktur der Produktnamenbildung beider Staaten hinaus.
Im Laufe meiner Recherchen zu dieser Arbeit haben sich zwei Probleme ergeben. Zum einen hat Andreas Lötscher mit seinem Buch „Von Ajax bis Xerox. Ein Lexikon der Produktnamen“ (auf das ich mich im Bereich der BRD- Produkte fast immer beziehen werde) zwar ein sehr gutes Lexikon der Westprodukte geschrieben, es gibt aber nichts vergleichbares für Ostprodukte. Da es viele DDR- Produkte nicht mehr im Handel gibt, war es mit einigen Schwierigkeiten verbunden die Namen zusammenzutragen. Es gibt im Internet einige Ostalgie- Seiten und auch das „Kleine Lexikon großer Ostprodukte“ schwimmt mit auf dieser Modewelle, aber beide Quellen sind nicht als wissenschaftlich fundiert zu betrachten. Ich habe mich letztlich auf meine Erinnerungen und die meiner Eltern gestützt, sowie das Warensortiment, welches wieder im Handel erhältlich ist, beachtet. Das nächste Problem war, dass sich meines Wissens nach bisher niemand ausführlich mit den Warennamen der DDR unter onomastischen Gesichtspunkten beschäftigt hat. Ich konnte also die Theorie direkt in die Praxis umsetzen und habe viele der Produktnamen mit der im folgenden dargestellten Systematik beleuchtet.
Um diese Arbeit nicht ausufern zu lassen habe ich die Produktbereiche eingegrenzt und beschäftige mich hauptsächlich mit Lebensmitteln, Medikamenten, Automobilbezeichnungen, Kosmetik, Hygieneartikeln und Reinigungsmitteln.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Inhalt
- 2. Einleitung
- 3. Hauptteil
- 3.1. Formale Kategorisierung
- 3.2. Die Mosaikmethode und Komposita
- 3.3. Suffixe
- 3.4. Assoziationen und Prestigewörter
- 3.5. Personennamen und geographische Namen
- 3.6. Kurz- und Kunstwörter
- 4. Schlussbemerkungen
- 5. Literaturangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Systematik der Bildung von Produktnamen in der ehemaligen DDR und der ehemaligen BRD. Ziel ist es, die Methoden der Namensgebung in beiden Staaten zu vergleichen und daraus Rückschlüsse auf gesellschaftliche Unterschiede zu ziehen. Die Analyse konzentriert sich auf die formalen Aspekte der Namensgebung und deren Bezug zur gesellschaftlichen Realität.
- Formale Kategorisierung von Produktnamen
- Vergleich der Namensgebungsmethoden in der DDR und der BRD
- Die Rolle von Suffixen und Präfixen in der Namensbildung
- Der Einfluss von Assoziationen und Prestigewörtern
- Die Verwendung von Personennamen und geographischen Namen in Warenbezeichnungen
Zusammenfassung der Kapitel
2. Einleitung: Die Einleitung erläutert die scheinbar willkürliche, aber tatsächlich systematische Bildung von Warennamen, insbesondere aus marketingtechnischen Gründen. Die Arbeit beabsichtigt, diese Systematik darzustellen und anhand von Beispielen aus der DDR und der BRD zu belegen, resultierend in einem Vergleich der Strukturen der Produktnamenbildung beider Staaten. Die Autorin beschreibt die Herausforderungen ihrer Recherche, die durch das Fehlen vergleichbarer Quellen für Ostprodukte erschwert wurde, und erläutert ihre Herangehensweise, die auf persönlichen Erinnerungen und verfügbaren Produkten basiert.
3. Hauptteil: Der Hauptteil beginnt mit der Diskussion verschiedener Gliederungsmöglichkeiten für die Analyse von Produktnamen, wobei die Ansätze von Koß und Lötscher verglichen und kombiniert werden. Es wird eine Methode vorgestellt, die formale Analyse mit gesellschaftlichen Aspekten verbindet, indem Warennamen als Indikatoren gesellschaftlicher Entwicklungen betrachtet werden. Die Autorin integriert die wichtigsten Punkte aus beiden Ansätzen, um eine umfassende Analyse zu gewährleisten, und kündigt die weiteren Kapitel an, die sich jeweils mit spezifischen Aspekten der Namensgebung befassen. Es folgt eine Eingrenzung des Themenbereichs auf Lebensmittel, Medikamente, Automobile, Kosmetik, Hygieneartikel und Reinigungsmittel.
3.1. Formale Kategorisierung: Dieses Kapitel beschreibt die Schwierigkeiten bei der Strukturierung der Arbeit und die Notwendigkeit, formale Analyse mit einem Vergleich zu verbinden. Es werden die Klassifizierungssysteme von Koß (Übernahmen, Konzeptformen, Kunstwörter) und Lötscher (Mosaikmethode, Endungen, Fremdsprachen, Assoziationen, Prestigewörter, Personennamen, Klang und Sinn, Gags) vorgestellt und miteinander verglichen. Die Autorin entscheidet sich für eine Kombination beider Systeme, um eine umfassende Analyse zu ermöglichen und optimiert die Gliederung für die spätere Vergleichsanalyse.
3.2. Die Mosaikmethode und Komposita: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Mosaikmethode, eine häufig verwendete Technik zur Bildung von Warennamen, bei der Bestandteile von Wörtern neu kombiniert werden. Es werden zahlreiche Beispiele aus der BRD (z.B. Baypen, Butaphen, Contradol) und der DDR (z.B. Acesal, Analgin) analysiert, um die Anwendung dieser Methode zu veranschaulichen und Unterschiede zwischen den beiden Staaten aufzuzeigen. Die Beispiele illustrieren, wie durch die Zerlegung und Neukombination von Wörtern neue Bezeichnungen entstehen, die oft nur für Eingeweihte in ihrer Bedeutung ersichtlich sind. Der Vergleich verdeutlicht kulturelle und sprachliche Einflüsse auf die Produktbezeichnungen.
Schlüsselwörter
Produktnamen, Warennamen, Onomastik, DDR, BRD, Vergleichende Analyse, Mosaikmethode, Komposita, Suffixe, Assoziationen, Prestigewörter, Marketing, Gesellschaftliche Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Produktnamenbildung in der DDR und BRD
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Systematik der Bildung von Produktnamen in der ehemaligen DDR und der ehemaligen BRD. Ziel ist der Vergleich der Namensgebungsmethoden beider Staaten und die Ableitung von Rückschlüssen auf gesellschaftliche Unterschiede. Der Fokus liegt auf den formalen Aspekten der Namensgebung und deren Bezug zur gesellschaftlichen Realität.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die formale Kategorisierung von Produktnamen, einen Vergleich der Namensgebungsmethoden in der DDR und BRD, die Rolle von Suffixen und Präfixen, den Einfluss von Assoziationen und Prestigewörtern, sowie die Verwendung von Personennamen und geographischen Namen in Warenbezeichnungen. Die Analyse konzentriert sich auf Produktkategorien wie Lebensmittel, Medikamente, Automobile, Kosmetik, Hygieneartikel und Reinigungsmittel.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit kombiniert und vergleicht die Klassifizierungssysteme von Koß und Lötscher zur Analyse von Produktnamen. Sie verbindet formale Analyse mit gesellschaftlichen Aspekten, indem Warennamen als Indikatoren gesellschaftlicher Entwicklungen betrachtet werden. Eine zentrale Methode ist die Untersuchung der Mosaikmethode und der Verwendung von Komposita in der Namensgebung.
Welche Herausforderungen gab es bei der Recherche?
Die Autorin beschreibt Herausforderungen bei der Recherche aufgrund des Mangels an vergleichbaren Quellen für Ostprodukte. Die Analyse basiert daher teilweise auf persönlichen Erinnerungen und verfügbaren Produkten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil (mit Unterkapiteln zur formalen Kategorisierung, der Mosaikmethode und Komposita, Suffixen, Assoziationen und Prestigewörtern, Personennamen und geographischen Namen sowie Kurz- und Kunstwörtern), und Schlussbemerkungen sowie Literaturangaben. Der Hauptteil analysiert verschiedene Aspekte der Produktnamenbildung und vergleicht die Ergebnisse für die DDR und die BRD.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Produktnamen, Warennamen, Onomastik, DDR, BRD, Vergleichende Analyse, Mosaikmethode, Komposita, Suffixe, Assoziationen, Prestigewörter, Marketing, Gesellschaftliche Entwicklung.
Wie werden die Ergebnisse präsentiert?
Die Ergebnisse werden durch die detaillierte Analyse von Beispielen aus der DDR und der BRD präsentiert und veranschaulichen die Unterschiede in der Produktnamenbildung beider Staaten. Der Vergleich der Methoden verdeutlicht kulturelle und sprachliche Einflüsse.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
(Diese Frage kann nur beantwortet werden, wenn der vollständige Text der Schlussfolgerungen verfügbar ist. Die Zusammenfassung beinhaltet nur eine Einleitung der Schlussfolgerungen.)
- Citation du texte
- Jenny Maus (Auteur), 2003, Die Bildung von Warennamen - ein exemplarischer Vergleich der Produktnamen in der ehemaligen DDR und der ehemaligen BRD, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31513