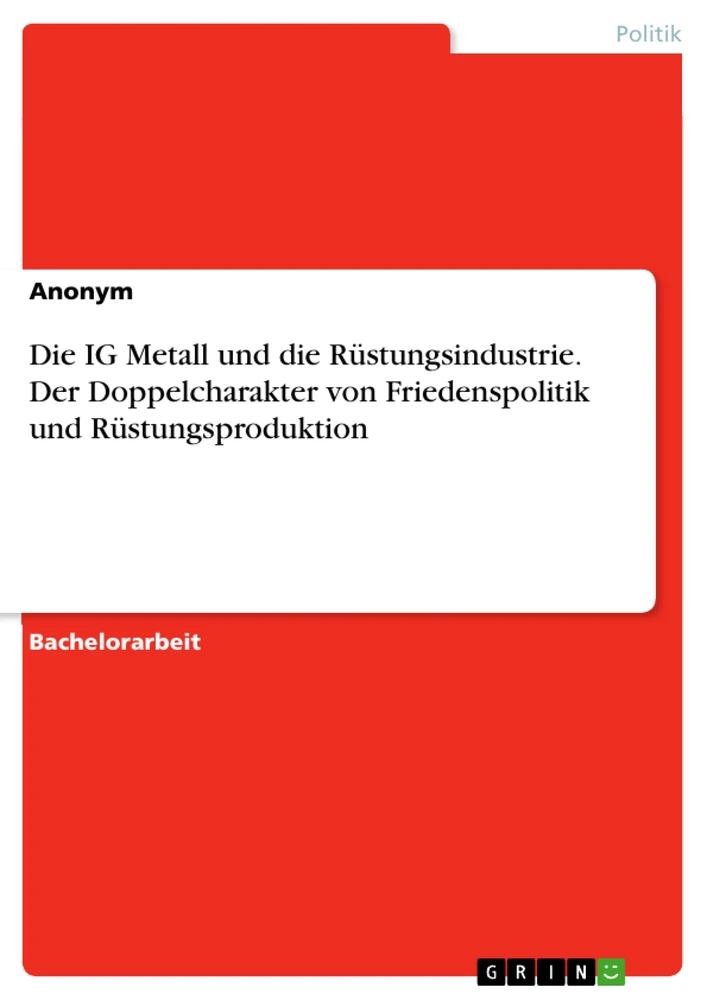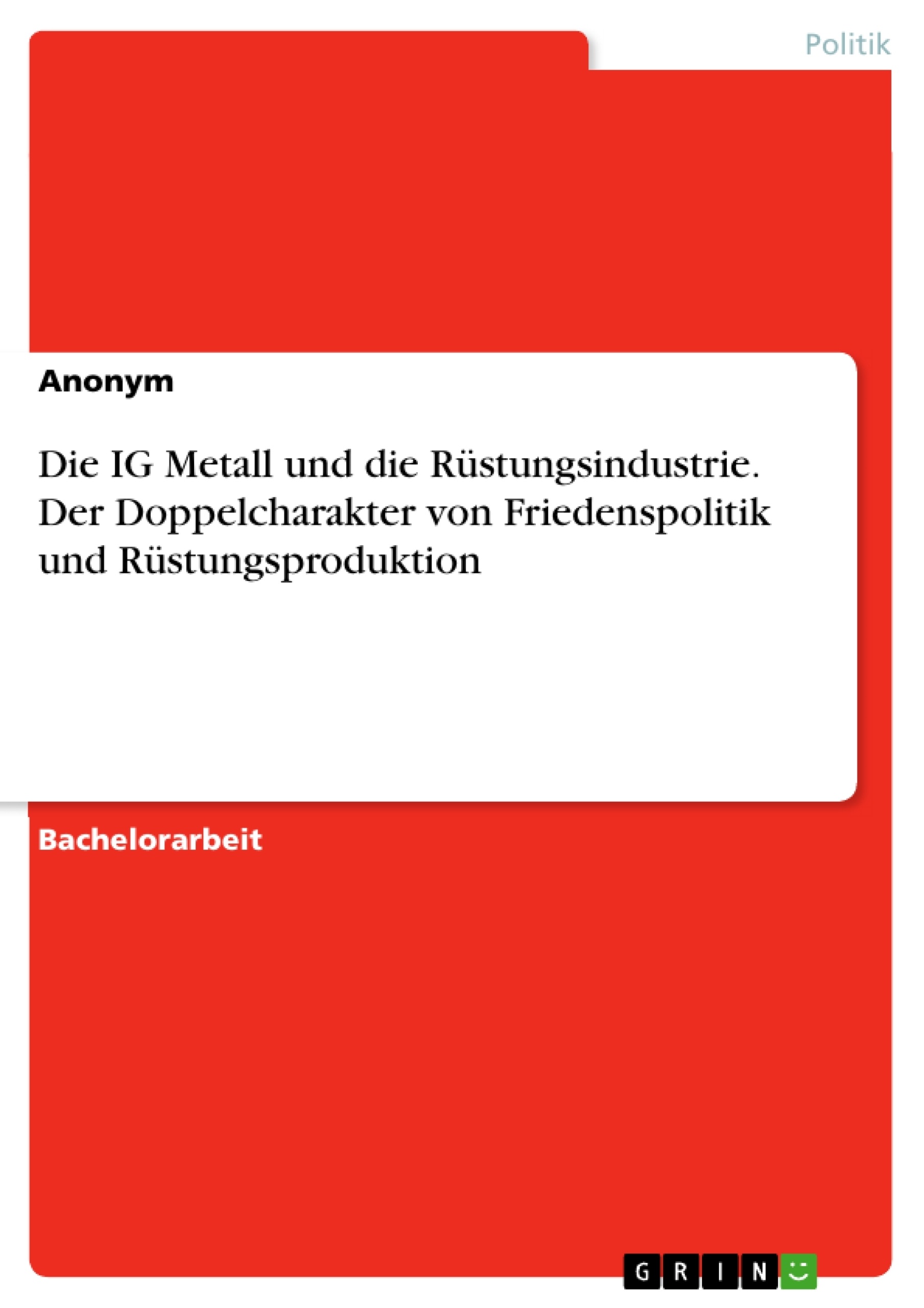Beschäftigte der Rüstungsindustrie werden überwiegend von der IG Metall (IGM) organisiert. Die Satzung der Gewerkschaft schreibt den Einsatz „[...] für Frieden, Abrüstung und Völkerverständigung [...]“ vor. Ihr Dachverband – der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) – fordert ebenfalls das Eintreten „[...] für eine allgemeine und weltweite kontrollierte Abrüstung, für die Verwirklichung und Erhaltung des Friedens und der Freiheit im Geiste der Völkerverständigung [...]“.
Innerhalb der IGM befasst sich insbesondere der Betriebsräte-Arbeitskreis „Wehrtechnik und Arbeitsplätze“ mit der Doppelrolle, die Gewerkschaften in der Rüstungsproduktion einnehmen: Zum einen die Verpflichtung auf Frieden und Abrüstung und zum anderen die Verpflichtung zur Interessenvertretung der Beschäftigten der Branche, deren Arbeitsplatzsicherheit in erster Linie von der Nachfrage abhängt. Eine vermeintliche Lösung dieses Zielkonflikts bilden Rüstungskonversionen, also die Umstellung industrieller Rüstungsproduktion auf zivile Fertigung, deren Umsetzung auf Grundlage der Eigentumsverhältnisse schwierig bis unmöglich ist. Trotzdem wurde das Projekt Rüstungskonversion vor allem zwischen 1970 und 2000 durch verschiedene Initiativen von Be¬triebs¬rät_innen und Vertrauensleuten der IGM vorangetrieben und durch Forschungen begleitet.
Spätestens seit den 2000er Jahren verschwanden derartige Projekte allerdings und die Rüstungsproduktion scheint seitdem kaum noch grundsätzliche Kritik durch die IGM-Führung zu erfahren. Im Gegenteil häufen sich Aussagen von IGM-Funktionär_innen, die zur Rüstungsproduktion und Rüstungsexportförderung aufrufen, um so die Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie zu bewahren. In Verbindung mit Aufrufen des DGB zu mehr Kooperation zwischen Militär und Gewerkschaften stellt sich die Frage, inwieweit die friedenspolitischen Forderungen der IGM noch Aktualität besitzen. Die vorliegende Arbeit untersucht deshalb den Umgang der IGM mit dem vermeintlichen Zielkonflikt zwischen Abrüstung und Frieden einerseits und der Vertretung der Interessen der abhängig Beschäftigten in der Branche andererseits.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Stand der Forschung
- Methodik
- Der Doppelcharakter von Gewerkschaften
- Ordnungsfaktor
- Gegenmacht
- Rüstungsproduktion in der BRD
- Entwicklung der Rüstungsproduktion seit 1945
- 1945 bis 1980er Jahre
- 1980er Jahre bis 2013
- Die bundesdeutsche Rüstungsbranche
- EADS
- Rheinmetall
- ThyssenKrupp
- KMW
- Diehl Stiftung
- Rechtliche Bedingungen für Produktion und Absatz
- Friedenspolitik in der IGM und dem DGB
- Wiederaufrüstung
- Paulskirchenbewegung und Kampf dem Atom-Tod
- Notstandsgesetze
- NATO-Doppelbeschluss
- Konversionsstrategien in der Rüstungsproduktion
- Idee der betrieblichen Konversion
- Praxis der Arbeitskreise „Alternative Fertigung“
- Messerschmitt-Bölkow-Blohm
- Blohm & Voss
- Bremer Konversionsprogramm
- Gründe für das Scheitern der Konversionsprojekte
- Jüngste Positionierung der IGM zur Rüstungsproduktion
- Kasseler und Ottobrunner Erklärung
- Funktionär_innen in den Rüstungsbetrieben
- Perspektiven des militärischen Schiffbaus
- Positionspapier zur wehr- und sicherheitstechnischen Industrie
- Workshop von DGB und Bundeswehr
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Positionierung der IG Metall (IGM) gegenüber der Rüstungsproduktion im Spannungsfeld zwischen Friedenspolitik und der Interessenvertretung der Beschäftigten in der Rüstungsindustrie. Sie analysiert den Umgang der Gewerkschaft mit dem vermeintlichen Zielkonflikt zwischen Abrüstung und Frieden einerseits und der Vertretung der Interessen der abhängig Beschäftigten in der Branche andererseits.
- Doppelcharakter von Gewerkschaften: Ordnungsfaktor und Gegenmacht
- Entwicklung und aktuelle Situation der Rüstungsproduktion in der BRD
- Friedenspolitik in der IGM und dem DGB: Historische Entwicklungen und aktuelle Positionen
- Konversionsstrategien in der Rüstungsproduktion: Konzepte, Praxis und Gründe für das Scheitern
- Jüngste Positionierung der IGM zur Rüstungsproduktion: Wandel der Haltung, Rolle der Funktionär_innen und Perspektiven
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext des Themas und die Forschungsfrage darlegt. Anschließend wird der Doppelcharakter von Gewerkschaften analysiert, wobei ihre ordnungspolitischen Aufgaben im Spannungsfeld mit ihrer Rolle als Gegenmacht betrachtet werden. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Entwicklung und der aktuellen Situation der Rüstungsproduktion in der Bundesrepublik Deutschland, inklusive einer Analyse der wichtigsten Akteure in der Rüstungsbranche.
Kapitel 4 beleuchtet die Friedenspolitik der IG Metall und des DGB im Kontext von Rüstung und Abrüstung, einschließlich historischer Entwicklungen wie der Wiederaufrüstung, der Paulskirchenbewegung und des NATO-Doppelbeschlusses. Kapitel 5 untersucht die Konversionsstrategien in der Rüstungsproduktion, von der Idee der betrieblichen Konversion über die Praxis der Arbeitskreise „Alternative Fertigung“ bis hin zu den Gründen für das Scheitern dieser Projekte. Abschließend wird in Kapitel 6 die jüngste Positionierung der IG Metall zur Rüstungsproduktion analysiert, inklusive der Entwicklung der Haltung der Gewerkschaft, der Rolle von Funktionär_innen und der Perspektiven für die Zukunft.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Rüstungsproduktion, Gewerkschaftspolitik, IG Metall, Friedenspolitik, Abrüstung, Konversion, Beschäftigung, Arbeitsplätze, Interessenvertretung, Zielkonflikt und Rüstungsexport.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2014, Die IG Metall und die Rüstungsindustrie. Der Doppelcharakter von Friedenspolitik und Rüstungsproduktion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/315169