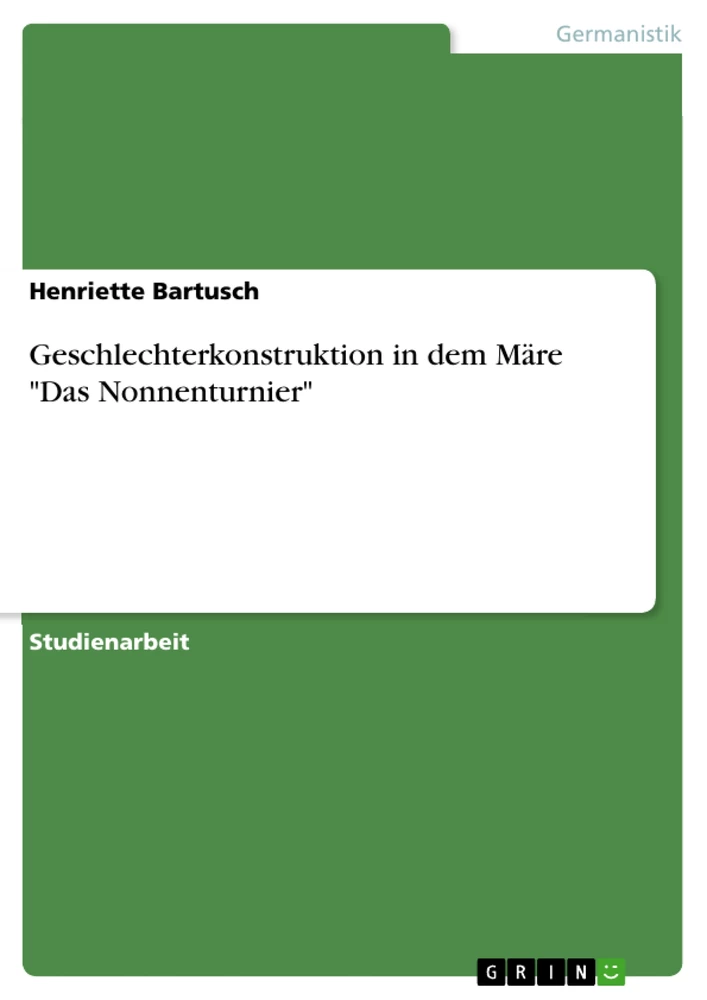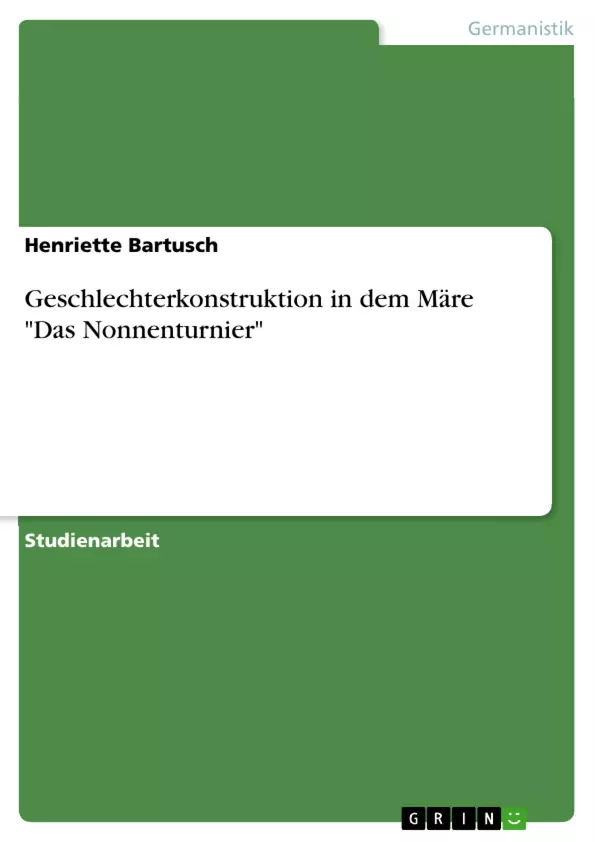Ziel dieser Arbeit ist es, die Frage zu beantworten, welche Geschlechteridentitäten das Märe „Das Nonnenturnier“ produziert und wie diese wirken. Um diese Zielstellung zu erfüllen, ist die Arbeit folgendermaßen gegliedert. Zunächst sollen die Begriffe Märe und Priapeiisches Märe geklärt werden, um eine genauere Einordnung des Märes „Das Nonnenturnier“ innerhalb der mittelalterlichen Literatur zu gewährleisten.
Im darauffolgenden Kapitel dienen die Erkenntnisse über das Ein- und Zwei-Geschlecht-Modell Thomas Laqueurs als theoretische Grundlage, um diese im weiteren Verlauf der Arbeit auf den Text anwenden zu können. Das nächste Kapitel analysiert und interpretiert die konstruierten Geschlechterdefinitionen im Nonnenturnier unter Nutzung der Modelle Laqueurs, um die eingangs gestellte Frage zu beantworten. Abschließend fasst eine Schlussbetrachtung die wichtigsten Aspekte der Arbeit zusammen und dient zugleich der Rückführung zum Thema.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Definitionen
- 2.1 Das Märe
- 2.2 Das priapeiische Märe
- 3. Geschlechtsmodelle nach Laqueur
- 3.1 Das Ein-Geschlecht-Modell
- 3.2 Das Zwei-Geschlecht-Modell
- 4. Geschlechtsmodelle im Nonnenturnier
- 4.1 Analyse und Interpretation nach dem Ein-Geschlecht-Modell
- 4.2 Analyse und Interpretation nach dem Zwei-Geschlecht-Modell
- 5. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, welche Geschlechtsidentitäten das Märe Das Nonnenturnier produziert und wie diese wirken. Um diese Zielstellung zu erfüllen, wird das Märe im Kontext mittelalterlicher Literatur, insbesondere im Rahmen des priapeiischen Märes, betrachtet. Die Arbeit analysiert und interpretiert das Nonnenturnier anhand der von Thomas Laqueur entwickelten Geschlechtermodelle, das Ein- und Zwei-Geschlecht-Modell.
- Die Rolle von Geschlecht in althochdeutscher Literatur
- Die Konstruktion von Geschlechtsidentitäten im Nonnenturnier
- Die Anwendung von Geschlechtermodellen auf das Nonnenturnier
- Die Bedeutung des priapeiischen Märes in der mittelalterlichen Literatur
- Die Diskussion von Geschlechterdefinitionen in höfischer Literatur
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in die Thematik der Geschlechterkonstruktion in mittelalterlicher Literatur ein und stellt die Forschungsfrage nach den Geschlechtsidentitäten im Nonnenturnier. Sie verweist auf die Bedeutung von Gender-Diskussionen in mittelalterlichen Texten und die Relevanz des Nonnenturniers für die Untersuchung dieser Thematik. Das zweite Kapitel klärt die Begriffe Märe und priapeisches Märe, um das Nonnenturnier in die mittelalterliche Literaturtradition einzuordnen.
Im dritten Kapitel werden die Geschlechtermodelle von Thomas Laqueur, das Ein- und Zwei-Geschlecht-Modell, vorgestellt. Diese dienen als theoretische Grundlage für die Analyse und Interpretation des Nonnenturniers. Das vierte Kapitel analysiert und interpretiert das Nonnenturnier unter Anwendung der Laqueur'schen Modelle. Dabei werden die im Text konstruierten Geschlechterdefinitionen untersucht und die Auswirkungen dieser Definitionen beleuchtet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Geschlechterkonstruktion, Märe, priapeiisches Märe, Geschlechtermodelle, Ein-Geschlecht-Modell, Zwei-Geschlecht-Modell, Das Nonnenturnier, mittelalterliche Literatur, Gender-Diskussionen, höfische Literatur und Kultur. Sie untersucht, wie Geschlechteridentitäten in dem Nonnenturnier dargestellt werden und welche Auswirkungen diese Darstellungen haben.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein „Märe“?
Ein Märe ist eine mittelhochdeutsche Verserzählung mit weltlichem, oft schwankhaftem oder belehrendem Inhalt.
Was charakterisiert ein „priapeiisches Märe“?
Diese Unterform des Märes zeichnet sich durch explizit sexuelle oder obszöne Thematiken aus, zu denen auch „Das Nonnenturnier“ zählt.
Welche Geschlechtermodelle werden in der Arbeit angewendet?
Die Analyse basiert auf den Modellen von Thomas Laqueur: dem Ein-Geschlecht-Modell (Antike/Mittelalter) und dem Zwei-Geschlecht-Modell (Moderne).
Worum geht es in dem Märe „Das Nonnenturnier“?
Die Erzählung thematisiert auf provokante Weise Geschlechteridentitäten und sexuelle Praktiken in einem klösterlichen bzw. höfischen Kontext.
Welches Forschungsziel verfolgt die Hausarbeit?
Ziel ist es zu klären, welche Geschlechteridentitäten der Text produziert und wie diese innerhalb der mittelalterlichen Literatur wirken.
- Arbeit zitieren
- Henriette Bartusch (Autor:in), 2012, Geschlechterkonstruktion in dem Märe "Das Nonnenturnier", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/315226