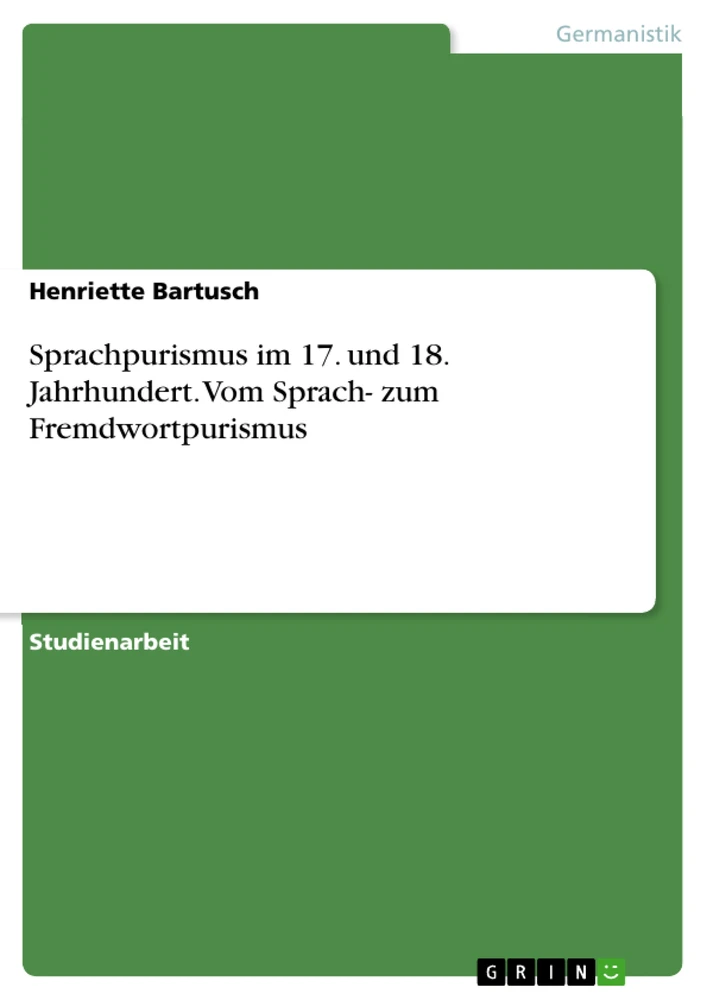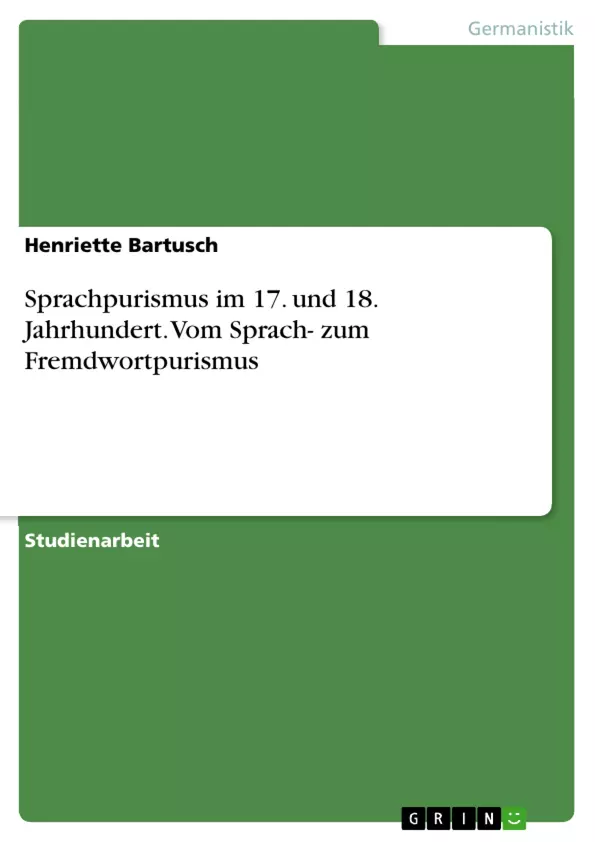Sprachliche Bestrebungen haben bereits zu Beginn des 17. Jahrhunderts vor allem in Hinsicht auf zwei wesentliche Tendenzen stattgefunden. Zum einen stand die Vermeidung sowie Tilgung von Fremdwörtern und zum anderen die Pflege sowie Etablierung der deutschen Sprache im Fokus. Dabei wurde vor allem in Deutschland, aufgrund des großen Einflusses des Lateinischen und Französischen, „dieser Kampf gegen den fremdsprachlichen Einfluss besonders heftig geführt“ (Polenz 1967:80).
Heute sind diese Bemühungen unter den Stichworten ‚Sprachreinigung’, ‚Purismus’, ‚Fremdwortjagd’ o.ä. bekannt. Kirkness subsumiert diese unter der Begrifflichkeit des Fremdwortpurismus und schreibt sie vorwiegend dem 19. und 20. Jahrhundert zu. Dagegen fasst er die puristischen Bestrebungen des 17. und 18. Jhs. unter dem Begriff des Sprachpurismus zusammen. Offensichtlich ging es im 17. und 18. Jh. nicht um eine „pauschale Fremdwortjagd“, welche allerdings für das 19. und 20. Jh. freilich zutrifft. Doch was verbirgt sich nun hinter Sprachpurismus und wie genau haben die puristischen Bestrebungen des 17. und 18. Jhs. ausgesehen, dass diese unter dem weiteren Begriff des Sprachpurismus vereint werden und somit von den folgenden Jahrhunderten abgrenzt.
Ziel dieser Arbeit ist es die Frage zu klären, warum das 17. und 18. Jh. unter dem weiteren Begriff des Sprachpurismus gefasst wird und wie der Weg hin zum Fremdwortpurismus des 19. und 20. Jhs. gekennzeichnet war? Zunächst werden die von Kirkness geprägten Begrifflichkeiten Sprach- und Fremdwortpurismus definiert und voneinander abgegrenzt. Dies soll bereits grob andeuten, warum der Sprachpurismus für das 17. und 18 Jh. charakteristisch war und im Weiteren als theoretische Grundlage dazu dienen, um die Bestrebungen der Puristen einordnen zu können. Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit der Situation im deutschen Sprachgebiet, die im 17. und 18. Jh. Anlass zu puristischen Bemühungen gegeben hat. Das vierte Kapitel beantwortet im Detail die Frage, warum das 17. und 18. Jh. unter dem weiteren Begriff des Sprachpurismus gefasst werden und wie der Weg hin zum Fremdwortpurismus des 19. und 20. Jhs. charakterisiert war. Das vorletzte Kapitel gibt einen Ausblick, wie sich der Übergang zum Fremdwortpurismus des 19. und 20. Jahrhunderts gestaltet hat. Abschließend fasst eine Schlussbetrachtung die wichtigsten Aspekte der Arbeit zusammen und dient zugleich der Rückführung zum Thema.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sprach- vs. Fremdwortpurismus - Eine Begriffsabgrenzung
- Situation im deutschen Sprachgebiet im 17. und 18. Jahrhundert
- Puristische Bestrebungen des 17. und 18. Jahrhunderts
- Die Sprachgesellschaften
- Gottfried Wilhelm Leibniz
- Der Gedanke von einer deutschen Sprachakademie
- Joachim Heinrich Campe
- Der Übergang zum Fremdwortpurismus
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Sprachpurismus im 17. und 18. Jahrhundert in Deutschland und seinen Übergang zum Fremdwortpurismus. Sie klärt die Unterschiede zwischen Sprach- und Fremdwortpurismus und analysiert die Hintergründe und Akteure der puristischen Bestrebungen dieser Epoche.
- Abgrenzung von Sprach- und Fremdwortpurismus
- Sprachliche Situation im 17. und 18. Jahrhundert in Deutschland
- Wichtige Persönlichkeiten und Institutionen des Sprachpurismus
- Der Übergang vom Sprach- zum Fremdwortpurismus
- Analyse der Motive und Ziele der Sprachpuristen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Sprachpurismus im 17. und 18. Jahrhundert ein. Sie stellt die unterschiedlichen Auffassungen von Sprach- und Fremdwortpurismus gegenüber und hebt die Notwendigkeit einer begrifflichen Abgrenzung hervor. Die Einleitung verweist auf die Arbeiten von Peter von Polenz und Alan Kirkness, die unterschiedliche Periodisierungen und Schwerpunkte im Purismus aufweisen. Der Fokus liegt auf der Klärung der Forschungsfrage, warum der Sprachpurismus das 17. und 18. Jahrhundert charakterisiert und wie der Übergang zum Fremdwortpurismus erfolgte.
2. Sprach- vs. Fremdwortpurismus – Eine Begriffsabgrenzung: Dieses Kapitel definiert und differenziert die Begriffe Sprach- und Fremdwortpurismus nach Alan Kirkness. Es wird der umfassende Begriff des Purismus erläutert, der Bestrebungen zur "Reinigung" einer Sprache von fremden Einflüssen umfasst. Der Unterschied zwischen Sprachpurismus (fokussiert auf die innere Reinheit der Sprache) und Fremdwortpurismus (fokussiert auf die Vermeidung von Fremdwörtern) wird herausgearbeitet, um den Kontext der puristischen Bemühungen des 17. und 18. Jahrhunderts zu verstehen.
3. Situation im deutschen Sprachgebiet im 17. und 18. Jahrhundert: Dieses Kapitel beschreibt den sprachlichen Kontext des 17. und 18. Jahrhunderts in Deutschland, der die puristischen Bemühungen hervorbrachte. Es analysiert den Einfluss von Latein und Französisch auf die deutsche Sprache und die daraus resultierenden Herausforderungen für die Sprachpflege und -entwicklung. Der Abschnitt legt die Grundlage für das Verständnis der Motivation hinter den puristischen Bestrebungen und der Notwendigkeit, die deutsche Sprache zu "reinigen" und zu stärken.
4. Puristische Bestrebungen des 17. und 18. Jahrhunderts: Dieses Kapitel stellt verschiedene Akteure und Institutionen des Sprachpurismus im 17. und 18. Jahrhundert vor. Es untersucht die Rolle von Sprachgesellschaften, die Arbeit von Persönlichkeiten wie Gottfried Wilhelm Leibniz und Joachim Heinrich Campe, und den Gedanken an eine deutsche Sprachakademie. Der Abschnitt beleuchtet die verschiedenen Ansätze und Strategien der Sprachpuristen und ihre unterschiedlichen Ziele in Bezug auf die Entwicklung und "Reinigung" der deutschen Sprache. Die verschiedenen Strategien und Ziele werden im Detail analysiert und miteinander verglichen.
5. Der Übergang zum Fremdwortpurismus: Dieses Kapitel bietet einen kurzen Ausblick auf den Übergang vom Sprach- zum Fremdwortpurismus im 19. und 20. Jahrhundert. Es skizziert die Entwicklung und die damit verbundenen Persönlichkeiten, wobei auf die vertiefende Arbeit anderer Forscher verwiesen wird. Das Kapitel dient als Brücke zwischen dem Sprachpurismus des 17. und 18. Jahrhunderts und den späteren Entwicklungen.
Schlüsselwörter
Sprachpurismus, Fremdwortpurismus, Sprachgeschichte, 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, Sprachpflege, Sprachreinigung, Gottfried Wilhelm Leibniz, Joachim Heinrich Campe, Sprachgesellschaften, deutsche Sprache.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Sprachpurismus im 17. und 18. Jahrhundert
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Sprachpurismus im 17. und 18. Jahrhundert in Deutschland und seinen Übergang zum Fremdwortpurismus. Sie analysiert die Hintergründe, Akteure und unterschiedlichen Strategien der puristischen Bestrebungen dieser Epoche.
Welche Begriffe werden abgegrenzt?
Die Arbeit klärt den Unterschied zwischen Sprach- und Fremdwortpurismus. Sprachpurismus konzentriert sich auf die innere Reinheit der Sprache, während Fremdwortpurismus die Vermeidung von Fremdwörtern betont. Die begriffliche Abgrenzung nach Alan Kirkness bildet die Grundlage der Analyse.
Welche sprachliche Situation wird beschrieben?
Die Arbeit beschreibt den sprachlichen Kontext des 17. und 18. Jahrhunderts in Deutschland, einschließlich des Einflusses von Latein und Französisch auf die deutsche Sprache. Diese Analyse erklärt die Motivation hinter den puristischen Bestrebungen und die Notwendigkeit, die deutsche Sprache zu "reinigen" und zu stärken.
Welche Persönlichkeiten und Institutionen werden behandelt?
Die Arbeit stellt wichtige Persönlichkeiten und Institutionen des Sprachpurismus vor, darunter Sprachgesellschaften, Gottfried Wilhelm Leibniz, Joachim Heinrich Campe und den Gedanken an eine deutsche Sprachakademie. Die verschiedenen Ansätze und Strategien dieser Akteure werden detailliert untersucht und verglichen.
Wie werden die Kapitel zusammengefasst?
Die Zusammenfassung der Kapitel umfasst die Einleitung mit der Vorstellung der Thematik und der Forschungsfrage, die begriffliche Abgrenzung von Sprach- und Fremdwortpurismus, die Beschreibung der sprachlichen Situation im 17. und 18. Jahrhundert, die Analyse der puristischen Bestrebungen mit ihren Akteuren und Strategien, und schließlich einen Ausblick auf den Übergang zum Fremdwortpurismus.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Sprachpurismus, Fremdwortpurismus, Sprachgeschichte, 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, Sprachpflege, Sprachreinigung, Gottfried Wilhelm Leibniz, Joachim Heinrich Campe, Sprachgesellschaften, deutsche Sprache.
Wie ist der Aufbau der Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur Abgrenzung von Sprach- und Fremdwortpurismus, zur sprachlichen Situation im 17. und 18. Jahrhundert, zu den puristischen Bestrebungen dieser Epoche, zum Übergang zum Fremdwortpurismus und abschließend in eine Schlussbetrachtung. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel erleichtern den Überblick.
Welche Ziele werden verfolgt?
Die Arbeit zielt darauf ab, den Sprachpurismus des 17. und 18. Jahrhunderts zu untersuchen, die Unterschiede zwischen Sprach- und Fremdwortpurismus zu klären und die Hintergründe sowie die Akteure der puristischen Bestrebungen zu analysieren. Der Übergang zum Fremdwortpurismus wird ebenfalls thematisiert.
- Quote paper
- M.Ed. Henriette Bartusch (Author), 2014, Sprachpurismus im 17. und 18. Jahrhundert. Vom Sprach- zum Fremdwortpurismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/315251