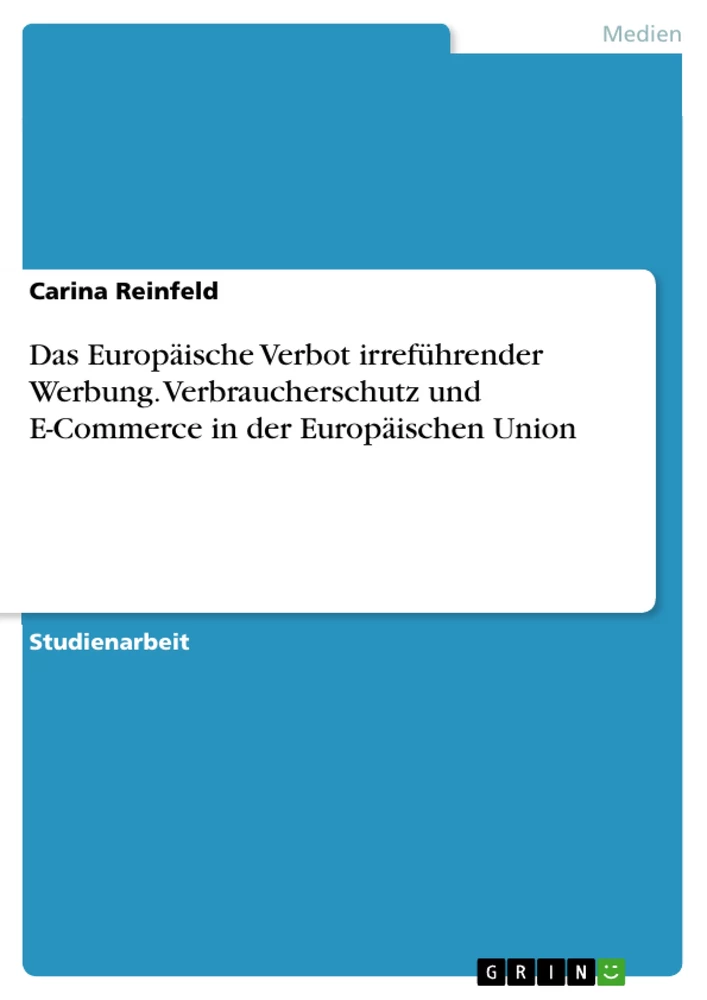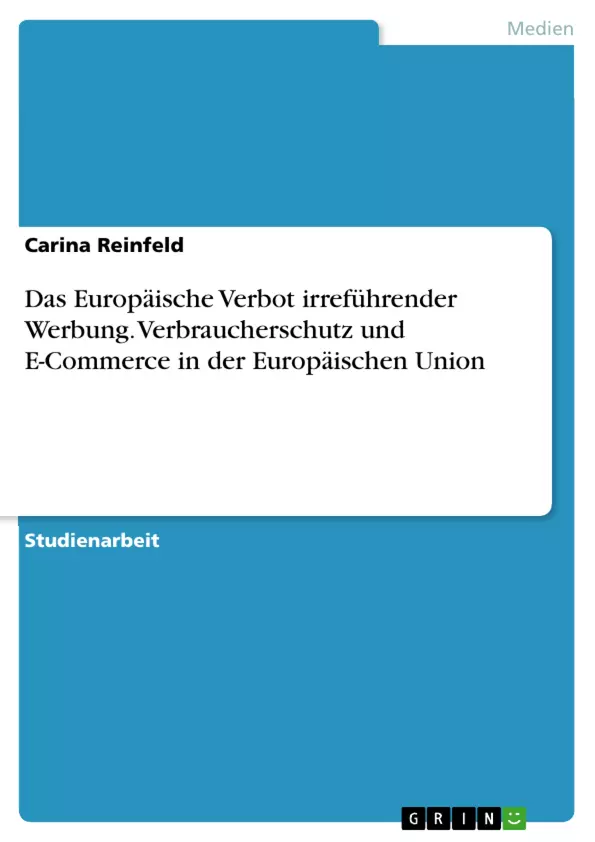Gegenstand der vorliegenden Arbeit sind die Richtlinien in Bezug auf das Werbe- und Wettbewerbsrecht in der Europäischen Union.
Heutzutage umgibt Werbung die Verbraucher in nahezu allen Situationen – egal ob als Werbeplakat in der Stadt, als Anzeige in einer Tageszeitung, als Werbebanner auf Internetseiten oder als Pop-up Benachrichtigung auf einem Smartphone. Zudem ist Werbung derzeit deutlich direkter und persönlicher als noch vor einigen Jahren. Aber wird die Werbung dadurch auch intensiver beziehungsweise aufmerksamer durch den Verbraucher wahrgenommen?
Gleichzeitig ist der Informationsbedarf eines Verbrauchers gestiegen. Der Elektronische Geschäftsverkehr begünstigt diese Entwicklung durchaus, dann der Kunde kann sich selbst informieren und selbstständig verschiedene Angebote vergleichen. Fraglich ist, ob die im Internet vorgetäuschte Anonymität der Vertragspartner die Irreführung der Verbraucher durch Werbung erleichtert.
Des Weiteren wird der Verbraucherschutz in der Europäischen Gemeinschaft zunehmend betont. Eine Vielzahl an Richtlinien, Verordnungen o.ä. befasst sich mit einer verbraucherfreundlichen Gestaltung des Wettbewerbsrechts: Neben der Richtlinie (RL) 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken und der RL 2006/114/EG über irreführende und vergleichende Werbung, gibt es die RL 2000/31/EG über die Dienste der Informationsgesellschaft, aber auch die RL 2000/13/EG über die Etikettierung und Aufmachung von Lebensmitteln sowie die Werbung hierfür.
Demnach lautet die zentrale Fragestellung dieser Ausarbeitung: Ist der stetige Fortschritt des Elektronischen Geschäftsverkehrs ein Hemmnis für den Verbraucherschutz in der Europäischen Union?
Der Gang der Untersuchung gliedert sich wie folgt: Vorab werden die für das Verständnis der vorliegenden Arbeit notwendigen Begriffe definiert. Während zum Einen das interdisziplinäre Verständnis der Begriffe erwähnt wird, werden zum Anderen Legaldefinitionen nach europäischem und nationalem Recht vorgestellt. Darauf folgt eine Darstellung der Verbraucherschutzpolitik in der Europäischen Union nach Vorstellung des zugrunde liegenden Verbraucherleitbildes. Hier findet ebenfalls die Berücksichtigung von Besonderheiten im elektronischen Geschäftsverkehr Anerkennung. Anschließend wird der Bezug zum europäischen Werberecht auf Basis einer Auswertung der ökonomischen Relevanz des Werberechts für den Europäischen Binnenmarkt hergestellt.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Zentrale Fragestellung und Gang der Untersuchung
- Der Begriff Werbung im rechtlichen Kontext
- Definition des Begriffes Werbung nach Europäischem Recht
- Definition des Begriffes Werbung nach Deutschem Recht
- Ergebnis für die vorliegende Ausarbeitung
- Elektronischer Geschäftsverkehr / E-Commerce
- Die Notwendigkeit von Verbraucherschutz
- Das Verbraucherleitbild in der Europäischen Union
- Die Relevanz von E-Commerce in der Verbraucherschutzpolitik
- Die ökonomische Relevanz der Ausgestaltung des Werberechts im Europäischen Binnenmarkt
- Die Ziele und Grundfreiheiten des Binnenmarktes
- Die Bedeutung der Verbraucherschutzes für den Europäischen Binnenmarkt
- Irreführende Werbung nach Europäischem Recht
- Unlautere Geschäftspraktiken
- Der Tatbestand der Irreführung
- Anwendungsbeispiele: Irreführende Werbung im elektronischen Geschäftsverkehr
- Werbung mit Produkteigenschaften
- Manipulierte Kundenbewertungen
- Die ,,Abofalle“
- Fazit & Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit befasst sich mit dem europäischen Verbot irreführender Werbung im Kontext von Verbraucherschutz und E-Commerce innerhalb der Europäischen Union. Sie analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen, die ökonomische Relevanz und die praktische Anwendung des Verbots in der digitalen Welt.
- Definition und rechtliche Einordnung des Begriffs "Werbung"
- Die Bedeutung von Verbraucherschutz im digitalen Zeitalter
- Die Rolle des E-Commerce im europäischen Binnenmarkt
- Die Ausgestaltung des Werberechts im Kontext von Irreführung
- Anwendungsbeispiele irreführender Werbung im Online-Handel
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel führt in die zentrale Fragestellung ein und erläutert den Aufbau der Arbeit. Kapitel zwei definiert den Begriff "Werbung" im europäischen und deutschen Recht. Im dritten Kapitel wird der Begriff "E-Commerce" beleuchtet. Kapitel vier beleuchtet die Notwendigkeit von Verbraucherschutz in der Europäischen Union. Kapitel fünf analysiert die ökonomische Relevanz der Ausgestaltung des Werberechts im Europäischen Binnenmarkt. Kapitel sechs beschäftigt sich mit der Thematik der irreführenden Werbung im europäischen Recht. Kapitel sieben präsentiert konkrete Beispiele für irreführende Werbung im E-Commerce. Das Fazit und der Ausblick runden die Arbeit ab.
Schlüsselwörter (Keywords)
Verbraucherschutz, E-Commerce, Irreführende Werbung, Europäische Union, Binnenmarkt, Unlauterer Wettbewerb, Digitale Wirtschaft, Online-Handel, Kundenbewertungen.
Häufig gestellte Fragen
Was gilt in der EU als irreführende Werbung?
Werbung ist irreführend, wenn sie Angaben enthält, die den Verbraucher über Produkteigenschaften, Preise oder Bedingungen täuschen und ihn so zu einer geschäftlichen Entscheidung veranlassen.
Welchen Einfluss hat E-Commerce auf den Verbraucherschutz?
Der elektronische Geschäftsverkehr erhöht den Informationsbedarf, birgt aber auch Risiken wie manipulierte Kundenbewertungen oder die Anonymität der Vertragspartner.
Was ist eine 'Abofalle' im Internet?
Es handelt sich um eine Form irreführender Werbung, bei der Kostenpflichten im Kleingedruckten versteckt werden, um den Nutzer ungewollt in einen Vertrag zu drängen.
Was ist das 'Verbraucherleitbild' der EU?
Die EU geht traditionell vom 'mündigen Verbraucher' aus, der sich informiert und vernünftig entscheidet, betont aber zunehmend den Schutz vor unlauteren Geschäftspraktiken.
Welche Richtlinien regeln das europäische Werberecht?
Wichtige Regelwerke sind die Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken und die Richtlinie 2006/114/EG über irreführende und vergleichende Werbung.
- Arbeit zitieren
- Carina Reinfeld (Autor:in), 2015, Das Europäische Verbot irreführender Werbung. Verbraucherschutz und E-Commerce in der Europäischen Union, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/315260