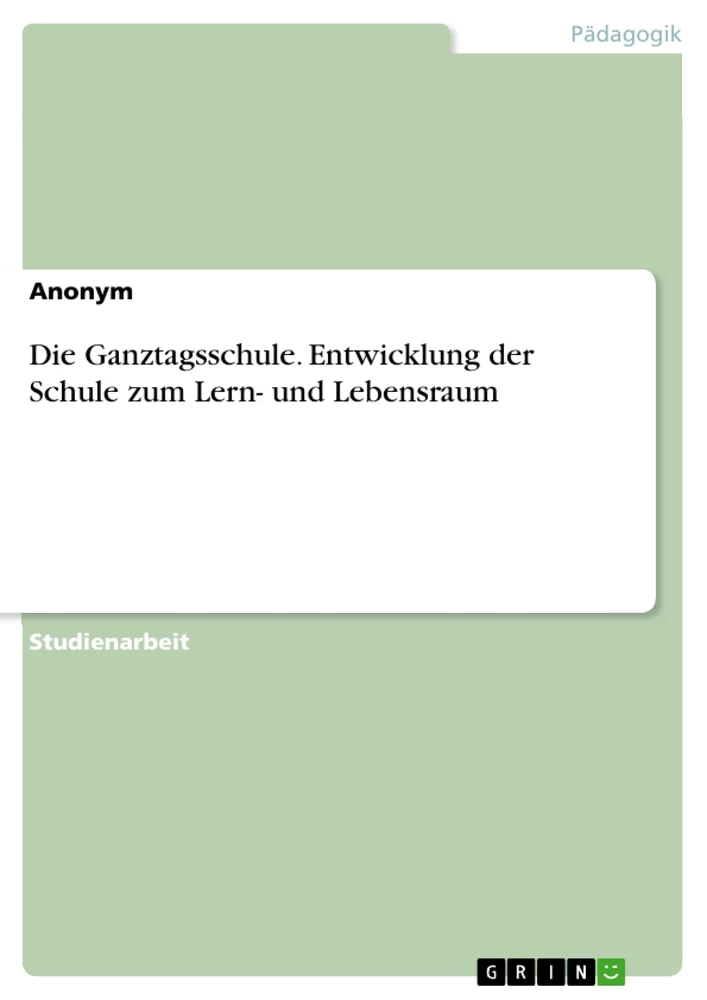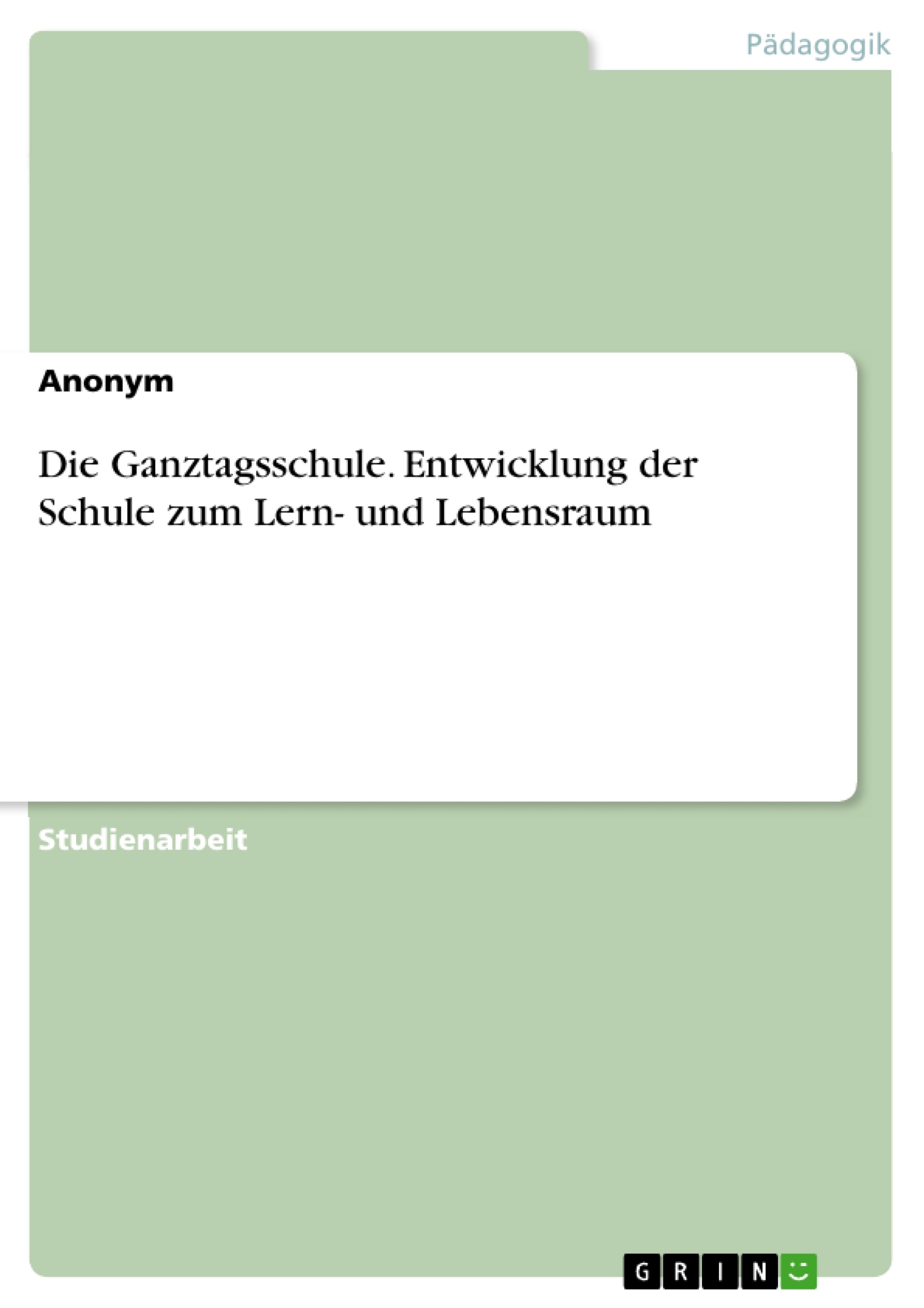Die Debatte um das deutsche Bildungssystem ist heutzutage topaktuell. Als Hauptauslöser der heftigen Diskussionen über die Mängel des deutschen Bildungssystems gelten die schockierenden Ergebnisse der internationalen Schulleistungsstudie PISA 2000 (Programme for International Student Assessment). Die Studie untersuchte drei Kompetenzbereiche: Lesekompetenz, mathematische Grundbildung und naturwissenschaftliche Grundbildung, in denen die deutschen Schüler jeweils schlecht abgeschnitten haben.
Nicht nur die schlechten Leistungsergebnisse der deutschen Schüler wurden festgestellt, sondern auch die Tatsache, dass Deutschland eines der Länder mit dem größten Abstand zwischen den leistungsstärksten und leistungsschwächsten Schülern ist und dass die lernschwachen Schüler und Migrantenkinder im Gegensatz zu anderen Ländern nur wenig oder gar nicht gefördert werden. In diesem Zusammenhang war die eigentliche Kernfrage der Diskussion in der Bildungspolitik, welche Reformen am deutschen Schulsystem sich objektiv aus den PISA-Ergebnissen ableiten ließen. Die Antwort darauf war „die Ganztagsschule“, weil in der Spitzengruppe augenfällig viele Länder mit einem Ganztagsschulsystem zu finden waren.
Als Konsequenz aus dieser Debatte beschloss die Kultusministerkonferenz am 05./06.12.2001 Maßnahmen zum Ausbau von schulischen und außerschulischen Ganztagsangeboten „mit dem Ziel erweiterter Bildungs- und Fördermöglichkeiten, insbesondere für Schülerinnen und Schüler mit Bildungsdefiziten und besonderen Begabungen“ (vgl. KMK, 2004). Die Forderung zum Ausbau der Halbtagsschulen zu Ganztagsschulen provozierte jedoch viele Diskussionen bezüglich der tatsächlichen Möglichkeiten der Schulen zur Umsetzung des Konzepts. Obwohl das Konzept viele Vorteile mit sich bringt, hängt seine Umsetzung in die Praxis von mehreren Faktoren ab. Wie die Notwendigkeit zur Einrichtung von Ganztagsschulen in Deutschland aus der bildungspolitischen und schulpädagogischen, sozialpolitischen und sozialpädagogischen Sicht begründet wird, wie die Ganztagsschule organisiert und gestaltet wird und welche Faktoren die Umsetzung des Konzepts beeinflussen bzw. verhindern, sind die zentralen Themen meiner Schriftlichen Präsentation.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Ganztagsschulmodelle
- Das Konzept der Ganztagsschule
- Begründungen und Zielorientierungen zur Einrichtung von Ganztagsschulen
- Organisation von GTS
- Ganztagsschulmodelle
- Gestaltung der Ganztagsschule (Personal, Räume, Zeit)
- Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Konzepts in die Praxis
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Schriftliche Präsentation befasst sich mit der Entwicklung der Ganztagsschule als Lern- und Lebensraum. Sie untersucht die Gründe für die Einrichtung von Ganztagsschulen in Deutschland und beleuchtet die verschiedenen Organisationstypen und Gestaltungselemente. Dabei werden die Herausforderungen bei der Umsetzung des Konzepts in die Praxis betrachtet.
- Die Notwendigkeit der Ganztagsschule aus bildungspolitischer und schulpädagogischer sowie sozialpolitischer und sozialpädagogischer Sicht
- Die verschiedenen Modelle und Organisationsformen der Ganztagsschule
- Die Gestaltung der Ganztagsschule in Bezug auf Personal, Räume und Zeit
- Die Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Ganztagschulkonzepts in die Praxis
- Die Chancen und Herausforderungen der Ganztagsschule als Lern- und Lebensraum
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
1. Einleitung
Die Einleitung stellt den aktuellen Diskurs über das deutsche Bildungssystem dar, der durch die Ergebnisse der PISA-Studie 2000 angestoßen wurde. Sie beleuchtet die Defizite des deutschen Schulsystems und die Notwendigkeit von Reformen, wobei die Ganztagsschule als Lösungsansatz präsentiert wird.
2. Das Konzept der Ganztagsschule
2.1. Begründungen und Zielorientierungen zur Einrichtung von Ganztagsschulen
Dieser Abschnitt untersucht die Gründe für die Einrichtung von Ganztagsschulen aus unterschiedlichen Perspektiven: bildungspolitisch, schulpädagogisch, sozialpolitisch und sozialpädagogisch. Es werden die Vorteile von Ganztagsschulen in Bezug auf Bildung, Förderung, Betreuung und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hervorgehoben.
2.2. Organisation von GTS
2.2.1. Ganztagsschulmodelle
Dieser Abschnitt beschreibt die verschiedenen Modelle von Ganztagsschulen, die in Deutschland diskutiert und praktiziert werden. Es werden die offene und gebundene Ganztagsschule im Detail vorgestellt.
2.2.2. Gestaltung der Ganztagsschule (Personal, Räume, Zeit)
Dieser Abschnitt beleuchtet die Gestaltungselemente der Ganztagsschule, insbesondere die Bedeutung von Personal, Räumen und Zeit. Er betrachtet die Anforderungen an die Ressourcen und die Organisation, die für eine erfolgreiche Umsetzung des Ganztagschulkonzepts notwendig sind.
3. Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Konzepts in die Praxis
Dieser Abschnitt befasst sich mit den Herausforderungen, die bei der Umsetzung des Ganztagschulkonzepts in der Praxis auftreten. Es werden die Schwierigkeiten bei der Organisation, Finanzierung und Personalgewinnung sowie die Einbindung von Eltern und Schülern angesprochen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die zentralen Begriffe, die in dieser Schriftlichen Präsentation behandelt werden, sind: Ganztagsschule, Bildung, Erziehung, Betreuung, Förderung, Organisation, Gestaltung, Personal, Räume, Zeit, Herausforderungen, Chancen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Bildungsdefizite, PISA-Studie, Schulsystem, Schulreform.
Häufig gestellte Fragen
Warum wurde die Ganztagsschule nach PISA 2000 zum zentralen Thema?
Die PISA-Studie zeigte erhebliche Leistungsdefizite und soziale Ungleichheiten im deutschen Schulsystem auf. Da erfolgreiche Länder oft Ganztagsschulsysteme hatten, wurde deren Ausbau als Lösung für bessere Förderung und Chancengleichheit gesehen.
Was ist der Unterschied zwischen offener und gebundener Ganztagsschule?
In der offenen Ganztagsschule ist die Teilnahme an Nachmittagsangeboten freiwillig, während in der gebundenen Form der Schultag für alle Schüler verbindlich rhythmisiert ist (Wechsel von Unterricht und Freizeit über den ganzen Tag).
Welche Ziele verfolgt die Ganztagsschule?
Zu den Hauptzielen gehören die individuelle Förderung von Schülern, der Abbau von Bildungsbenachteiligung, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Schule als Lebensraum zu gestalten.
Welche Schwierigkeiten gibt es bei der Umsetzung?
Herausforderungen liegen vor allem in der Finanzierung, dem Mangel an qualifiziertem Personal, der unzureichenden räumlichen Ausstattung und der organisatorischen Einbindung externer Partner.
Wie wird die Ganztagsschule sozialpädagogisch begründet?
Sie wird als Antwort auf veränderte Kindheitsbedingungen und Familienstrukturen gesehen, um Kindern einen stabilen Rahmen für soziale Kontakte und außerschulische Bildungserfahrungen zu bieten.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2007, Die Ganztagsschule. Entwicklung der Schule zum Lern- und Lebensraum, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/315304