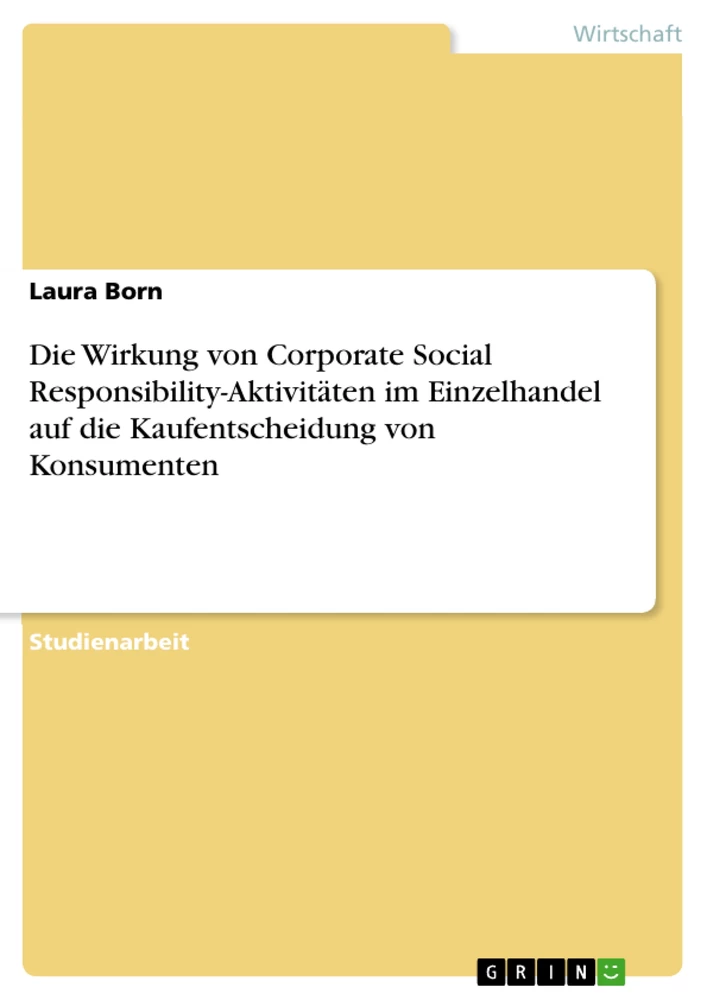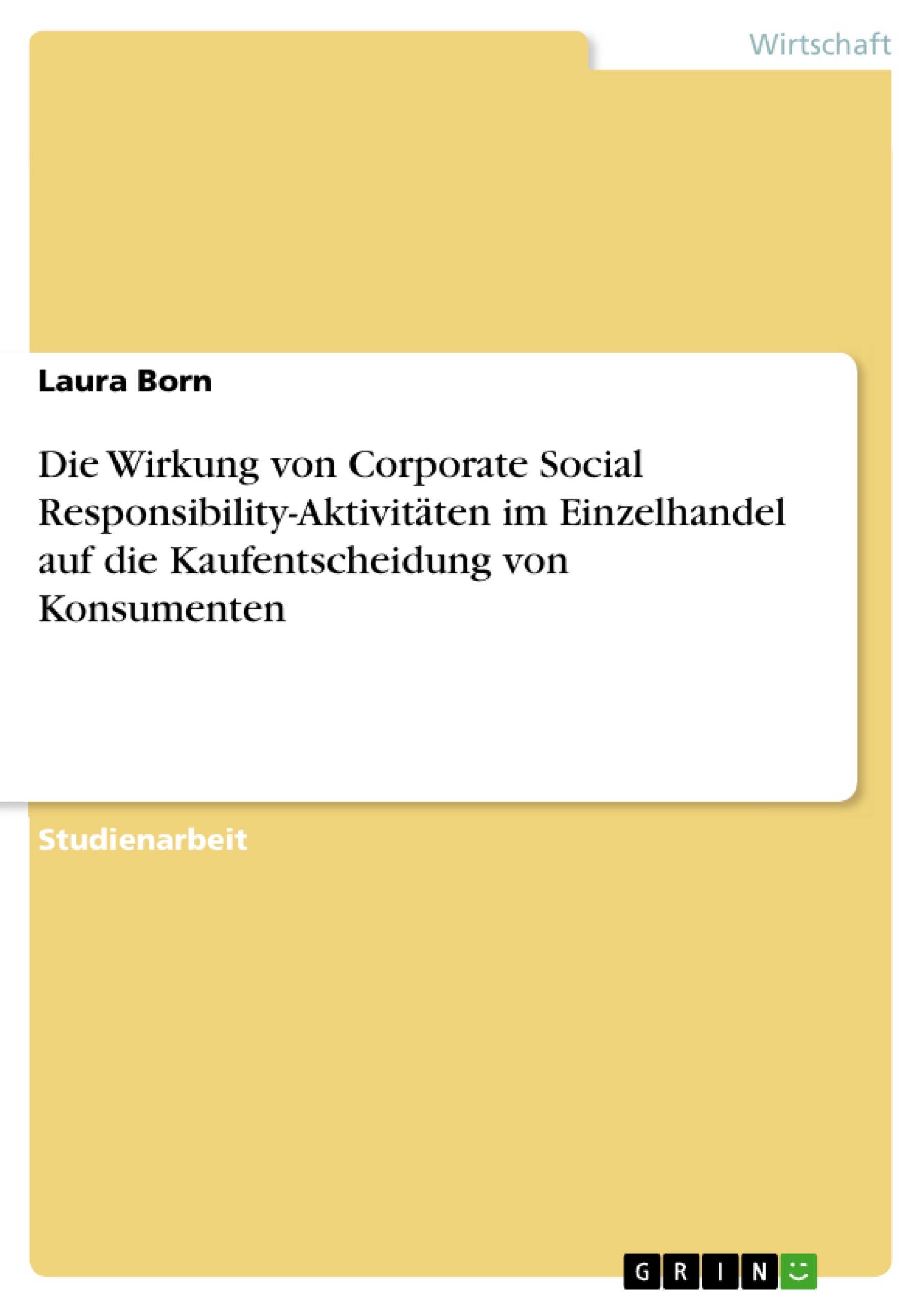Im Rahmen dieser Arbeit soll die Wirkung von Corporate Social Responsibility (CSR)-Aktivitäten im Einzelhandel auf die Kaufentscheidung von Konsumenten analysiert werden. Für die Untersuchung ergibt sich daraus folgende Hauptforschungsfrage „Inwiefern können CSR-Aktivitäten interne und externe Reaktionen von Konsumenten beeinflussen?“ Die Literatur zeigt, dass die Wirkung von CSR auf Konsumenten unter verschiedenen Umständen variieren kann, wodurch sich folgende weitere Forschungsfrage aufwirft: „Welche Einflussfaktoren bestimmen die Wirkung der CSR-Aktivitäten auf die Kaufentscheidung von Konsumenten?“
Es wird deutlich, dass für eine erfolgreiche CSR-Implementierung eines Unternehmens zahlreiche Faktoren zu berücksichtigen sind, die nicht zwangsläufig zu positiven Wirkungen auf die Kaufabsicht der Konsumenten führen müssen. Daraus resultiert die weitere Forschungsfrage: „Welche Implikationen der Anwendung von CSR-Aktivitäten ergeben sich für den Einzelhandel?“
Zur Beantwortung der Fragen sollen in Kapitel 2 zunächst wichtige Grundlagen der Corporate Social Responsibility und des Einzelhandels geklärt werden. Das darauf folgende Kapitel dient der Darstellung eines theoretischen Modells zur Erklärung der Wirkung des Reizes CSR und der darauf wirkenden Einflussfaktoren. In Kapitel 4 sollen daraus resultierende Implikationen für den Einzelhandel gegeben werden. Die Arbeit endet in Kapitel 5 mit einem Fazit und Ausblick.
Unternehmungen verfolgen längst nicht mehr nur die Gewinnmaximierung als Ziel. Vielmehr gilt es heutzutage, auch soziale Belange in die Unternehmenspraktiken zu integrieren. Eine Möglichkeit, dies zu realisieren, ist der Ansatz der Corporate Social Responsibility (CSR), also die freiwillige Übernahme sozialer oder ökologischer Verantwortung auf Unternehmensseite. Einige Studien konnten bereits einen positiven Einfluss von Corporate Social Responsibilty auf die Kaufintention von Konsumenten belegen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- 1. Problemstellung
- 2. Definitorische und konzeptionelle Grundlagen
- 2.1 Arten und Definitionen der Corporate Social Responsibility
- 2.2 Begriffsabgrenzung Einzelhandel
- 2.3 Die Rolle von CSR-Aktivitäten im Einzelhandel
- 3. Die Kaufentscheidung im Rahmen des Stimulus-Organismus-Response-Modells
- 3.1 Wirkung von CSR auf die internen Reaktionen
- 3.2 Wirkung der internen Reaktionen auf die Kaufentscheidung
- 3.3 Einflussfaktoren auf die Wirkung von Corporate Social Responsibility
- 4. Implikationen der Wirkungen von CSR-Aktivitäten für den Einzelhandel
- 5. Fazit und Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Seminararbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie sich CSR-Aktivitäten im Einzelhandel auf die Kaufentscheidung von Konsumenten auswirken. Ziel ist es, die relevanten theoretischen Grundlagen zu beleuchten, die Wirkung von CSR-Aktivitäten auf die internen Reaktionen und die Kaufentscheidung von Konsumenten zu analysieren und schließlich Implikationen für die Praxis des Einzelhandels abzuleiten.
- Definition und Arten der Corporate Social Responsibility (CSR)
- Rolle von CSR-Aktivitäten im Einzelhandel
- Einfluss von CSR-Aktivitäten auf die Kaufentscheidung von Konsumenten
- Theoretische Modelle zur Erklärung der Wirkung von CSR-Aktivitäten
- Implikationen für den Einzelhandel
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel behandelt die Problemstellung und führt in das Thema der CSR-Aktivitäten im Einzelhandel ein. Es wird deutlich, dass Unternehmen heute nicht nur die Gewinnmaximierung im Fokus haben, sondern auch soziale Verantwortung übernehmen müssen. Das zweite Kapitel erläutert die grundlegenden Definitionen und Konzepte der Corporate Social Responsibility und grenzt den Einzelhandel als relevanten Anwendungsbereich ab.
Im dritten Kapitel wird das Stimulus-Organismus-Response-Modell vorgestellt, um die Kaufentscheidung von Konsumenten zu erklären. Hierbei werden die Wirkungsmechanismen von CSR-Aktivitäten auf die internen Reaktionen und schließlich auf die Kaufentscheidung analysiert. Der Einfluss verschiedener Faktoren auf die Wirkung von CSR wird ebenfalls beleuchtet.
Das vierte Kapitel untersucht die Implikationen der Wirkungen von CSR-Aktivitäten für den Einzelhandel und zeigt, welche strategischen Handlungsmöglichkeiten sich für Unternehmen ergeben.
Schlüsselwörter (Keywords)
Corporate Social Responsibility, Einzelhandel, Kaufentscheidung, Konsumentenverhalten, Stimulus-Organismus-Response-Modell, Stakeholder-Gruppen, Nachhaltigkeit, ethisches Verhalten, soziale Verantwortung.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst CSR die Kaufentscheidung von Kunden?
CSR-Aktivitäten können positive interne Reaktionen auslösen, die die Kaufabsicht steigern, sofern die Aktivitäten vom Konsumenten als glaubwürdig wahrgenommen werden.
Was ist das Stimulus-Organismus-Response-Modell?
Es erklärt, wie ein Reiz (CSR) im Organismus (Konsument) verarbeitet wird und zu einer Reaktion (Kauf oder Nicht-Kauf) führt.
Führt CSR immer zu höheren Gewinnen?
Nicht zwangsläufig. Die Wirkung hängt von zahlreichen Einflussfaktoren ab und kann unter verschiedenen Umständen variieren.
Welche Rolle spielt der Einzelhandel bei CSR?
Einzelhändler integrieren soziale und ökologische Belange freiwillig in ihre Praktiken, um sich als verantwortungsbewusste Stakeholder zu positionieren.
Was sind interne Reaktionen von Konsumenten?
Dazu gehören Einstellungen, Vertrauen und die emotionale Bewertung eines Unternehmens basierend auf dessen CSR-Engagement.
- Quote paper
- Laura Born (Author), 2015, Die Wirkung von Corporate Social Responsibility-Aktivitäten im Einzelhandel auf die Kaufentscheidung von Konsumenten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/315440