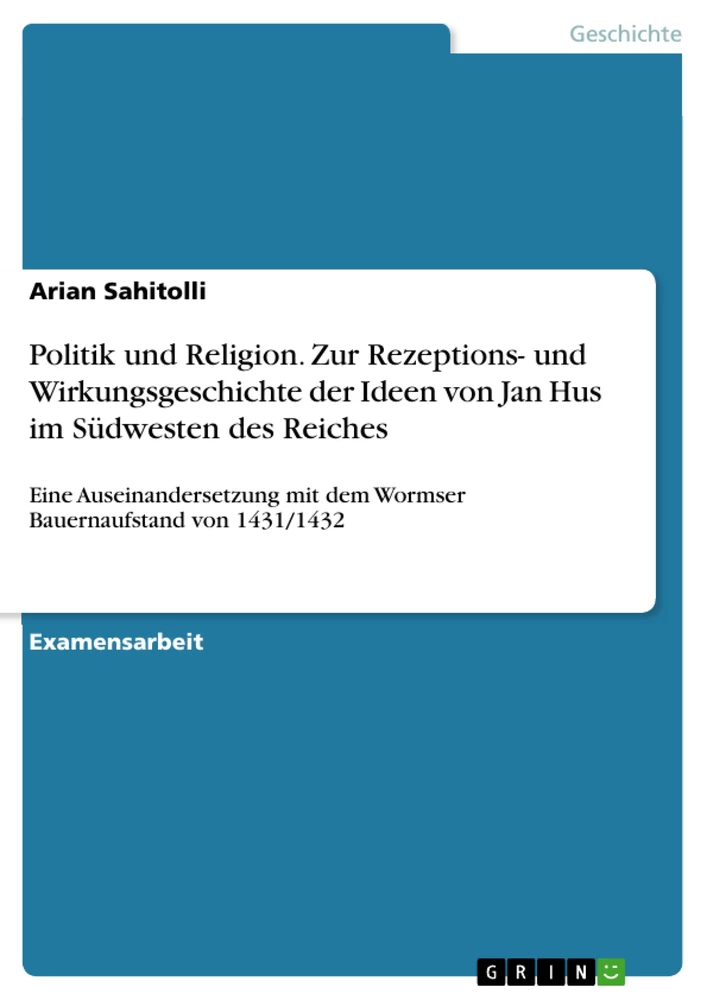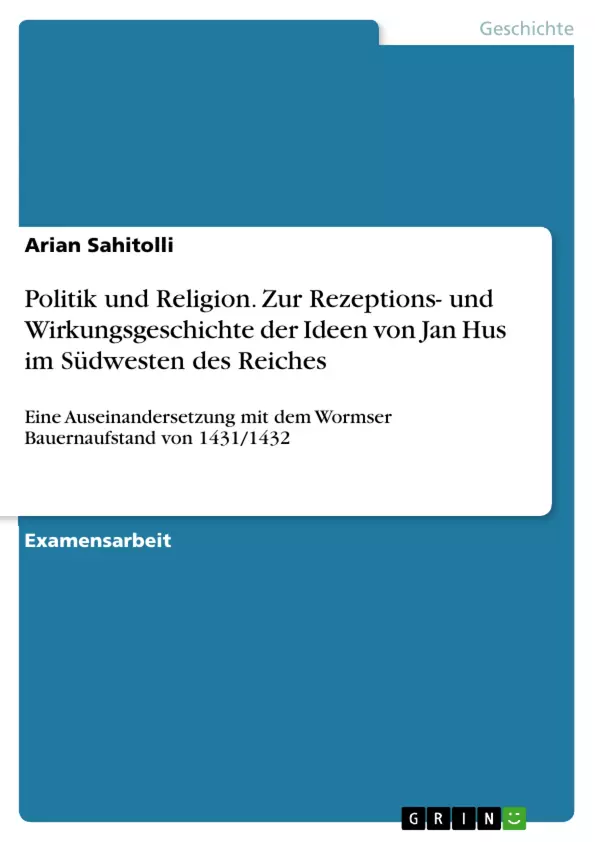Das Basler Konzil (1431-1449) wurde aus Sicht einiger zeitgenössischer Kleriker als unheilvolle Synergie wahrgenommen, die innerhalb der Forschung bisher noch kaum aufgegriffen und untersucht wurde. Ausgehend von den Ereignissen um Worms 1431/1432, droht ein mögliches Zusammengehen aller deutschen Bauern mit dem sich - auch auf deutschem Boden - ausbreitenden Hussitismus.
Bruneti, der in seinem Brief an das Domkapitel zu Arras nicht nur über seine Reise nach Basel und die Ereignisse und Zustände im und um das Konzil berichtet, erwähnt jenen Bauernaufstand in der Gegend um Worms, den er als die Ursache allen - möglichen - zukünftigen Übels prophezeit. Laut Bruneti richtet sich dieser Aufstand zwar in erster Linie gegen die beiden Machtpole des spätmittelalterlichen Reiches, dem Klerus und dem Adel. Interessanter erscheint mir jedoch die Tatsache, dass Bruneti dem Bauernaufstand in Worms in erster Linie keinen ökonomischen, sondern vielmehr einen sozial-revolutionären und vor allem ideologischen Hintergrund zuschreibt.
Angesichts dieser zeitgenössischen Ansicht, in der die Furcht vor einer Ausbreitung des Hussitismus stark war und sich auch auf die Politik des Basler Konzils auswirkte, erscheint es überaus überraschend, dass innerhalb der historischen Forschung die Akte um die Hintergründe dieses Wormser Bauernaufstandes, der sich 1431/1432 ereignet hat, oft mit dem Hinweis auf die sozioökonomische Not der Bauern in und um Worms geschlossen wird. Dass viele Historiker die ökonomische Misslage in den Mittelpunkt ihrer Ursachenforschung rücken, bietet zwar angesichts der Krise des Spätmittelalters einen sicheren Argumentationsanker, liefert jedoch nur einen Teilausschnitt der komplex(er)en Wahrheit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Ausgangslage: Die Krisenerscheinungen des 15. Jahrhunderts
- 1.1 Der Wormser Bauernaufstand von 1431/1432: Eine Ursachenforschung
- 1.2 Zur Zielsetzung dieser Arbeit und zum Forschungsstand
- 2. Der Wormser Bauernaufstand als historischer Sonderfall
- 2.1 Zur Geschichte der Reichs- und Bischofsstadt Worms
- 2.2 Der historische Pfaffenhass' in Worms
- 2.3 Kahal Kadosch Warmaisa- Über die antijüdischen Tendenzen in der Stadt Worms
- 2.4 Die Ereignisse um Worms im Jahre 1431/1432
- 3. Johannes Hus - Ein unfolgsamer Sohn der Kirche
- 3.1 Von Hussinetz nach Prag - Der Aufstieg eines kleinen Mannes
- 3.2 Die, Lex Dei' als höchste Instanz - Über die theologischen Standpunkte des Johannes Hus
- 3.3 Das politische Weltbild des Frühreformators
- 3.4 Nieder mit der feudalen Ordnung!? Die Gesellschaftskritik des Johannes Hus
- 4. Zur Einordnung des Untersuchungsgegenstandes: Die Rezeptionsgeschichte zum Deutschen Bauernkrieg von 1525
- 4.1 Zu den Vorläufern des Bauernkriegs von 1525 – Eine Gesamtanalyse
- 4.2 „Reformatio Sigismundi“ - Die „Trompete des Bauernkriegs“
- 4.3 Der,,Oberrheinische Revolutionär“ – Theoretiker eines revolutionären Schriftstücks?
- 4.4 Der hungernde Bauer? Zur sozialen Lage der oberrheinischen Bauern im 15. Jahrhundert
- 5. Der Hussitismus im Sacrum Romanum Imperium - Die,Quelle allen Übels'?
- 5.1 Der Hussitismus - Das trügerische Bild einer geschlossenen Bewegung?
- 5.2 Das Phänomen,,Deutsche Hussiten\" - Missionare auf nährreichem Boden?
- 5.3 Die Dresdner Schule in Prag - Die Keimzelle der hussitischen Lehre auf deutschem Boden
- 5.4 Der Inquisitionsprozess gegen Johannes Drändorf im Jahre 1425
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Wormser Bauernaufstand von 1431/1432 und seine Verbindungen zu den Ideen von Jan Hus. Ziel ist es, den Aufstand nicht nur unter sozioökonomischen Aspekten zu betrachten, sondern auch die Rolle hussitischer Ideen und deren Rezeption im Südwesten des Reiches zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet den Kontext der damaligen Reichskrise.
- Der Wormser Bauernaufstand von 1431/32 als komplexes Ereignis
- Die Rezeption der Ideen von Jan Hus im Heiligen Römischen Reich
- Der Einfluss des Hussitismus auf den Bauernstand
- Sozioökonomische Bedingungen im Südwesten des Reiches im 15. Jahrhundert
- Die Reichskrise des 15. Jahrhunderts
Zusammenfassung der Kapitel
1. Ausgangslage: Die Krisenerscheinungen des 15. Jahrhunderts: Dieses Kapitel untersucht die krisenhaften Zustände des 15. Jahrhunderts, die den Hintergrund für den Wormser Bauernaufstand bilden. Es analysiert die ökonomischen, sozialen und politischen Faktoren, insbesondere die Agrarkrise und die Auswirkungen von Pest und Bevölkerungsrückgang. Der Brief von Peter Bruneti wird als Quelle für die damalige Wahrnehmung der Ereignisse herangezogen und die bestehende Forschungsliteratur zu der Frage nach der "Krise des Spätmittelalters" diskutiert. Besonders relevant ist die Ausgangslage für das Verständnis der komplexen Ursachen des Bauern-aufstandes.
2. Der Wormser Bauernaufstand als historischer Sonderfall: Dieses Kapitel widmet sich dem Wormser Bauernaufstand selbst. Es beschreibt die Geschichte Worms', den "Pfaffenhass", antijüdische Tendenzen in der Stadt und die Ereignisse des Aufstandes von 1431/32. Es geht um die Frage, inwiefern ökonomische Not die Hauptursache war oder ob auch soziale und religiöse Faktoren eine wichtige Rolle spielten. Die Zusammenfassung der verschiedenen Aspekte des Aufstands ist für das Verständnis des komplexen Geschehens unerlässlich.
3. Johannes Hus - Ein unfolgsamer Sohn der Kirche: Dieses Kapitel stellt die Person und die Lehren Johannes Hus vor. Es verfolgt seinen Weg von Hussinetz nach Prag, erläutert seine theologischen Positionen ("Lex Dei"), sein politisches Weltbild und seine Gesellschaftskritik. Die Darstellung von Hus' Lehren ist fundamental für das Verständnis des möglichen Einflusses seiner Ideen auf den Bauernstand und den Aufstand. Es wird die Bedeutung seiner Kritik an der feudalen Ordnung beleuchtet.
4. Zur Einordnung des Untersuchungsgegenstandes: Die Rezeptionsgeschichte zum Deutschen Bauernkrieg von 1525: In diesem Kapitel wird der Wormser Bauernaufstand im Kontext der Vorläufer des Deutschen Bauernkrieges von 1525 eingeordnet. Es werden wichtige Schriften und Persönlichkeiten der damaligen Zeit analysiert, um die Entwicklung revolutionärer Ideen zu beleuchten. Die soziale Lage der oberrheinischen Bauern im 15. Jahrhundert wird untersucht, um die Voraussetzungen für den Aufstand besser zu verstehen. Die Einordnung in den grösseren Kontext des Bauernkrieges erweitert den Blick auf den Wormser Aufstand.
5. Der Hussitismus im Sacrum Romanum Imperium - Die,Quelle allen Übels'?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Ausbreitung des Hussitismus im Heiligen Römischen Reich und seinen Auswirkungen. Es hinterfragt das Bild des Hussitismus als geschlossene Bewegung und analysiert das Phänomen der "Deutschen Hussiten". Die Rolle der Dresdner Schule in Prag und ein Inquisitionsprozess gegen Johannes Drändorf werden als Beispiele für den Einfluss hussitischer Ideen im deutschsprachigen Raum dargestellt. Das Kapitel beleuchtet die Verbreitung hussitischer Ideen und deren Bedeutung für den Wormser Aufstand.
Schlüsselwörter
Wormser Bauernaufstand 1431/32, Jan Hus, Hussitismus, Reichskrise, Spätmittelalter, Agrarkrise, soziale Unruhen, religiöse Bewegungen, Pfaffenhass, Antisemitismus, Sozioökonomie, Reformationsgeschichte.
Häufig gestellte Fragen zum Wormser Bauernaufstand von 1431/32
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Wormser Bauernaufstand von 1431/32 und seine Verbindungen zu den Ideen von Jan Hus. Sie betrachtet den Aufstand nicht nur unter sozioökonomischen Aspekten, sondern analysiert auch die Rolle hussitischer Ideen und deren Rezeption im Südwesten des Heiligen Römischen Reiches im Kontext der damaligen Reichskrise.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Der Wormser Bauernaufstand als komplexes Ereignis; die Rezeption der Ideen von Jan Hus im Heiligen Römischen Reich; der Einfluss des Hussitismus auf den Bauernstand; sozioökonomische Bedingungen im Südwesten des Reiches im 15. Jahrhundert; und die Reichskrise des 15. Jahrhunderts.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit besteht aus fünf Kapiteln: Kapitel 1 untersucht die krisenhaften Zustände des 15. Jahrhunderts als Hintergrund des Aufstands. Kapitel 2 widmet sich dem Wormser Bauernaufstand selbst, einschließlich der Geschichte Worms', des "Pfaffenhasses" und antijüdischer Tendenzen. Kapitel 3 stellt Jan Hus und seine Lehren vor. Kapitel 4 ordnet den Wormser Aufstand in den Kontext der Vorläufer des Deutschen Bauernkriegs von 1525 ein. Kapitel 5 befasst sich mit der Ausbreitung des Hussitismus im Heiligen Römischen Reich und seinen Auswirkungen.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf den Brief von Peter Bruneti und diskutiert die bestehende Forschungsliteratur zur "Krise des Spätmittelalters". Weitere Quellen werden im Text detailliert aufgeführt (z.B. "Reformatio Sigismundi", die Schriften des "Oberrheinischen Revolutionärs", der Inquisitionsprozess gegen Johannes Drändorf).
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zielt darauf ab, die komplexen Ursachen des Wormser Bauernaufstandes aufzuzeigen, indem sie sozioökonomische, soziale und religiöse Faktoren berücksichtigt und den Einfluss hussitischer Ideen analysiert. Die genauen Schlussfolgerungen sind im Text selbst dargelegt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wormser Bauernaufstand 1431/32, Jan Hus, Hussitismus, Reichskrise, Spätmittelalter, Agrarkrise, soziale Unruhen, religiöse Bewegungen, Pfaffenhass, Antisemitismus, Sozioökonomie, Reformationsgeschichte.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum gedacht, das sich für die Geschichte des Spätmittelalters, den Bauernkriegen, den Hussitismus und die sozioökonomischen Bedingungen des 15. Jahrhunderts interessiert.
- Citation du texte
- Arian Sahitolli (Auteur), 2015, Politik und Religion. Zur Rezeptions- und Wirkungsgeschichte der Ideen von Jan Hus im Südwesten des Reiches, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/315465