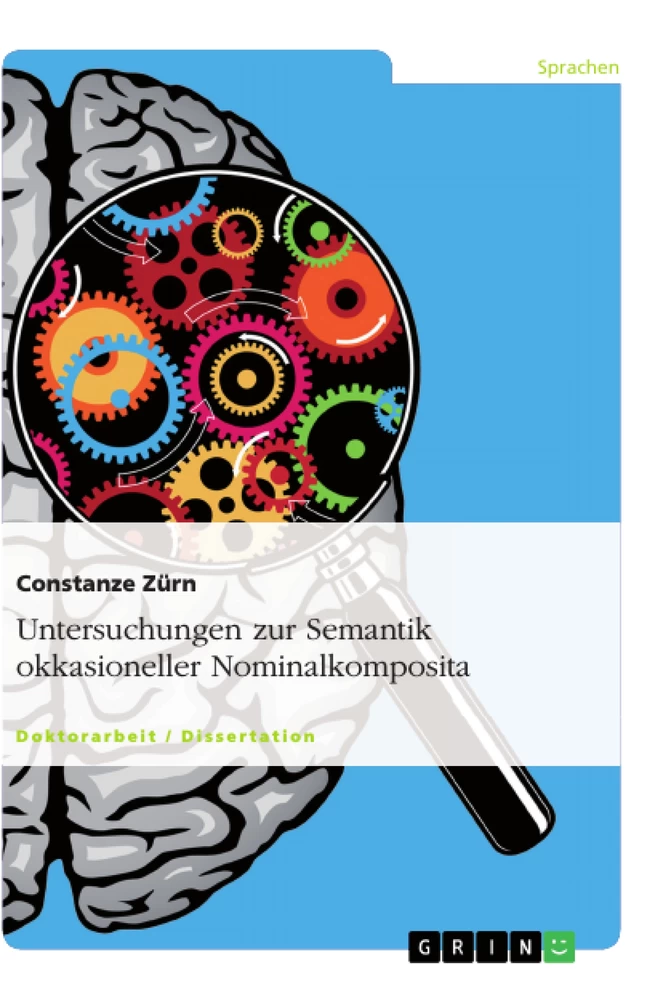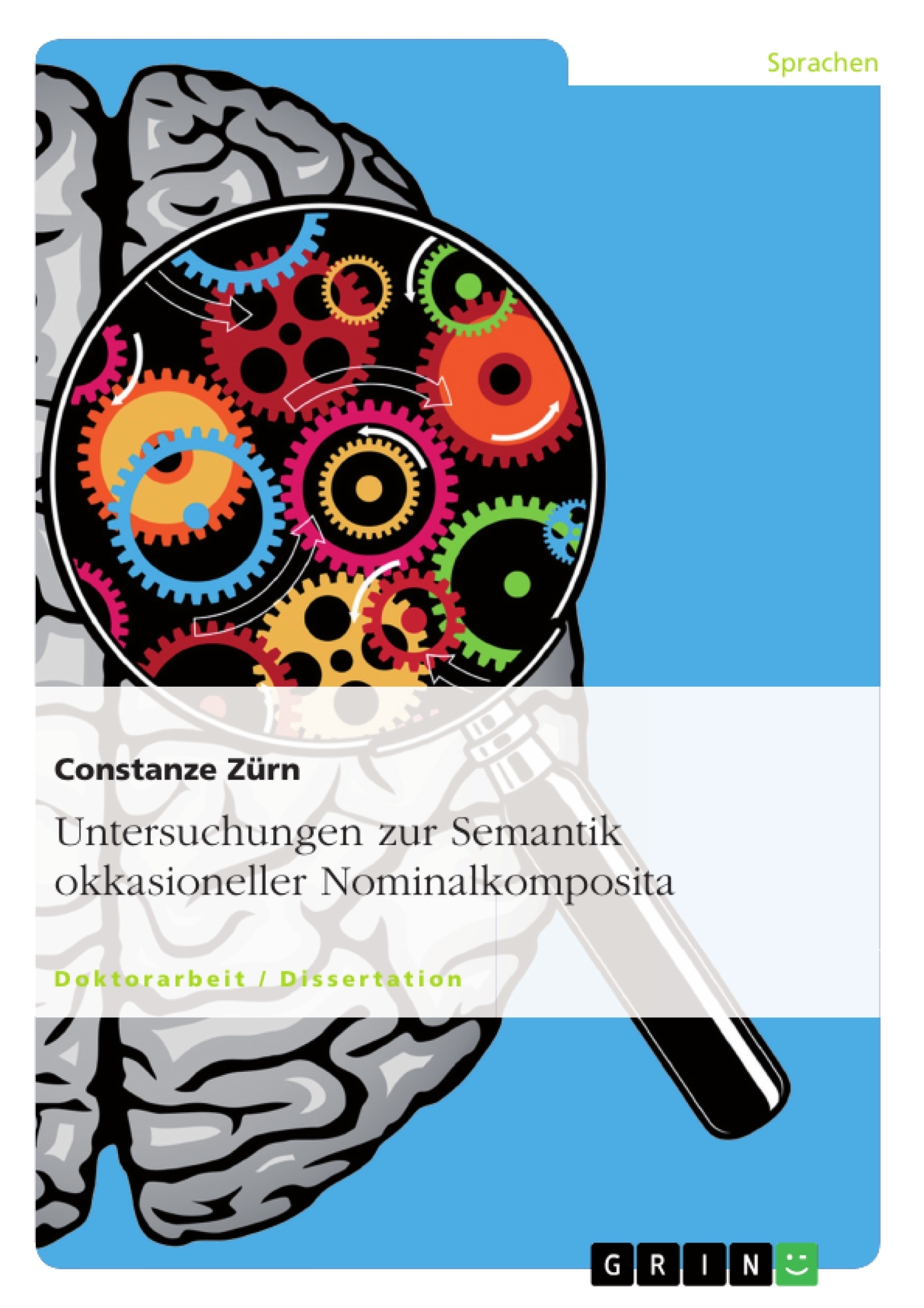Die Autorin zeigt, dass eine Vielzahl okkasioneller Komposita – entgegen der traditionellen Forschungsmeinung – auch ohne Kontextinformationen eindeutig erschließbar sind. Den Faktor, den sie für diese eindeutige Erschließbarkeit annimmt, betrifft die Konvergenz der Konzepte. Konzeptkonvergenz beschreibt sie als ein semantisches Beziehungsverhältnis der Kompositakonstituenten. Dieses Beziehungsverhältnis bildet sich durch rekurrentes Miteinanderauftreten sprachlicher Einheiten in ähnlichen Kontexten heraus.
Traditionell erklärt die Wortbildungsforschung die Präferenz einer bestimmten Interpretation für ein Kompositum in erster Linie mit dem Faktor der Usualisierung. Vereinfacht heißt das: Wird eine sprachliche Einheit in mehreren Gebrauchssituationen immer gleich interpretiert, wird diese Bedeutung mental gespeichert. Zuvor sind diverse Interpretationen durch verschiedene Relationen zwischen den Konstituenten möglich. Die Wortbildungsforschung weist deshalb häufig auf die hohe Diversität der Interpretationen hin, die bei einigen okkasionellen Komposita zu beobachten ist. Eine Vielzahl ähnlich guter Interpretationen für ein Kompositum würde jedoch einen enorm hohen kognitiven Aufwand bedeuten. Eine derart geringe Effizienz spräche daher gegen die sehr hohe Produktivität der Komposition in der deutschen Sprache.
Durch die Differenzierung der Konzepttypen zeigt die Autorin auf, dass Komposita semantisch weit transparenter und effizienter sind, als bisher angenommen.
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel 1 Beobachtungen und Zielsetzung
- 1.1 Einleitung
- 1.2 Gegenstand der Arbeit
- 1.2.1 Präferierte Interpretationen – ein Selbstversuch
- 1.2.2 Präferierte Interpretationen und Konzeptkonvergenz
- 1.2.3 Konvergenz und Divergenz der Konzepte
- 1.3 Zielsetzung und Thesen
- 1.4 Aufbau der Arbeit
- Kapitel 2 Die Analyseeinheit »Kompositum«
- 2.1 Einleitung
- 2.2 Konkurrenz zwischen Phrase, Kompositum und Suffix
- 2.2.1 Kompositum vs. Derivation
- 2.2.2 Kompositum vs. Phrase
- 2.3 Eigenschaften des Kompositums
- 2.3.1 Strukturelle Beschaffenheit der Komposita
- 2.3.2 Verbindung der Konstituenten
- 2.3.3 Semantische Beziehungsverhältnisse der Konzepte
- 2.4 Komposita und ihre mentale Repräsentation
- 2.4.1 Mentale Repräsentation und Verarbeitung sprachlicher Einheiten
- 2.4.2 Mentale Repräsentation und Verarbeitung von Komposita
- 2.4.3 Aufschluss über Wissenstrukturen aus Texten
- 2.4.4 Kookkurrenzen als Analysetool konzeptueller Konvergenz
- 2.5 Zusammenfassung
- Kapitel 3 Daten und Experimente
- 3.1 Überblick
- 3.2 Die These der Konzeptkonvergenz
- 3.3 Eigenschaften und Generierung der Testitems
- 3.3.1 Anforderungsprofil der Konstituenten
- 3.3.2 Anforderungsprofil der Testitems
- 3.4 Explorative Phase
- 3.5 Erstes Experiment
- 3.5.1 Design
- 3.5.2 Versuchspersonen
- 3.5.3 Erwartungen
- 3.5.4 Auswertung und Interpretation der Daten
- 3.6 Zweites Experiment
- 3.6.1 Design
- 3.6.2 Versuchspersonen
- 3.6.3 Erwartungen
- 3.6.4 Beobachtungen und Interpretation der Daten
- 3.7 Drittes Experiment
- 3.7.1 Design
- 3.7.2 Versuchspersonen
- 3.7.3 Erwartungen
- 3.7.4 Auswertung und Interpretation der Daten
- 3.8 Diskussion und Zusammenfassung der Ergebnisse
- Kapitel 4 Präferierte Interpretationen
- 4.1 Überblick
- 4.2 Aspekte der Kompositainterpretation
- 4.3 Präferenz, Ökonomie und Konvenienz
- 4.4 PI-Modell
- 4.4.1 Hinführende Beobachtungen
- 4.4.2 Modellkomponenten
- 4.4.3 Konvergente Konzepte
- 4.4.5 Divergente Konzepte
- 4.4.6 Konzeptkonvergenz und Effizienz
- 4.5 Zusammenfassung
- Kapitel 5 Zusammenfassung und Ausblick
- 5.1 Überblick
- 5.2 Erkenntnisse
- 5.2.1 Effizienz und Normalwerte
- 5.2.2 Ineffizienz und Abweichungen vom Normalwert
- 5.2.3 Rückschlüsse auf Wissensordnungen und das Mentale Lexikon
- 5.3 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Einfluss der Konzeptkonvergenz auf die Interpretation okkasioneller Nominalkomposita. Ziel ist es, ein Modell zu entwickeln, das erklärt, warum manche Komposita leichter und eindeutiger interpretierbar sind als andere, auch ohne Kontextinformationen.
- Präferierte Interpretationen okkasioneller Komposita
- Konzeptkonvergenz und -divergenz
- Mentale Repräsentation und Verarbeitung von Komposita
- Einfluss von Frequenz und Usualisierung
- Entwicklung eines Modells zur Erklärung der Interpretationspräferenzen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 Beobachtungen und Zielsetzung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein und beschreibt die Ausgangshypothese, dass okkasionelle Komposita, deren Konstituenten konzeptuell konvergieren, leichter interpretierbar sind als solche mit divergenten Konzepten. Es werden Beispiele wie "Ampelmaut" und "Apfelgehör" vorgestellt, um die Problematik der Interpretationsvielfalt und die Notwendigkeit eines neuen Erklärungsmodells zu verdeutlichen. Das Kapitel beschreibt die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit.
Kapitel 2 Die Analyseeinheit »Kompositum«: Kapitel 2 beleuchtet die Eigenschaften von Komposita und deren Konkurrenz zu Phrasen und Derivationen. Es wird die strukturelle und semantische Komplexität von Komposita diskutiert, sowie die verschiedenen semantischen Relationen zwischen den Konstituenten. Ein Schwerpunkt liegt auf der mentalen Repräsentation und Verarbeitung von Komposita, wobei die Rolle des mentalen Lexikons und die Bedeutung von Frequenzeffekten hervorgehoben werden. Es wird eine Methode zur Analyse der Konzeptkonvergenz mittels Kookkurrenzanalyse vorgestellt.
Kapitel 3 Daten und Experimente: Dieses Kapitel beschreibt drei Experimente zur Überprüfung der Hypothese der Konzeptkonvergenz. Es werden die Methoden der freien Assoziation und der skalaren Bewertung von vorgegebenen Interpretationen verwendet. Die Ergebnisse zeigen, dass Komposita mit konvergenten Konzepten eine präferierte Interpretation ausbilden, während Komposita mit divergenten Konzepten eine größere Interpretationsvielfalt aufweisen. Die Experimente liefern Daten zu verschiedenen Strategien der Konzeptverbindung und deren Einfluss auf die Interpretation.
Schlüsselwörter
Okkasionelle Nominalkomposita, Konzeptkonvergenz, Konzeptdivergenz, Präferierte Interpretation, Mentales Lexikon, Wortbildung, Kookkurrenzanalyse, Interpretationsprozess, Sprachökonomie, PI-Modell.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Präferierte Interpretationen okkasioneller Nominalkomposita
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss der Konzeptkonvergenz auf die Interpretation okkasioneller Nominalkomposita. Das Hauptziel ist die Entwicklung eines Modells, das die unterschiedliche Interpretierbarkeit von Komposita erklärt, selbst ohne Kontextinformationen. Es wird untersucht, warum manche Komposita leichter und eindeutiger zu verstehen sind als andere.
Welche Konzepte werden in der Arbeit behandelt?
Zentrale Konzepte sind: präferierte Interpretationen okkasioneller Komposita, Konzeptkonvergenz und -divergenz, mentale Repräsentation und Verarbeitung von Komposita, Einfluss von Frequenz und Usualisierung, sowie die Entwicklung eines Modells zur Erklärung der Interpretationspräferenzen. Die Arbeit beleuchtet auch die strukturellen und semantischen Eigenschaften von Komposita im Vergleich zu Phrasen und Derivationen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel. Kapitel 1 führt in die Thematik ein und beschreibt die Forschungsfrage und die Methodik. Kapitel 2 behandelt die Analyseeinheit "Kompositum" detailliert, inklusive mentaler Repräsentation und Verarbeitung. Kapitel 3 beschreibt drei Experimente zur Überprüfung der Hypothese der Konzeptkonvergenz, mit Methoden wie freier Assoziation und skalarer Bewertung. Kapitel 4 präsentiert ein Modell (PI-Modell) zur Erklärung der Interpretationspräferenzen. Kapitel 5 fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschung.
Welche Experimente wurden durchgeführt?
Es wurden drei Experimente durchgeführt, um die Hypothese der Konzeptkonvergenz zu überprüfen. Die Experimente verwendeten Methoden der freien Assoziation und der skalaren Bewertung von Interpretationen. Die Ergebnisse zeigen, dass Komposita mit konvergenten Konzepten eine präferierte Interpretation ausbilden, im Gegensatz zu Komposita mit divergenten Konzepten, die eine größere Interpretationsvielfalt aufweisen.
Was ist das PI-Modell?
Das PI-Modell (Präferierte Interpretationen-Modell) ist ein in Kapitel 4 entwickeltes Modell, das die unterschiedlichen Interpretationspräferenzen von okkasionellen Komposita erklärt. Es berücksichtigt die Konzeptkonvergenz und -divergenz der Konstituenten und deren Einfluss auf die Leichtigkeit und Eindeutigkeit der Interpretation.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Okkasionelle Nominalkomposita, Konzeptkonvergenz, Konzeptdivergenz, Präferierte Interpretation, Mentales Lexikon, Wortbildung, Kookkurrenzanalyse, Interpretationsprozess, Sprachökonomie, PI-Modell.
Welche Rolle spielt die Konzeptkonvergenz?
Die Konzeptkonvergenz spielt eine zentrale Rolle. Die Hypothese ist, dass okkasionelle Komposita mit konvergenten Konzepten (d.h., deren Konstituenten semantisch eng zusammenhängen) leichter und eindeutiger interpretiert werden als Komposita mit divergenten Konzepten. Die Experimente wurden durchgeführt, um diese Hypothese zu überprüfen.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Arbeit?
Die Arbeit zeigt, dass die Konzeptkonvergenz einen signifikanten Einfluss auf die Interpretation von okkasionellen Nominalkomposita hat. Komposita mit konvergenten Konzepten weisen eine präferierte Interpretation auf, während Komposita mit divergenten Konzepten zu einer größeren Interpretationsvielfalt führen. Das entwickelte PI-Modell bietet eine Erklärung für diese Befunde.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Linguisten, insbesondere im Bereich der Wortbildung und der semantischen Verarbeitung. Sie ist auch von Interesse für Kognitionswissenschaftler, die sich mit mentalen Repräsentationen und dem menschlichen Sprachverstehen befassen.
- Quote paper
- Constanze Zürn (Author), 2013, Untersuchungen zur Semantik okkasioneller Nominalkomposita, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/315486