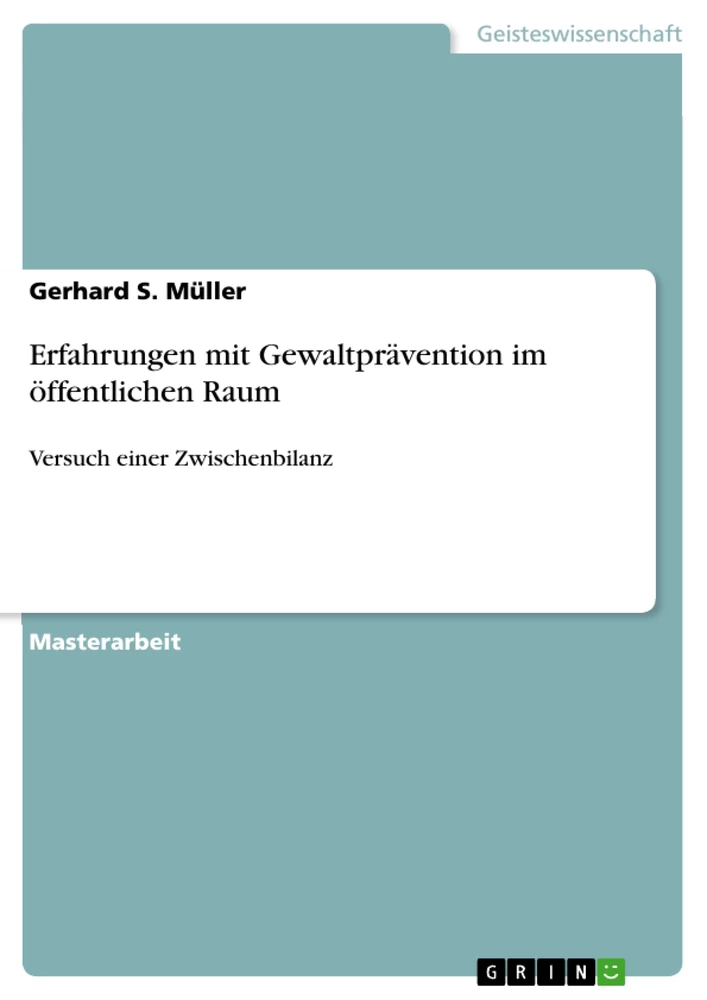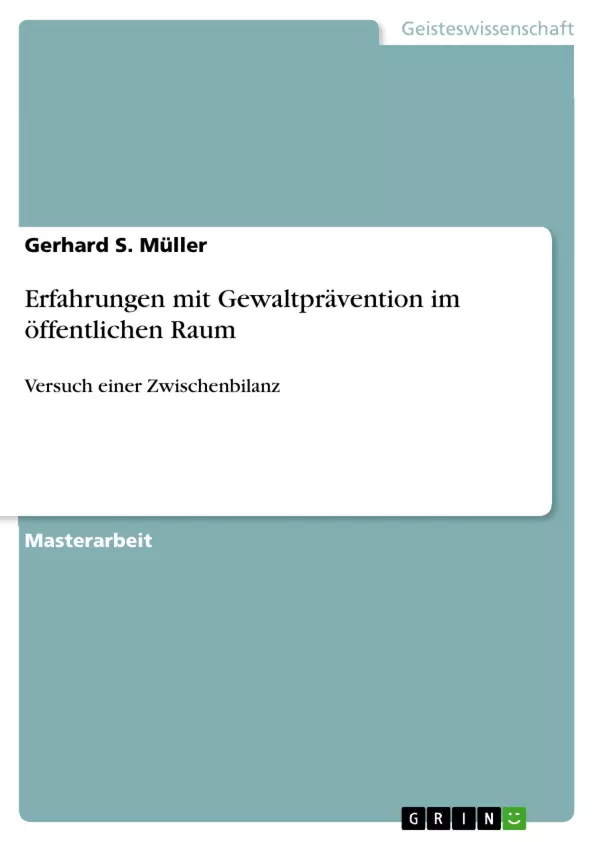Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen, Platzverweise und restriktivere Gesetze sind gängige Maßnahmen zur kommunalen Gewaltprävention. Die Erfahrungen mit formellen Eingriffen von Polizei, Städten und Kommunen zur Gewaltprävention und die möglichen Auswirkungen dieser Formalisierung im öffentlichen Raum auf die Betroffenen ist Thema dieser Arbeit.
Zuerst werden die Begrifflichkeiten geklärt, durch die Definitionen eine Abgrenzung vorgenommen und der Fokus deutlich gemacht.
In Kapitel 3 werden für das Thema relevante theoretische Grundlagen beleuchtet.
Im Hauptteil werden zuerst die Erfahrungen der verschiedenen Ansätze zur Gewaltprävention im öffentlichen Raum aufgezeigt. Der Fokus liegt auf den Maßnahmen der öffentlichen Hand. Außerdem werden die für die Gewaltprävention relevanten Erfahrungen der Polizei analysiert. Insbesondere wird eine Analyse der vorherrschenden Delikte, der Schwierigkeiten von privater und öffentlicher Sicherheit und Auswirkungen von Polizeipräsenz auf die Kriminalitätsfurcht der Bevölkerung vorgenommen.
In einem zweiten Teil werden die Erfahrungen in der kommunalen Gewaltprävention beleuchtet und die Veränderungen der Sicherheitslage durch Videoüberwachung, Stadtpolizeieinsätze, gesetzlich verankerte Alkoholverbote und die Vergabe hoheitlicher Aufgaben an private Sicherheitsleute, analysiert.
Es werden Auswirkungen auf die Gewalt im öffentlichen Raum ergründet. Insbesondere, ob es zu Verdrängungseffekte von speziellen Personengruppen oder räumliche Verlagerung der Gewaltdelikte durch initiierte Projekte und Maßnahmen kam.
In einem Exkurs wird eine Auswertung eines Printmediums über einen Zeitraum von 5 Monaten beschrieben und beleuchtet.
Im Abschlusskapitel wird aus den aufgezeigten Erfahrungen eine Zwischenbilanz gezogen und die Notwendigkeit von Anpassungen zukünftiger gewaltpräventiver Maßnahmen und Projekte diskutiert. Kriminalpräventive Maßnahmen werden häufig als Reaktion auf spezifische Problemgruppen oder bei einer Häufung von Deliktarten, installiert. Die Recherchen zeigten, dass die Evaluation der Auswirkungen und strukturellen Folgen von Maßnahmen, nur unzureichend vorgenommen werden.
Die vorhandenen Erfahrungen sollten genutzt werden, um zu prüfen, ob die installierten Präventionsansätze noch aktuell und passend sind oder in wieweit sich Deliktarten bzw. die Nutzung des öffentlichen Raumes, geändert haben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsklärungen
- 3. Theoretische Grundlagen
- 3.1 Psychologische Gewalttheorien
- 3.1.1 Frustrations-Aggressions-Theorie
- 3.1.2 Lerntheorie
- 3.2 Soziologische Gewalttheorien
- 3.2.1 Anomietheorie
- 3.2.2 Etikettierungstheorie
- 3.2.3 Theorie der sozialen Kontrolle
- 3.2.4 Erfahrungen der Perspektivlosigkeit
- 3.3 Ungleichheit und Gewalt
- 3.4 Kommunale Ansätze der Gewaltprävention
- 3.4.1 CEPTED – Crime Prevention through Environmental Design
- 3.4.2 ISIS und ISAN - Präventionsmodelle der integrierten Stadtgestaltung
- 3.4.3 Soziale Stadt
- 3.1 Psychologische Gewalttheorien
- 4. Erfahrungen im sozialräumlichen Sicherheits- und Kontrollmanagement
- 4.1 Gewaltpräventionserfahrungen der Polizei
- 4.1.1 Forschungsergebnisse der Polizeiprävention
- 4.1.2 Polizeipräsenz im öffentlichen Raum
- 4.1.3 Kriminalitätsfurcht und Sicherheit
- 4.1.4 Gewaltprävention in virtuellen Räumen
- 4.2 Präventionsansätze der Kommunen
- 4.2.1 Koordinationsstellen
- 4.2.2 Städtebauliche Präventionsmaßnahmen
- 4.2.3 Stärkung sozialer Kontrolle vs. formeller Kontrolle
- 4.2.4 Sozialarbeit
- 4.3 Gewaltpräventive Videoüberwachung
- 4.4 Erfahrungen aus verschiedenen Gewaltpräventionsprojekten
- 4.1 Gewaltpräventionserfahrungen der Polizei
- 5. Zwischenbilanz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Erfahrungen mit Gewaltprävention im öffentlichen Raum, insbesondere die Auswirkungen formeller Interventionen von Polizei und Kommunen. Die Zielsetzung besteht darin, eine Zwischenbilanz der bestehenden Maßnahmen zu ziehen und den Bedarf an Anpassungen zukünftiger Strategien zu evaluieren.
- Analyse formeller Gewaltpräventionsmaßnahmen (Polizei, Kommunen)
- Bewertung der Auswirkungen auf die Sicherheitslage im öffentlichen Raum
- Untersuchung von Verdrängungs- und Verlagerungseffekten von Gewalt
- Auswertung der Gewaltdarstellung in Printmedien im Vergleich zu Polizeistatistiken
- Diskussion der Notwendigkeit von Anpassungen zukünftiger Strategien
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Gewaltprävention im öffentlichen Raum ein und benennt den Fokus der Arbeit auf die Erfahrungen mit formellen Eingriffen von Polizei und Kommunen. Es wird die Notwendigkeit einer Zwischenbilanz und der Evaluation bestehender Maßnahmen hervorgehoben, um zukünftige Strategien zu optimieren. Die Klärung der Begrifflichkeiten von Gewaltarten und der Definition des öffentlichen Raums bildet den methodischen Rahmen der Untersuchung.
2. Begriffsklärungen: Dieses Kapitel widmet sich der präzisen Definition der verschiedenen Gewaltarten und des öffentlichen Raums. Durch die klare Abgrenzung der Begrifflichkeiten wird der Fokus der Arbeit festgelegt und eine Grundlage für die weitere Analyse geschaffen. Dies dient der Vermeidung von Missverständnissen und einer eindeutigen wissenschaftlichen Argumentation.
3. Theoretische Grundlagen: Das Kapitel beleuchtet die relevanten theoretischen Grundlagen aus Soziologie, Sozialpsychologie und Kriminalsoziologie. Es werden verschiedene Gewalttheorien (z.B. Frustrations-Aggressions-Theorie, Lerntheorie, Anomietheorie, Etikettierungstheorie, Theorie der sozialen Kontrolle) sowie integrierte kommunale Präventionsprogramme (CEPTED, ISIS, ISAN, Soziale Stadt) vorgestellt und in ihren jeweiligen Zusammenhängen erläutert. Dies bietet einen umfassenden theoretischen Rahmen für die Analyse der empirischen Erfahrungen im Folgenden.
4. Erfahrungen im sozialräumlichen Sicherheits- und Kontrollmanagement: Dieser Hauptteil analysiert die Erfahrungen verschiedener Akteure im Umgang mit Gewaltprävention. Im Mittelpunkt stehen die Maßnahmen der öffentlichen Hand (Kommunen und Polizei). Es werden die Erfahrungen der Polizei im Hinblick auf vorherrschende Delikte, Schwierigkeiten von privater und öffentlicher Sicherheit sowie Auswirkungen der Polizeipräsenz auf die Kriminalitätsfurcht analysiert. Der zweite Teil beleuchtet die kommunalen Präventionsansätze (Videoüberwachung, Stadtpolizeieinsätze, Alkoholverbote, private Sicherheitsdienste) und deren Auswirkungen auf die Gewalt im öffentlichen Raum. Es wird untersucht, ob Verdrängungs- oder Verlagerungseffekte aufgetreten sind. Ein Exkurs analysiert die Berichterstattung über Gewaltdelikte in Printmedien im Vergleich zu Polizeistatistiken.
Schlüsselwörter
Gewaltprävention, öffentlicher Raum, Polizei, Kommunen, formeller Kontrollansatz, soziale Kontrolle, Gewalttheorien, Kriminalität, Sicherheitsgefühl, Videoüberwachung, Präventionsprogramme, Verdrängungseffekte, Evaluierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Erfahrungen mit Gewaltprävention im öffentlichen Raum
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Erfahrungen mit Gewaltprävention im öffentlichen Raum, insbesondere die Auswirkungen formeller Interventionen von Polizei und Kommunen. Es wird eine Zwischenbilanz der bestehenden Maßnahmen gezogen und der Bedarf an Anpassungen zukünftiger Strategien evaluiert.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit analysiert formelle Gewaltpräventionsmaßnahmen von Polizei und Kommunen, bewertet deren Auswirkungen auf die Sicherheit im öffentlichen Raum, untersucht Verdrängungs- und Verlagerungseffekte von Gewalt, vergleicht die Gewaltdarstellung in Printmedien mit Polizeistatistiken und diskutiert die Notwendigkeit von Anpassungen zukünftiger Strategien.
Welche theoretischen Grundlagen werden herangezogen?
Die Arbeit stützt sich auf relevante Theorien aus Soziologie, Sozialpsychologie und Kriminalsoziologie. Es werden verschiedene Gewalttheorien (Frustrations-Aggressions-Theorie, Lerntheorie, Anomietheorie, Etikettierungstheorie, Theorie der sozialen Kontrolle) und kommunale Präventionsprogramme (CEPTED, ISIS, ISAN, Soziale Stadt) vorgestellt und erläutert.
Welche Akteure werden in der Analyse berücksichtigt?
Der Hauptteil analysiert die Erfahrungen der Polizei (Präventionsforschung, Polizeipräsenz, Kriminalitätsfurcht, Gewaltprävention in virtuellen Räumen) und der Kommunen (Koordinationsstellen, städtebauliche Maßnahmen, soziale Kontrolle, Sozialarbeit, Videoüberwachung). Es werden auch Erfahrungen aus verschiedenen Gewaltpräventionsprojekten einbezogen.
Wie werden die Daten erhoben und analysiert?
Die genaue Methodik zur Datenerhebung wird im Text nicht explizit genannt. Es wird jedoch auf einen Vergleich der Gewaltdarstellung in Printmedien mit Polizeistatistiken hingewiesen, was auf eine qualitative und quantitative Analyse hindeutet. Die Analyse der Erfahrungen verschiedener Akteure basiert wahrscheinlich auf Literaturrecherche, Experteninterviews oder Auswertung von Fallstudien.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht eine Zwischenbilanz der bestehenden Gewaltpräventionsmaßnahmen und evaluiert den Bedarf an Anpassungen zukünftiger Strategien. Konkrete Schlussfolgerungen und Empfehlungen werden im Kapitel „Zwischenbilanz“ und in der Diskussion der Notwendigkeit von Anpassungen zukünftiger Strategien zusammengefasst.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Gewaltprävention, öffentlicher Raum, Polizei, Kommunen, formeller Kontrollansatz, soziale Kontrolle, Gewalttheorien, Kriminalität, Sicherheitsgefühl, Videoüberwachung, Präventionsprogramme, Verdrängungseffekte, Evaluierung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Begriffsklärungen, Theoretische Grundlagen, Erfahrungen im sozialräumlichen Sicherheits- und Kontrollmanagement und Zwischenbilanz. Jedes Kapitel ist weiter unterteilt in Unterkapitel, die im Inhaltsverzeichnis detailliert aufgeführt sind.
- Citar trabajo
- Gerhard S. Müller (Autor), 2015, Erfahrungen mit Gewaltprävention im öffentlichen Raum, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/315494