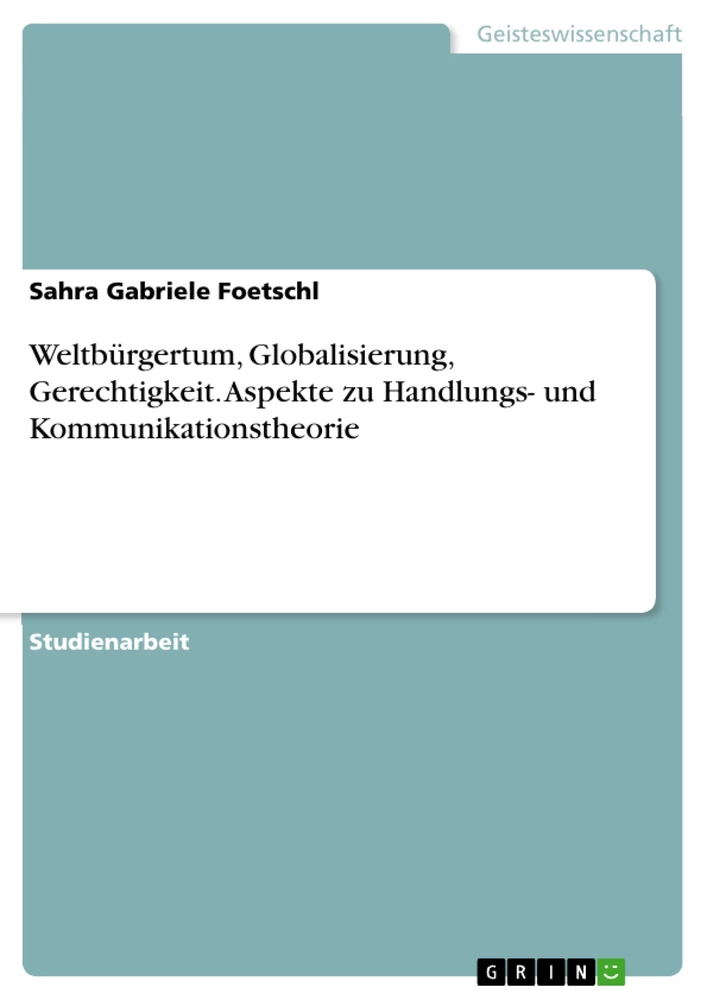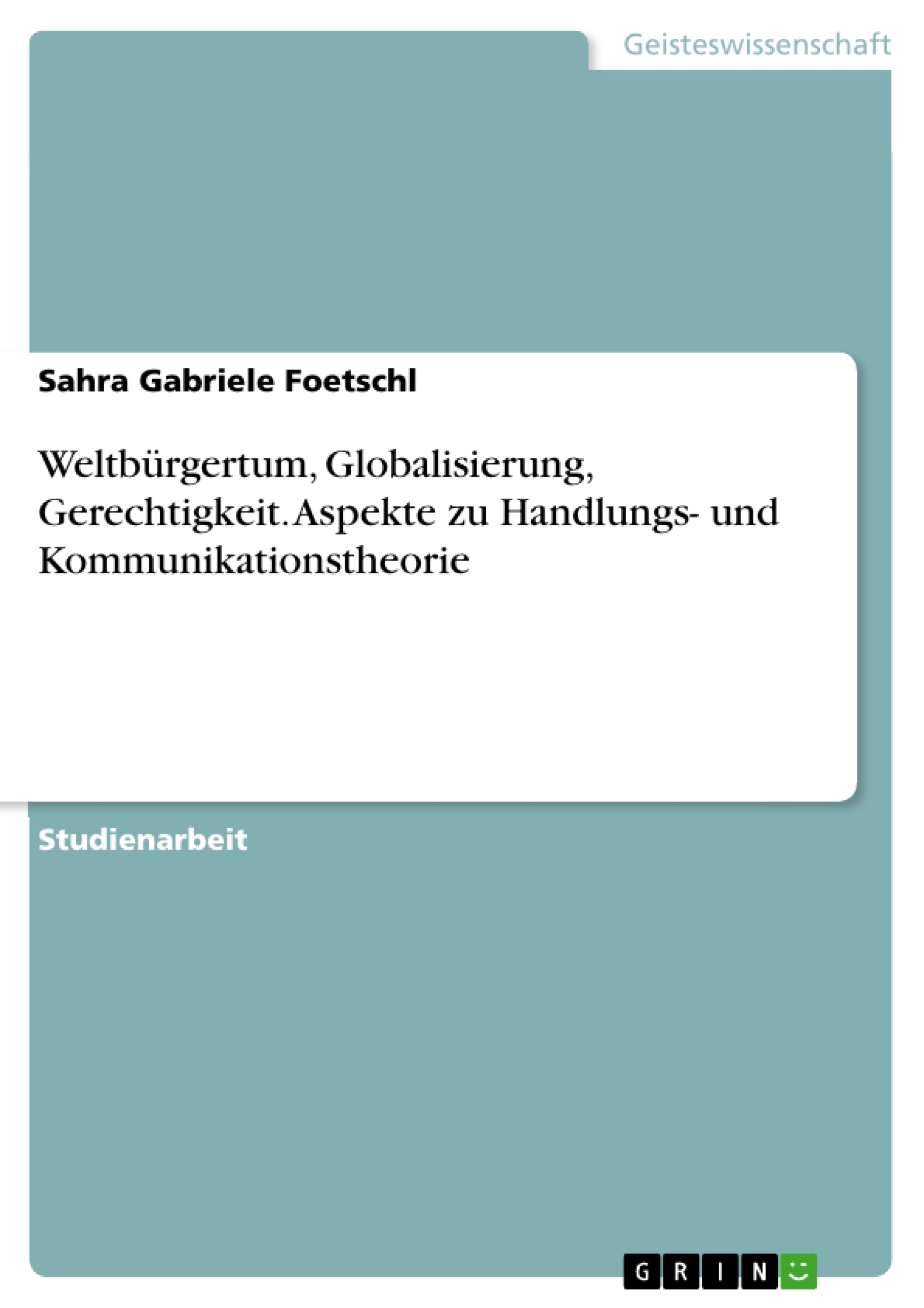Bereits im 19. Jahrhundert verändert sich der Umgang mit dem Begriff "Kosmopolitismus" und entfernt sich von Idealen, die in Zusammenhang mit Aufklärung und Humanismus noch modisch waren.
Infolge von kolonialpolitischen Kollateralschäden und nationalen Anspruchsdebatten verliert der schwärmerische Begriff, welcher Ende des Achtzehnten Jahrhunderts eine glückliche Fügung aller Menschen der Welt zu einem Ganzen zum Ziel versprach, an positiven Konnotationen und zu Beginn des Zwanzigsten Jahrhunderts motivieren erneute Nationalismen und bürgerlicher Patriotismus im universitären und intellektuellen Milieu Autoren zur Suche nach "Deutscher Physik" (Philip Lenard), "verite française" (Maurice Barres) und diversen "nationalen Wahrheiten", während Nationalstaaten wirtschaftlich expandieren und ihren Kolonien keine Konnektion untereinander ermöglichen beziehungsweise dies tunlichst verhindern.
Ethnologen beschäftigen sich mit Eurozentrismus, überdenken ethnologische Forschungsergebnisse neu und bewerten Humanismus u.a. auch als bürgerlich-kapitalistischen Deckmantel für Kolonialisierung.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Dörfliche Weltstädte oder Kosmopolitismus und "nil admirari"
- Kommunikation, Medien und globalisierte Mobilität
- Neue und alte Nationalismen, 1981 - 2005
- Gerechtigkeit, Gleichheitsgrundsatz, rechtliche Gleichbehandlung und Handlungstheorien
- Gleicher als das Klischee: Stereotype Propaganda
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Spannungsfeld zwischen Weltbürgertum, Globalisierung und Gerechtigkeit. Sie analysiert Aspekte von Handlungs- und Kommunikationstheorie und untersucht, wie diese Theorien im Kontext der Globalisierung zum Tragen kommen.
- Der Wandel des Begriffs „Kosmopolitismus“ und seine Bedeutungsverschiebung im Laufe der Geschichte
- Die Rolle von Kommunikation und Medien in der globalisierten Welt
- Die Herausforderungen des Nationalismus und seine Interaktion mit der Globalisierung
- Die Frage der Gerechtigkeit im Kontext der Globalisierung
- Die Bedeutung von Stereotypen in der globalen Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Das erste Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Begriffs „Kosmopolitismus“ und seine Umdeutung im Kontext der Nationalisierungsprozesse. Es zeigt, wie der einst idealistische Begriff zunehmend mit negativen Konnotationen belegt wurde und zum Synonym für „Allerweltsmensch“ oder „Heimatloser“ wurde.
- Das zweite Kapitel befasst sich mit der Rolle von Kommunikation und Medien in der globalisierten Welt. Es analysiert die Möglichkeiten und Herausforderungen, die durch die Digitalisierung und die zunehmende Mobilität entstanden sind.
- Das dritte Kapitel analysiert den Aufstieg neuer und alter Nationalismen im Zeitraum von 1981 bis 2005 und untersucht, wie diese mit der Globalisierung interagieren.
- Das vierte Kapitel untersucht die Frage der Gerechtigkeit und Gleichheit im Kontext der Globalisierung. Es beleuchtet verschiedene Handlungstheorien und ihre Relevanz für die globale Gerechtigkeit.
- Das fünfte Kapitel befasst sich mit der Bedeutung von Stereotypen in der globalen Kommunikation. Es analysiert, wie Stereotype zur Propaganda genutzt werden und welche Folgen dies für die interkulturelle Verständigung hat.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokus-Themen der Seminararbeit sind: Weltbürgertum, Globalisierung, Gerechtigkeit, Kommunikationstheorie, Handlungstheorie, Nationalismus, Kosmopolitismus, Stereotype, Propaganda, Medien, Mobilität.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich der Begriff "Kosmopolitismus" gewandelt?
Vom idealistischen Humanismus der Aufklärung verschob sich der Begriff im 20. Jahrhundert hin zu negativen Konnotationen wie "Heimatlosigkeit" aufgrund erstarkender Nationalismen.
Welche Rolle spielen Medien in der globalisierten Welt?
Medien und digitale Kommunikation ermöglichen eine globale Vernetzung, werfen aber auch Fragen nach der Machtverteilung und der Verbreitung von Stereotypen auf.
Wie hängen Globalisierung und Gerechtigkeit zusammen?
Die Arbeit untersucht, wie rechtliche Gleichbehandlung und Gerechtigkeit in einer Welt voller nationaler Eigeninteressen und wirtschaftlicher Expansion realisiert werden können.
Was ist "Stereotype Propaganda" im globalen Kontext?
Es beschreibt die Nutzung von Klischees und Vorurteilen in der Kommunikation, um nationale Identitäten abzugrenzen oder politische Ziele zu verfolgen.
Was kritisiert die Ethnologie am klassischen Humanismus?
Ethnologen bewerten den Humanismus teils kritisch als bürgerlich-kapitalistischen Deckmantel, der zur Rechtfertigung der Kolonialisierung diente.
- Citar trabajo
- Sahra Gabriele Foetschl (Autor), 2013, Weltbürgertum, Globalisierung, Gerechtigkeit. Aspekte zu Handlungs- und Kommunikationstheorie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/315520