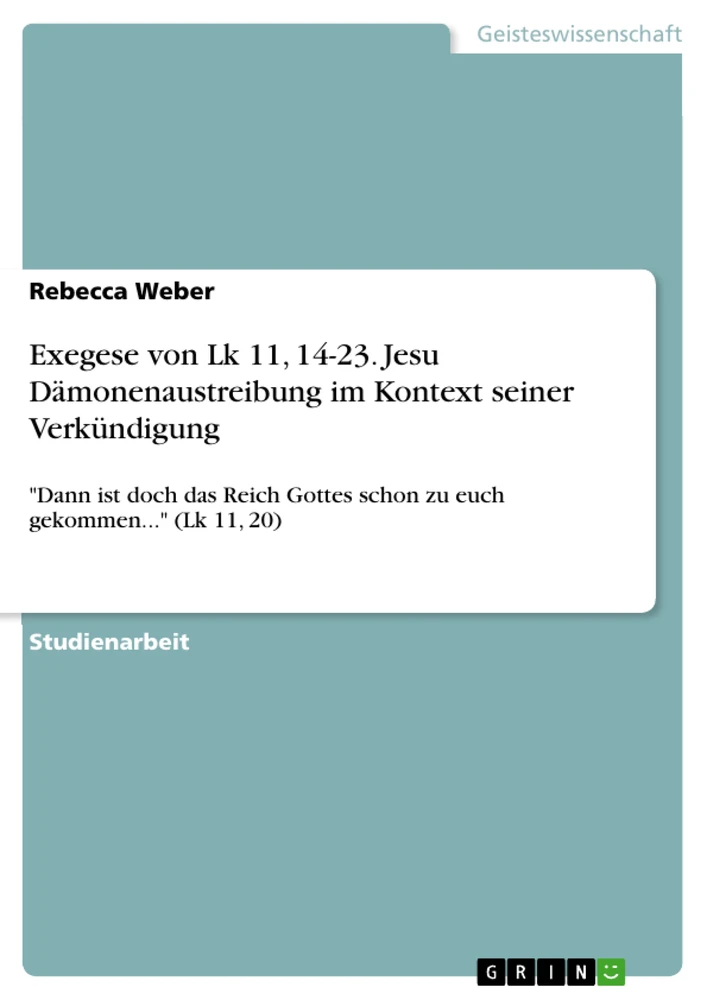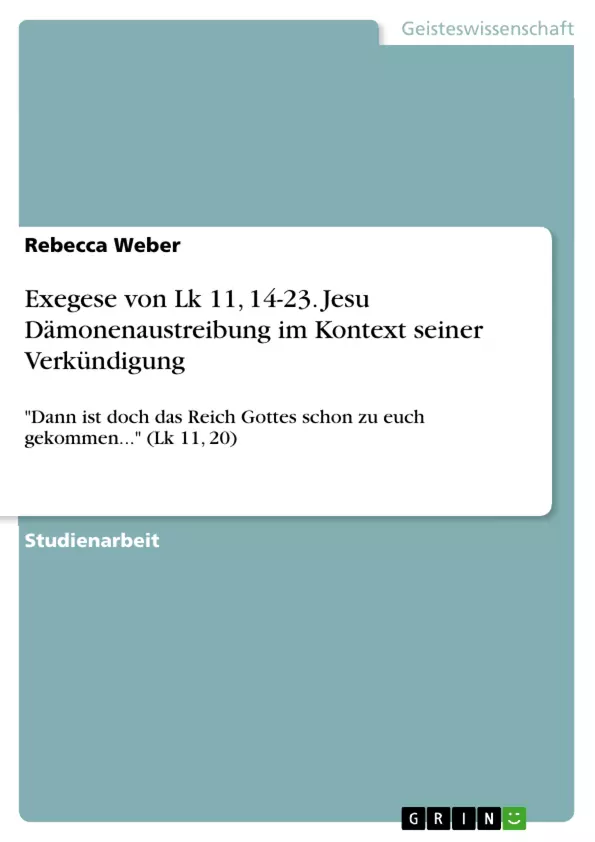In der vorliegenden Hausarbeit soll die Bedeutung der Perikope Lk 11,14-23 im Kontext der Reich-Gottes-Botschaft Jesu herausgearbeitet werden, da diese Perikope im Rahmen des dritten Evangeliums weitreichende Schlüsse auf die Bedeutung und den Zeichencharakter von Jesu heilenden und exorzistischen Taten zulässt. Neben dem befreienden und auf das Reich Gottes verweisenden Aspekt steht hier – eingebunden in den lukanischen Reisebericht – der Zeitpunkt des Eintreffens des erwarteten Reiches Gottes im Vordergrund sowie die Frage nach der Vollmacht Jesu angesichts der Beelzebul-Vorwürfe, mit denen ihn seine Gegner konfrontieren.
Zunächst sollen wesentliche vorbereitende Schritte der folgenden Auslegung auf der synchronen und der diachronen Ebene durchgeführt werden. Nach der Textabgrenzung und textkritischen Beobachtungen soll eine eigene - möglichst nah am griechischen Text gehaltene und nicht vorrangig nach stilistischen bzw. rezeptionsorientierten Kriterien gestaltete - Übersetzung als Folie dienen, auf der verschiedene deutsche Bibelübersetzungen miteinander verglichen werden können. Nach der Darstellung einer möglichen Gliederung des Textes in Sinneinheiten und der Einordnung in den Kontext des Lukasevangeliums werde ich in der synchronen Textanalyse die Perikope nach syntaktisch-semantischen bzw. pragmatischen Gesichtspunkten untersuchen, wobei auch die Frage nach der Gattungszuordnung gestellt wird. In der diachronen Analyse werden zum einen die soziokulturellen bzw. religiösen Hintergründe der Perikope beleuchtet, bevor im Zuge der Literarkritik ein synoptischer Vergleich durchzuführen ist.
Da jeder biblische Text - wie überhaupt jeder Text - in eine bestimmte historische Kommunikationssituation eingebunden ist und hinter ihm bestimmte Intentionen des Autors zu vermuten sind, soll der Sitz im Leben der Perikope im Hinblick auf die lukanische Gemeinde kurz erörtert werden, bevor die theologischen Schwerpunkte, die in den betreffenden Versen zum Ausdruck kommen, charakterisiert werden.
Abschließend werde ich versuchen, die bleibende Bedeutung der behandelten Perikope im Besonderen wie die Bedeutung des exorzistischen bzw. heilenden Handelns Jesu im Allgemeinen zu formulieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorüberlegungen zum Wunderbegriff in Geschichte und Gegenwart
- Zur Exegese von Lk 11,14-23
- Textabgrenzung
- Textkritik
- Übersetzung der Perikope Lk 11,14-23
- Textauflistung - Gliederung des Textes in Sinneinheiten
- Vergleich der Übersetzungen Einheitsübersetzung - Lutherbibel - revidierte Elberfelder Bibel
- Zur Situierung der Perikope im Kontext des Lukasevangeliums
- Synchrone Textanalyse
- Situationsanalyse
- Schauplatz und Zeit
- Personenkonstellation
- Semantische Analyse
- Leitmotive und Schlüsselbegriffe
- Beobachtungen zur Syntax und zum Tempusgebrauch
- Erzählstruktur
- Zur Erzählsituation
- Pragmatische Untersuchung
- Struktur und Argumentationsgang der Verteidigungsrede Jesu
- Gattungsgeschichtliche Untersuchung
- Situationsanalyse
- Diachrone Analyse
- Religiöser und soziokultureller Hintergrund
- Konzepte von Krankheit und Gesundheit - Dämonenglaube in Israel zur Entstehungszeit der Evangelien
- Charakteristika des Exorzismus in Abgrenzung von der Heilung
- Jesus und die Wunderheiler seiner Zeit
- Synoptischer Vergleich
- Redaktionsgeschichte
- Der „Sitz im Leben“
- Religiöser und soziokultureller Hintergrund
- Lk 11,14-23 im Kontext der lukanischen Theologie
- Jesu befreiendes Wirken
- Die Frage nach der Vollmacht
- Die eschatologische Dimension von Lk 11,14-23
- Eine Entscheidung ist unausweichlich - der Ruf zur Nachfolge
- Ausblick: Der existenzielle Sinn der Perikope Lk 11,14-26
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung der Perikope Lk 11,14-23 im Kontext der Reich-Gottes-Botschaft Jesu. Sie analysiert die Perikope, um weitreichende Schlüsse auf die Bedeutung und den Zeichencharakter von Jesu heilenden und exorzistischen Taten zu ziehen. Ein Fokus liegt auf dem befreienden Aspekt und dem Verweis auf das Reich Gottes, sowie auf den Zeitpunkt des Eintreffens dieses Reiches und die Frage nach der Vollmacht Jesu angesichts der Beelzebul-Vorwürfe.
- Die Bedeutung von Jesu Exorzismen im Kontext seiner Verkündigung
- Der Wunderbegriff in Geschichte und Gegenwart und seine Relevanz für die Interpretation der Perikope
- Die soziokulturellen und religiösen Hintergründe der Perikope im ersten Jahrhundert
- Die synchrone und diachrone Analyse der Perikope Lk 11,14-23
- Die Einbettung der Perikope in die lukanische Theologie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert die Bedeutung von Jesu Exorzismen in der historischen Jesusforschung. Sie hebt die Relevanz der Perikope Lk 11,14-23 für das Verständnis der Reich-Gottes-Botschaft hervor und skizziert den Aufbau der Arbeit. Der Fokus liegt auf der herausarbeitung der Bedeutung der Perikope und deren Zeichencharakter für Jesu Wirken. Die Einleitung legt bereits den Schwerpunkt auf die Auseinandersetzung mit dem Wunderbegriff in verschiedenen historischen Kontexten und deutet die Notwendigkeit einer zeitgeschichtlichen Einordnung der Perikope an.
Vorüberlegungen zum Wunderbegriff in Geschichte und Gegenwart: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Perspektiven auf den Wunderbegriff im Laufe der Geschichte. Es wird zwischen dem Wunder als Offenbarung Gottes und dem Wunder als außergewöhnliches Ereignis unterschieden. Der Wandel des Wunderverständnisses im Christentum wird diskutiert, wobei die rationalistischen Deutungen und die redaktionsgeschichtliche Relativierung von Wundern im modernen Kontext angesprochen werden. Das Kapitel hebt das unterschiedliche Verständnis von Wundern im Israel des ersten Jahrhunderts hervor und betont, dass die Interpretation der Wundererzählungen ein Verständnis des jeweiligen historischen und kulturellen Kontextes erfordert.
Zur Exegese von Lk 11,14-23: Dieses Kapitel befasst sich mit der detaillierten exegetischen Analyse der Perikope Lk 11,14-23. Es umfasst die Textabgrenzung, Textkritik, Übersetzung und Gliederung des Textes in Sinneinheiten. Es wird ein Vergleich verschiedener Bibelübersetzungen durchgeführt und die Perikope im Kontext des Lukasevangeliums eingeordnet. Dieser Abschnitt legt das Fundament für die folgenden synchronen und diachronen Analysen, indem er eine solide textliche Basis schafft und die verschiedenen Interpretationsschritte detailliert darlegt.
Synchrone Textanalyse: Die synchrone Textanalyse untersucht die Perikope Lk 11,14-23 unter verschiedenen Gesichtspunkten. Sie analysiert die Situation, die beteiligten Personen, die semantische Struktur mit Leitmotiven und Schlüsselbegriffen, sowie die Syntax und den Tempusgebrauch. Die Erzählstruktur und -situation werden beleuchtet, ebenso wie die pragmatische Untersuchung der Argumentation Jesu. Abschließend wird die gattungsgeschichtliche Einordnung der Perikope betrachtet. Dieses Kapitel bietet eine umfassende, interne Analyse des Textes, die verschiedene Ebenen der Bedeutung und Struktur berücksichtigt.
Diachrone Analyse: Die diachrone Analyse befasst sich mit dem historischen und kulturellen Kontext der Perikope. Sie untersucht den religiösen und soziokulturellen Hintergrund, insbesondere die Konzepte von Krankheit und Gesundheit, den Dämonenglauben und den Exorzismus zur Zeit Jesu. Ein synoptischer Vergleich mit parallelen Texten in anderen Evangelien wird durchgeführt, und die Redaktionsgeschichte sowie der „Sitz im Leben“ der Perikope werden diskutiert. Dieses Kapitel bietet ein umfassendes Verständnis des historischen Kontextes, das für die Interpretation der Perikope unerlässlich ist.
Lk 11,14-23 im Kontext der lukanischen Theologie: Dieses Kapitel analysiert die Perikope im Lichte der lukanischen Theologie. Es beleuchtet Jesu befreiendes Wirken, die Frage nach seiner Vollmacht angesichts der Beelzebul-Vorwürfe, die eschatologische Dimension und den Ruf zur Nachfolge. Das Kapitel integriert die vorherigen Analysen und präsentiert eine theologische Interpretation der Perikope innerhalb des lukanischen Gesamtwerks. Der Fokus liegt auf der systematischen Einordnung der Perikope in den größeren thematischen Zusammenhang des Lukas Evangeliums.
Schlüsselwörter
Lk 11,14-23, Exorzismus, Heilung, Wunder, Reich Gottes, Beelzebul, lukanische Theologie, synoptische Evangelien, historischer Jesus, soziokultureller Kontext, Wunderbegriff, Exegese, Textanalyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Exegese von Lk 11,14-23
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Perikope Lukas 11,14-23, die von Jesu Exorzismen und Heilungen handelt, im Kontext der Reich-Gottes-Botschaft. Sie untersucht die Bedeutung und den Zeichencharakter von Jesu Taten, den befreienden Aspekt, den Bezug zum Reich Gottes, den Zeitpunkt seines Eintreffens und die Frage nach Jesu Vollmacht angesichts der Beelzebul-Vorwürfe.
Welche Aspekte werden in der Analyse berücksichtigt?
Die Analyse umfasst verschiedene methodische Ansätze: Eine detaillierte Exegese (Textabgrenzung, Textkritik, Übersetzung, Vergleich verschiedener Bibelübersetzungen), synchrone Textanalyse (Situationsanalyse, semantische Analyse, Syntax, Erzählstruktur, Pragmatik, Gattungsgeschichte) und diachrone Analyse (religiöser und soziokultureller Hintergrund, synoptischer Vergleich, Redaktionsgeschichte, „Sitz im Leben“). Die Arbeit integriert die Ergebnisse in eine theologische Interpretation im Kontext der lukanischen Theologie.
Wie wird der Wunderbegriff behandelt?
Die Arbeit untersucht den Wunderbegriff in Geschichte und Gegenwart, unterscheidet zwischen Wunder als Offenbarung Gottes und außergewöhnlichem Ereignis und diskutiert den Wandel des Wunderverständnisses im Christentum, einschließlich rationalistischer Deutungen und redaktionsgeschichtlicher Relativierungen. Sie betont die Bedeutung des historischen und kulturellen Kontextes für die Interpretation von Wundererzählungen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Vorüberlegungen zum Wunderbegriff, Exegese von Lk 11,14-23, Synchrone Textanalyse, Diachrone Analyse, Lk 11,14-23 im Kontext der lukanischen Theologie und Ausblick. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Perikope und ihrer Interpretation.
Welche Schlüsselthemen werden behandelt?
Schlüsselthemen sind der Exorzismus, Heilung, Wunder, das Reich Gottes, Beelzebul, die lukanische Theologie, die synoptischen Evangelien, der historische Jesus, der soziokulturelle Kontext, der Wunderbegriff, Exegese und Textanalyse.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Bedeutung der Perikope Lk 11,14-23 im Kontext der Reich-Gottes-Botschaft Jesu zu erforschen und weitreichende Schlüsse auf die Bedeutung und den Zeichencharakter von Jesu heilenden und exorzistischen Taten zu ziehen.
Wie wird der Kontext des Lukasevangeliums berücksichtigt?
Die Perikope wird sowohl im unmittelbaren Kontext des Lukasevangeliums als auch im grösseren Zusammenhang der lukanischen Theologie eingeordnet. Die Arbeit untersucht, wie die Perikope zu den zentralen theologischen Themen des Lukas Evangeliums beiträgt.
Welche Methoden der Textanalyse werden verwendet?
Die Arbeit verwendet sowohl exegetische als auch historisch-kritische Methoden. Dies beinhaltet die genaue Textanalyse, den Vergleich mit anderen Stellen im Neuen Testament, die Untersuchung des historischen und kulturellen Hintergrunds und die Einordnung in die lukanische Theologie.
- Arbeit zitieren
- Rebecca Weber (Autor:in), 2008, Exegese von Lk 11, 14-23. Jesu Dämonenaustreibung im Kontext seiner Verkündigung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/315531