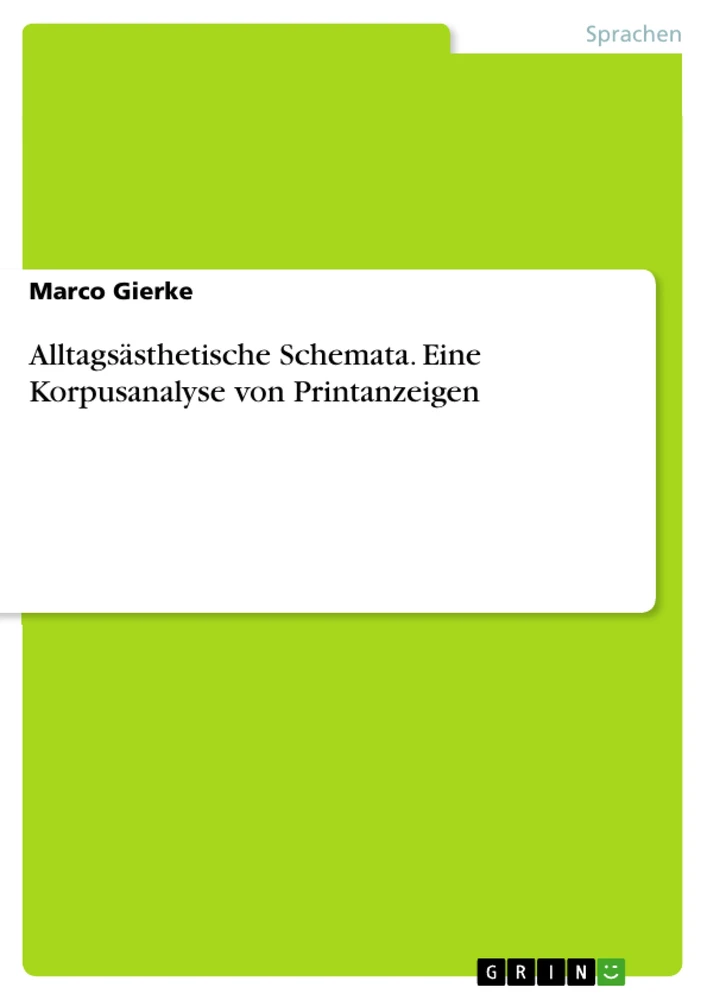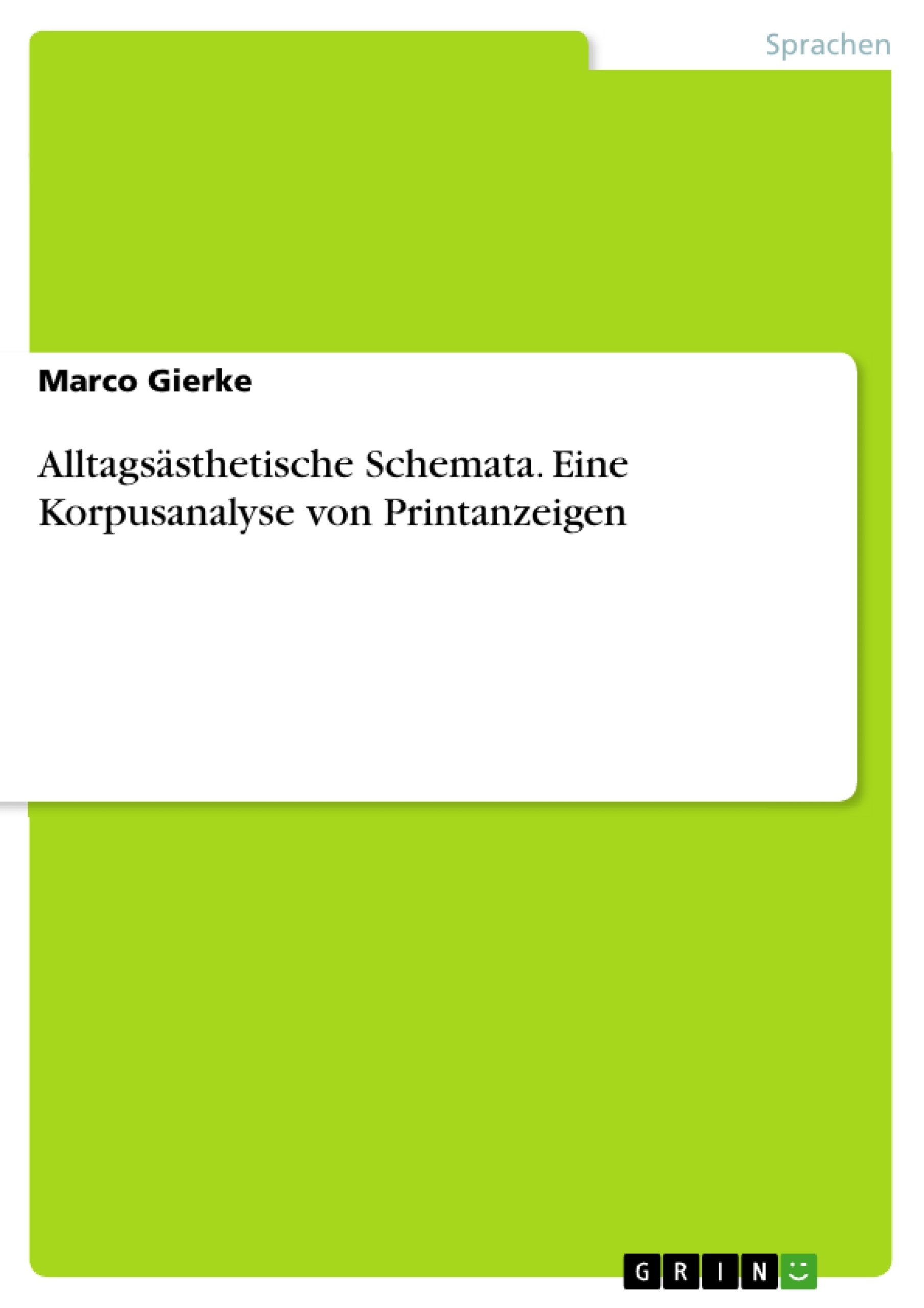Wer für sein Produkt werben möchte, sollte wissen, für wen sein Produkt sein soll. Die Behauptung, Werbung könne nicht funktionieren, wenn sie an die falsche Zielgruppe gerichtet ist, scheint zunächst trivial. Trotz der Offensichtlichkeit dieses Zusammenhanges bringt diese Erkenntnis wesentliche Fragen für die Werbemacher mit sich: Für wen ist mein Produkt und wie spreche ich diese Käufergruppe gezielt an? Dieser Überlegung sind zwei wesentliche Annahmen inhärent. Erstens, die Gesellschaft ist unterteilt in distinktive Großgruppen, zweitens, sind diese gesellschaftlichen Großgruppen anhand spezifischer Charakteristika unterscheidbar und entsprechend über spezifische Elemente ansprechbar.
Einen Vorschlag für eine solche Unterteilung der Gesellschaft bietet Schulze mit seinem Modell der alltagsästhetischen Schemata. Die theoretische Fundierung dieses Modells soll in dieser Arbeit zwar nicht thematisiert werden, trotzdem sollte eine wesentliche Annahme an dieser Stelle erneut explizit gemacht werden, da sie für die folgenden Ausführungen von zentraler Bedeutung sein wird. Mit der Überwindung materieller Grundbedürfnisse entstehe Erlebnisgesellschaft mit „[i]nnenorientierte[n] Lebensauffassungen“ (Schulze 2005, 35), in welcher das Individuum durch seine Konsumentscheidungen intendiert, positive subjektive Prozesse auszulösen. Produktnachfrager werden demnach zu „Erlebnisnachfragern“ (Schulze 2005, 132). Innerhalb dieser neuen Erlebnisgesellschaft sei vor allem die distinktive Bedeutungsebene des Genusses zentral, welche in dieser Arbeit entsprechend hervorgehoben wird.
Inwieweit Schulzes Kategorien Hochkulturschema, Trivialschema und Spannungsschema es ermöglichen, „ästhetische Zeichengruppen“ (Schulze 2005, 133) zu identifizieren und konturieren, ist die Forschungsfrage dieser Arbeit. Umgesetzt wird diese in einer Analyse von Bierwerbungen und dem Versuch der Einteilung dieser Printanzeigen in die genannten Kategorien. Bier als Produkt ist für dieses Anliegen doppelt prädestiniert: Zum Einen ist es nicht lebensnotwendig und als Konsumgut entsprechend deutlich einer postmaterialistischen Gesellschaft zuzuordnen – auch wenn an dieser Stelle vermutlich Stimmen der Allgemeinheit widersprechen würden – zum Anderen liegt anhand seiner Rezeption durch die Geschmacksnerven die Bedeutungsebene des Genusses äußerst nahe, weshalb eine Unterscheidung anhand des suggerierten Genussschemas plausibel erscheint.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Einteilung
- 2.1 Hochkulturschema (I)
- 2.2 Trivialschema (II)
- 2.3 Spannungsschema (III)
- 3. Fazit: Die Anwendbarkeit der Lebensstil-Konzepte nach Schulze.
- 4. Literaturverzeichnis
- 5. Anhang (Korpus)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Anwendbarkeit des Modells der alltagsästhetischen Schemata nach Schulze auf Printanzeigen. Ziel ist es, zu analysieren, inwieweit die Kategorien Hochkulturschema, Trivialschema und Spannungsschema geeignet sind, „ästhetische Zeichengruppen“ in Bierwerbungen zu identifizieren und zu konturieren. Die Arbeit geht davon aus, dass die Erlebnisgesellschaft, geprägt von „innenorientierten Lebensauffassungen“,¹ den Konsum als Mittel zur Erzeugung positiver subjektiver Prozesse betrachtet. Insbesondere die Bedeutungsebene des Genusses wird dabei in den Vordergrund gerückt.
- Die Anwendbarkeit des Modells der alltagsästhetischen Schemata nach Schulze auf Printanzeigen.
- Die Identifizierung und Konturierung von „ästhetischen Zeichengruppen“ in Bierwerbungen.
- Die Bedeutungsebene des Genusses in der Erlebnisgesellschaft.
- Die Zuordnung von Bierwerbungen zu den Kategorien Hochkulturschema, Trivialschema und Spannungsschema.
- Die Analyse der key visuals und Headlines der Werbeanzeigen im Hinblick auf die jeweiligen Schemata.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung
Die Einleitung stellt das Problem der zielgerichteten Werbung in der heutigen Gesellschaft dar. Sie beleuchtet die Annahme, dass die Gesellschaft in distinktive Großgruppen unterteilt ist, die anhand spezifischer Charakteristika unterscheidbar und über spezifische Elemente ansprechbar sind. Schulze's Modell der alltagsästhetischen Schemata wird als ein Ansatz vorgestellt, um diese Unterteilung zu beschreiben. Die Bedeutung des Genusses in der Erlebnisgesellschaft wird hervorgehoben. Die Forschungsfrage der Arbeit zielt darauf ab, die Anwendbarkeit von Schulzes Kategorien auf Printanzeigen zu untersuchen, wobei Bier als Beispielprodukt gewählt wird.
2. Einteilung
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den drei alltagsästhetischen Schemata nach Schulze: Hochkulturschema, Trivialschema und Spannungsschema. Es wird betont, dass die Zuordnung von Werbeanzeigen zu den Schemata nicht exklusiv und trennscharf ist, sondern anhand mehrheitlicher Eigenschaften erfolgt. Die Subjektivität des Entscheidungsträgers wird als ein weiterer wichtiger Faktor hervorgehoben.
2.1 Hochkulturschema (I)
Dieses Unterkapitel beschreibt die Eigenschaften des Hochkulturschemas, das dem Genusskonzept der Kontemplation folgt. Stilvolle und elegante Gestaltungselemente, wie dunkle Farben und puristische Gesamterscheinung, sowie das Key-Visual von bekannten Personen im Anzug, werden als Kennzeichen des Schemas dargestellt. Die Headline von Zitaten der Personen, die das Produkt mit Erfolg und „großen Momenten“ verbindet, unterstützt die Annahme, dass Genuss hier als „psychische Erlebnisqualität“¹¹ empfunden wird.
2.2 Trivialschema (II)
Dieses Unterkapitel behandelt das Genusskonzept der Gemütlichkeit, das durch naturgeprägte Umgebungen und grüne und blaue Farbtöne gekennzeichnet ist. Die Headline von IIa. „So wild feiert der Norden!“ ironisiert die Maxime „Das Erlebnis strengt nicht an“14 und steht im Kontrast zum Spannungsschema. Die physische Verfassung der Personen, die wenig diszipliniert und wenig perfekt erscheinen, unterstreicht die Gemütlichkeit und unterscheidet das Trivialschema vom Hochkulturschema.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe der Arbeit sind alltagsästhetische Schemata, Hochkulturschema, Trivialschema, Spannungsschema, Erlebnisgesellschaft, Genuss, Printanzeigen, Bierwerbung, Key-Visual, Headline.
Häufig gestellte Fragen
Was sind alltagsästhetische Schemata nach Schulze?
Gerhard Schulze unterteilt die Erlebnisgesellschaft in drei Schemata: Hochkulturschema (Kontemplation), Trivialschema (Gemütlichkeit) und Spannungsschema (Action/Reizmaximierung).
Wie wird Bierwerbung im Hochkulturschema gestaltet?
Sie nutzt oft dunkle, elegante Farben, puristische Ästhetik und zeigt erfolgreiche Personen (z.B. im Anzug), um Genuss als exklusive psychische Erlebnisqualität darzustellen.
Was kennzeichnet das Trivialschema in der Werbung?
Hier steht die Gemütlichkeit im Vordergrund. Typisch sind naturgeprägte Umgebungen, harmonische Farben und Personen, die wenig diszipliniert und eher „alltäglich“ wirken.
Warum eignet sich Bier besonders für diese Analyse?
Bier ist ein Genussmittel in einer postmaterialistischen Gesellschaft. Die Werbung dafür zielt stark auf subjektive Erlebnisse und Lebensstile ab statt auf rein funktionale Produktvorteile.
Was ist eine „Erlebnisgesellschaft“?
Ein Begriff von Schulze für eine Gesellschaft, in der Konsumentscheidungen primär dazu dienen, positive innere Erlebnisse und subjektive Prozesse auszulösen.
- Quote paper
- Marco Gierke (Author), 2014, Alltagsästhetische Schemata. Eine Korpusanalyse von Printanzeigen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/315625