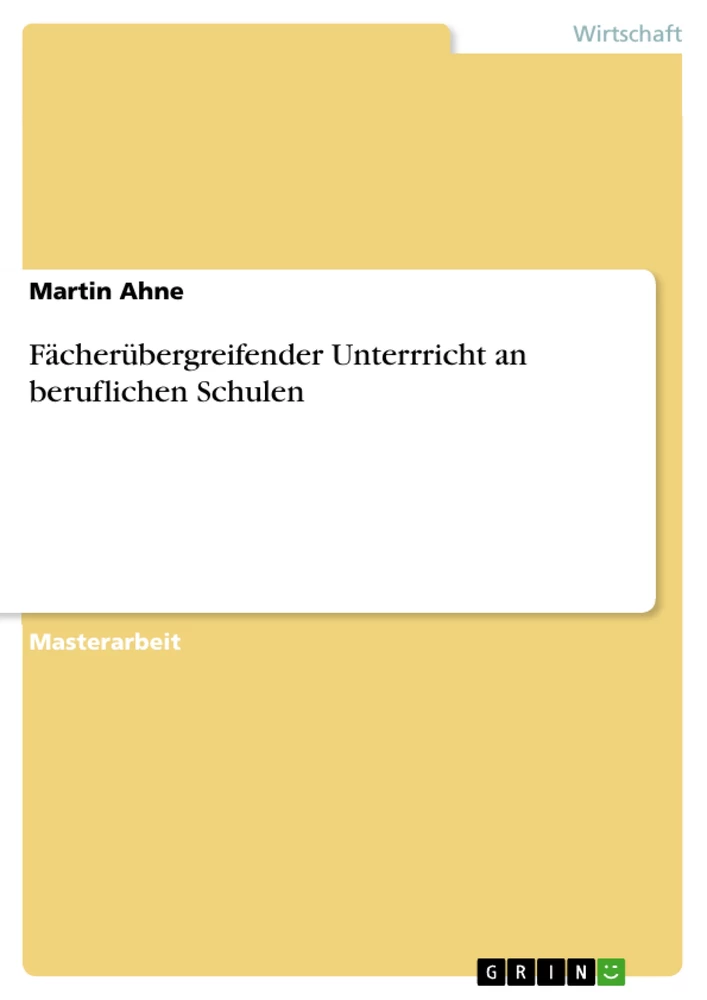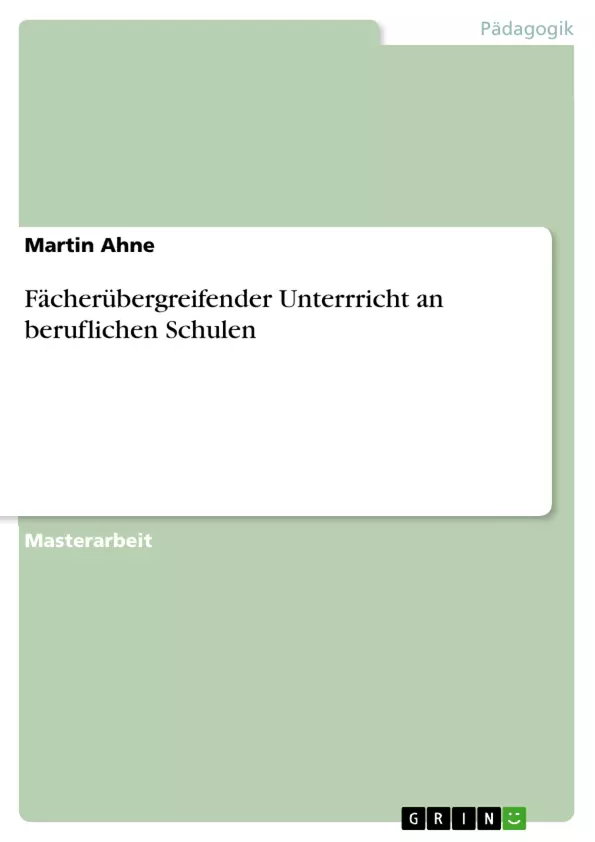Der Satz „non vitae, sed scholae discimus“ (Duden, 2015a) des Philosophen Seneca ist eine offensichtliche Kritik an der Ausbildung junger Römer zu seiner Zeit. Die deutsche Übersetzung bedeutet in etwa so viel, dass diese Schüler nicht für das Leben lernen, sondern vielmehr für die Schule. Genauer genommen ist es auch eine Kritik, welche an die Lehrkörper adressiert war. Sie bereiteten ihre Schüler nicht auf die Aufgaben vor, die das Leben später an sie stellte, sondern lehrten viele unnütze Sachen.
Viele Philosophen und Pädagogen haben sich über Jahrhunderte hinweg den Kopf zerbrochen, wie man das Schulsystem stetig verbessern kann. Jedoch werden immer wieder Kritiker wahrgenommen, die etwas an dem bestehenden System und den Methoden auszusetzen haben. Scheinbar hat man trotz vieler Bemühungen seit Seneca aber noch keine Lösung gefunden, welche befriedigend genug ist. Immer wieder werden neue Lehrplanrichtlinien durch die Kultusministerkonferenz (KMK) beschlossen und in den Schulen umgesetzt, um die Schüler auf die neuen Herausforderungen und Anforderungen vorzubereiten.
Neben der Fähigkeit, komplexe Handlungen ausüben zu können, ist es von enormer Wichtigkeit die Selbstständigkeit auch beim Denken zu fördern. Moegling (2010) erklärt, dass die Fähigkeit zum vernetzten und interdisziplinären Denken immer wichtiger wird. Das mehrperspektivische Denken ist vielmehr der Grundstein des vernetzten Denkens. So ist dies wichtig, wenn ein Perspektivenwechsel erfolgen soll – etwa im Marketingbereich, wenn man die Belange des Kunden eruiert. Neben dem Denken werden diese komplexeren Handlungsstrategien vonnöten sein, um in Zeiten der Globalisierung wettbewerbsfähig zu bleiben (Moegling, 2010, S. 9-10).
Diese Fähigkeiten und Möglichkeiten sollen in der Schule gefördert werden. Neben offenen und kooperativen Lehrkörpern ist es enorm wichtig, dass die Schüler ein vernetztes und interdisziplinäres Denken und Arbeiten lernen (Brinkmöller-Becker, 2000, S. 9)
Nun ist es Aufgabe der Schulen und Lehrer diese Fähigkeiten zu lehren, damit die Schüler nicht nur für die Schule, sondern für das Leben lernen.
Diese Arbeit befasst sich mit dem fächerübergreifenden Unterricht, einen Ansatz, der das globale Denken der Schüler fördern soll. Bei dieser Art des Unterrichtens werden nicht nur einzelne Disziplinen getrennt voneinander betrachtet, sondern der Unterrichtsstoff wird kombiniert gelehrt. Im Besonderen werden in der nachfolgenden Arbeit die beruflichen Schulen betrachtet.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1 Abkürzungsverzeichnis
- 2 Abbildungsverzeichnis
- 3 Hinführung zum Thema und methodisches Vorgehen
- 4 Fächerübergreifender Unterricht im Überblick
- 4.1 Systematiken des fächerübergreifenden Unterrichts
- 4.1.1 Unterricht und Fach als Ausgangsbasis des fächerübergreifenden Unterrichts
- 4.1.2 Begründung und Hintergrund des fächerübergreifenden Unterrichts
- 4.1.3 Begriff des fächerübergreifenden Unterrichts
- 4.1.4 Koordination des fächerübergreifenden Unterrichts
- 4.2 Berufliche Schulen im Porträt
- 4.2.1 Der Schultyp Wirtschaftsschule
- 4.2.2 Der Schultyp Berufsschule
- 4.3 Lehrplananalyse
- 4.3.1 LehrplanPlus Wirtschaftsschule
- 4.3.2 Lehrplan Bankkaufmann
- 4.3.3 Lehrplan Industriekaufmann
- 4.1 Systematiken des fächerübergreifenden Unterrichts
- 5 Erarbeitung der Gütekriterien
- 5.1 Begriffserklärung Gütekriterium
- 5.2 Gütekriterien im Unterricht an beruflichen Schulen
- 5.3 Gütekriterien im Unterrichtsfach „Wirtschaftswissenschaften“
- 5.4 Gütekriterien im Unterrichtsfach „Wirtschaftsinformatik“
- 5.5 Gütekriterien im fächerübergreifenden Unterricht
- 6 Theorie-/Praxisvergleich mithilfe eines Unterrichtsentwurfs
- 6.1 Unterrichtsentwurf Finanzierungspläne
- 6.1.1 Thema und Zielsetzung des Unterrichts
- 6.1.1.1 Lehrplanbezug und Planungshilfen
- 6.1.1.2 Stoffverteilungsplan standardisierte Privatkredite
- 6.1.1.3 Intention der Unterrichtseinheit
- 6.1.1.4 Lernziele
- 6.1.2 Bedingungsanalyse
- 6.1.2.1 Zusammensetzung und Arbeitsverhalten der Klasse
- 6.1.2.2 Vorwissen
- 6.1.2.3 Lernvoraussetzungen und motivationaler Hintergrund
- 6.1.2.4 Zeitliche, räumliche und technische Voraussetzungen
- 6.1.2.5 Geplanter Ablauf
- 6.1.2.6 Verlaufsplanung
- 6.1.1 Thema und Zielsetzung des Unterrichts
- 6.1 Unterrichtsentwurf Finanzierungspläne
- 7 Reflexion und Verbesserungsvorschläge
- 7.1 Betrachtung des Unterrichtsentwurfs mithilfe der Gütekriterien
- 7.2 Verbesserungsmöglichkeiten
- 8 Fazit und Ausblick
- 9 Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Thematik des fächerübergreifenden Unterrichts an beruflichen Schulen. Ziel ist es, die Konzeption und die Durchführung des fächerübergreifenden Unterrichts anhand von Gütekriterien zu analysieren und zu bewerten.
- Systematiken des fächerübergreifenden Unterrichts
- Gütekriterien im Unterricht an beruflichen Schulen
- Lehrplananalyse und Praxisbeispiel
- Theorie-Praxis-Vergleich
- Reflexion und Verbesserungsmöglichkeiten
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel führt in die Thematik des fächerübergreifenden Unterrichts ein und erläutert das methodische Vorgehen der Arbeit. Das zweite Kapitel gibt einen Überblick über den fächerübergreifenden Unterricht, seine Systematiken und Begründungen. Es werden unterschiedliche Formen und Ansätze des fächerübergreifenden Unterrichts vorgestellt, sowie die Bedeutung und die Herausforderungen des fächerübergreifenden Unterrichts an beruflichen Schulen aufgezeigt. Das dritte Kapitel analysiert die Lehrpläne verschiedener beruflicher Schulen im Hinblick auf die Möglichkeiten des fächerübergreifenden Unterrichts. Die Analyse der Lehrpläne zeigt auf, wie das Konzept des fächerübergreifenden Unterrichts in die Lehrpläne integriert werden kann und welche Inhalte und Methoden geeignet sind. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der Entwicklung von Gütekriterien für den fächerübergreifenden Unterricht. Es werden verschiedene Kriterien definiert und bewertet, die für eine erfolgreiche Umsetzung des fächerübergreifenden Unterrichts relevant sind. Das fünfte Kapitel zeigt anhand eines praxisnahen Unterrichtsentwurfs, wie die Gütekriterien in der Praxis angewendet werden können. Der Unterrichtsentwurf behandelt das Thema „Finanzierungspläne“ und zeigt die Anwendung des fächerübergreifenden Unterrichts in den Bereichen Wirtschaft und Informatik.
Schlüsselwörter (Keywords)
Fächerübergreifender Unterricht, berufliche Schulen, Lehrplananalyse, Gütekriterien, Unterrichtsentwurf, Finanzierungspläne, Wirtschaft, Informatik.
- Citar trabajo
- Martin Ahne (Autor), 2015, Fächerübergreifender Unterrricht an beruflichen Schulen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/315652