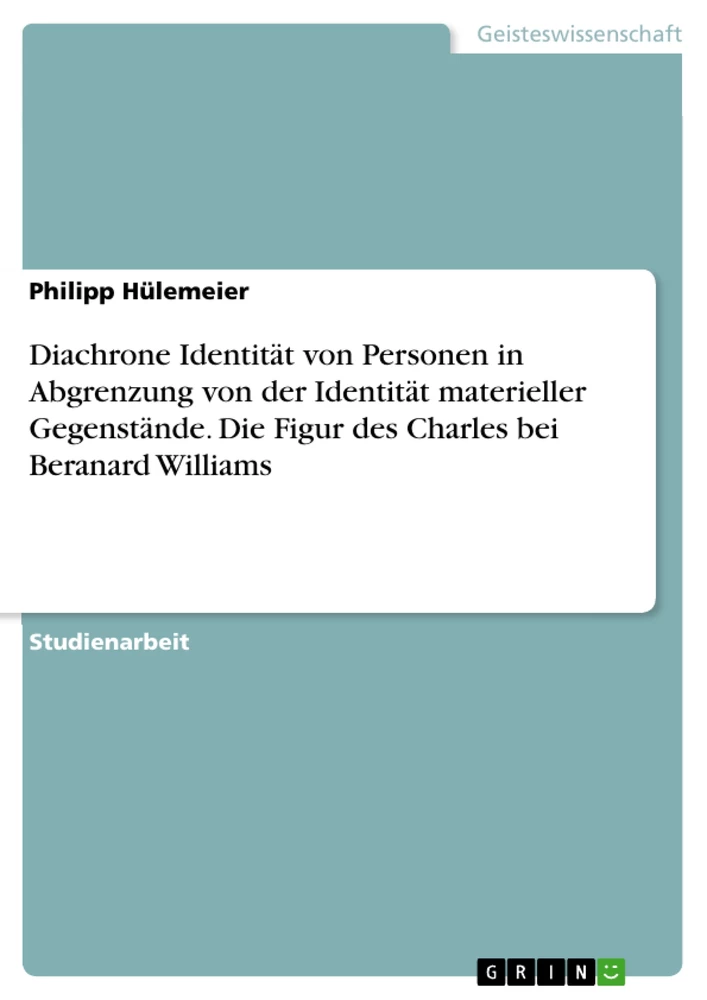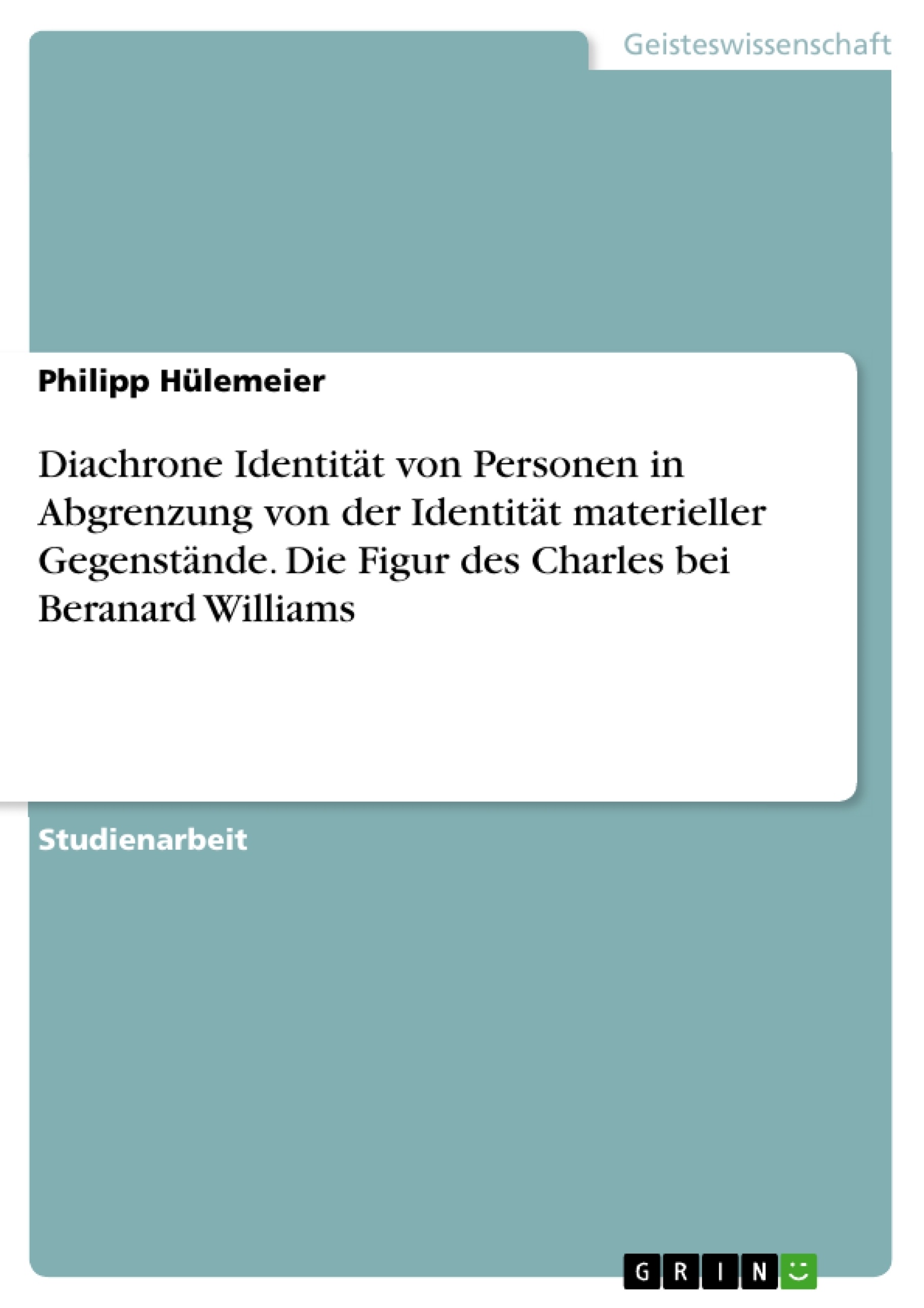Die Veränderung von Personen durch die Zeit und damit verbunden die Frage nach ihrer diachronen Identität steht im Zentrum von Bernard Williams erstem Aufsatz „Personenidentität und Individuation“ in seiner Aufsatzsammlung „Probleme des Selbst.“
Wenig zielführend scheint es da zuerst auf die Veränderung von materiellen Gegenständen einzugehen. Doch wie Chisholm aufbauend auf Joseph Butlers These eines „strikten und philosophischen Sinns von der Identität“ von Personen zu reden verdeutlicht, ist die Begründung der Abgrenzung des „weiten und gängigen Sinns der Identität“ von materiellen Gegenständen sinnvoll. Hierdurch wird es möglich, die Suche nach eindeutigen Identitätsbedingungen bei Personen zu rechtfertigen.
Dies soll eine Hinführung zu den verschiedenen Kriterien zur Bestimmung der diachronen Personenidentität sein. Um Williams Ansatz einer Verschränkung von geistigem und körperlichem Kriterium sinnvoll einzuordnen, sind ihm vorausgehende Ansätze eines seelischen Kriteriums oder Persönlichkeitskerns sowie der Ansatz, auf den im Aufsatz explizit Bezug genommen wird, nämlich Lockes Erinnerungskriterium, anzuführen.
Nur in diesem Kontext können Abgrenzungsbewegungen Williams zu anderen Ansätzen und mögliche Gründe für eine Plausibilität seines Ansatzes zu Tage gefördert werden.
Nach einer Darstellung der konkurrierenden Ansätze zur Personenidentität soll ein Ansatz Parfits folgen, der wenn nicht die Legitimität dann doch die Sinnhaftigkeit des gesamten Versuchs der Suche nach eindeutigen Identitätskriterien massiv in Frage stellt. Dies soll zu einer umgekehrten Beschäftigung mit dem Thema von Personenidentität führen.
Wenn es nicht die Personenidentität ist, auf die es ankommt, was fehlt dann möglicherweise im Bereich der praktischen Philosophie in der Betrachtung des Menschen als freien, persistenten Trägers von Rechten und Pflichten?
An dieser Schnittstelle von theoretischer und praktischer Philosophie sollen die Ausführungen, wenn nicht ihren Zielpunkt, so doch eine weitere Facette finden, die kurz anschneidet, was bei allen Unklarheiten und Unsicherheiten Umfang und Aufwand der Debatte um die diachrone Personenidentität rechtfertigt.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1 Einleitung
- 2 Diachrone Identität von Gegenständen und Personen bei Joseph Butler
- 2.1 Der „,loose and popular sense of identity“ von Gegenständen
- 2.2 Relevanz für die Fragestellung der Veränderung von Personen
- 2.3 Der,,strict and philosophical sense of identity“ von Personen
- 3 Die Figur des Charles bei Bernard Williams
- 4 Der „,simple view“ als Lösungsansatz für die aufgeworfenen Probleme
- 4.1 Der „simple view“ in seinen Grundzügen
- 4.2 Kritik am „simple view“
- 5 Das psychische Kriterium als Lösungsansatz
- 5.1 Lockes Vorschlag in seinen Grundzügen
- 5.2 Einwände gegen Lockes Vorschlag
- 6 Der Ansatz Bernard Williams
- 6.1 Darstellung des Ansatzes Bernard Williams in seinen Grundzügen
- 6.2 Bewertung des Ansatzes Bernard Williams
- 6.3 Parfits Provokation oder „Does personal identity matter?„
- 7 Praktische Konsequenzen des Ansatzes Parfits
- 8 Ausblick und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Hausarbeit analysiert die diachrone Identität von Personen, insbesondere im Kontext von Bernard Williams' Werk „Probleme des Selbst“. Sie beleuchtet die Herausforderungen der Veränderung von Personen im Laufe der Zeit und untersucht verschiedene Ansätze zur Definition und Bestimmung der diachronen Personenidentität.
- Die Abgrenzung des „weiten und gängigen Sinns“ von Identität materieller Gegenstände vom „philosophischen und strengen Sinn“ der Identität von Personen.
- Die Kritik an verschiedenen Lösungsansätzen zur Bestimmung der diachronen Personenidentität, wie dem „simple view“ und Lockes Erinnerungskriterium.
- Die Analyse von Bernard Williams' Ansatz einer Verschränkung von geistigem und körperlichem Kriterium.
- Die Berücksichtigung von Parfits Provokation, die die Sinnhaftigkeit der Suche nach eindeutigen Identitätskriterien in Frage stellt.
- Die Betrachtung der praktischen Konsequenzen für die Philosophie des Menschen als freien und persistenten Träger von Rechten und Pflichten.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Kapitel 2 analysiert Butlers Unterscheidung zwischen dem „weiten und gängigen“ und dem „philosophischen und strengen Sinn“ der Identität. Dabei wird am Beispiel des „Schiffes des Theseus“ aufgezeigt, wie diese Unterscheidung für die Fragestellung der diachronen Personenidentität relevant ist.
Kapitel 3 stellt die Figur des Charles in Bernard Williams' Werk vor, die als Beispiel für die Herausforderungen der diachronen Personenidentität dient.
Kapitel 4 analysiert den „simple view“ als Lösungsansatz für die Probleme der Personenidentität und kritisiert seine Grenzen.
Kapitel 5 betrachtet Lockes Vorschlag eines seelischen Kriteriums als Basis für die Personenidentität und diskutiert Einwände gegen diesen Ansatz.
Kapitel 6 präsentiert Bernard Williams' Ansatz und bewertet seine Plausibilität im Vergleich zu anderen Ansätzen. Parfits Provokation zur Legitimität der Suche nach eindeutigen Identitätskriterien wird ebenfalls beleuchtet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die zentralen Themen dieser Arbeit sind die diachrone Identität von Personen, die Abgrenzung von Personen- und Objektidentität, die Kritik am „simple view“ und an Lockes Erinnerungskriterium, Bernard Williams' Ansatz der Verschränkung von geistigem und körperlichem Kriterium sowie Parfits Zweifel an der Sinnhaftigkeit der Suche nach eindeutigen Identitätskriterien.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet diachrone Identität bei Personen?
Es ist die Frage, wie eine Person über die Zeit hinweg dieselbe bleibt, trotz körperlicher und geistiger Veränderungen.
Wie unterscheidet Joseph Butler die Identität von Objekten und Personen?
Er trennt den „weiten Sinn“ der Identität bei Gegenständen vom „strengen, philosophischen Sinn“ bei Personen.
Was besagt Lockes Erinnerungskriterium?
Locke argumentiert, dass die Identität einer Person so weit reicht, wie ihr Bewusstsein und ihre Erinnerungen in die Vergangenheit zurückreichen.
Welchen Ansatz verfolgt Bernard Williams?
Williams schlägt eine Verschränkung von geistigen und körperlichen Kriterien vor, um die Identität eines Individuums zu bestimmen.
Warum stellt Derek Parfit die Bedeutung der Personenidentität infrage?
Parfit provoziert mit der These, dass Identität an sich nicht das ist, worauf es in der praktischen Ethik und im Überleben ankommt.
- Citation du texte
- Philipp Hülemeier (Auteur), 2013, Diachrone Identität von Personen in Abgrenzung von der Identität materieller Gegenstände. Die Figur des Charles bei Beranard Williams, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/315724