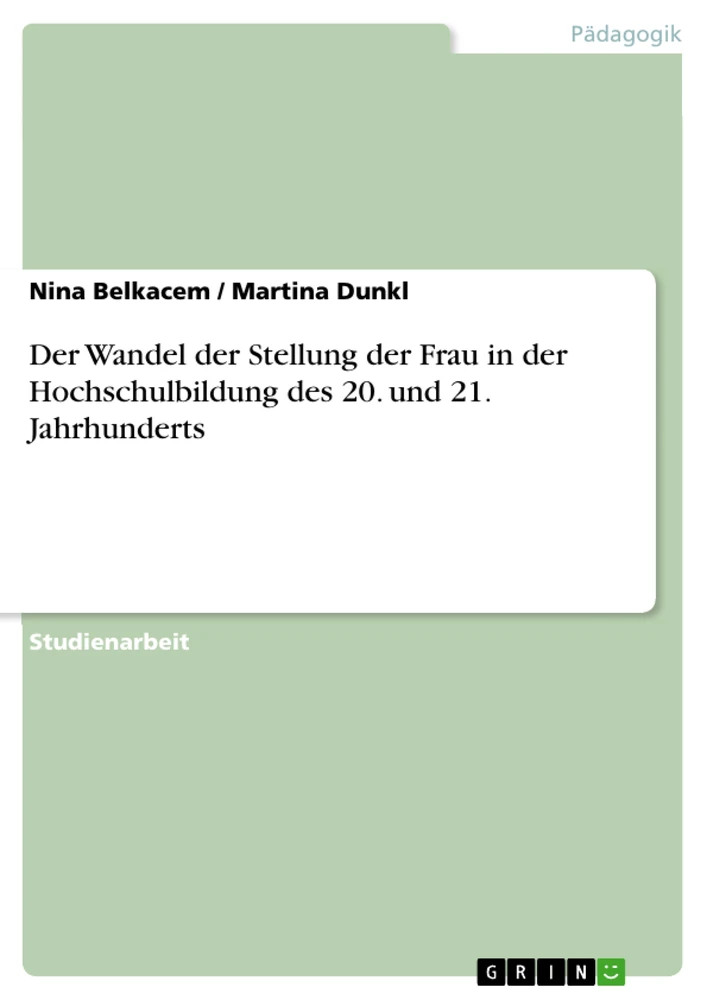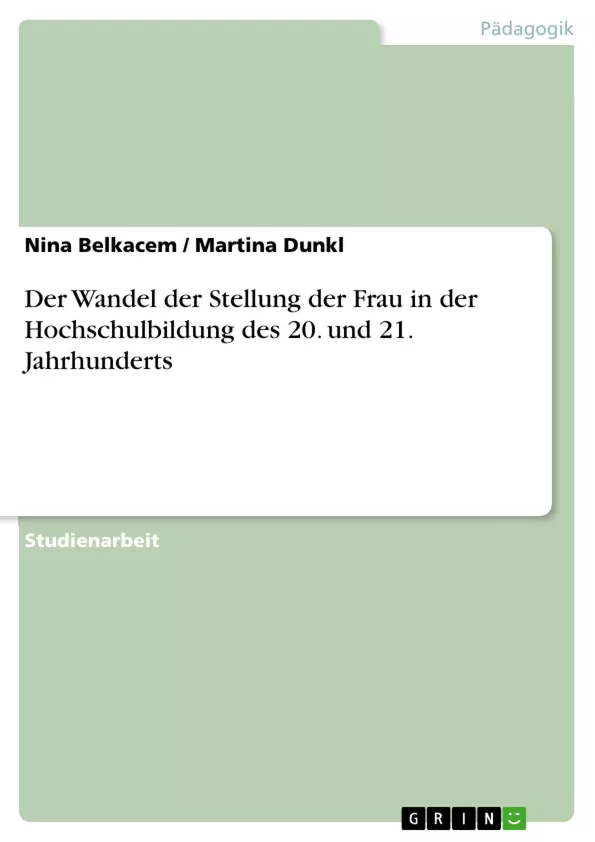Welchen Wandel haben die Bildungschancen der Frau, insbesondere im Bereich der Hochschule, im 20. Jahrhundert und 21. Jahrhundert erfahren? Im Rahmen dieser Arbeit besteht das Erkenntnisinteresse darin, den Wandel der
Bildungschancen der Frau im Zusammenhang mit dem sich veränderten Frauenbild aufzuzeigen und zu vergleichen.
Die Art und Weise, wie zuvor von vielen Schriftstellern und Pädagogen argumentiert wurde, um den Frauen den Zugang zu einer freien Hochschulbildung zu verwehren, war keineswegs sensibel. Häufig beschäftigte sich Literatur in diesem Jahrhundert darüber, inwiefern Frauen aufgrund ihrer natürlichen Ausstattung nicht dazu befähigt wären, eine Bildung, welche über die ehelichen und häuslichen Pflichten hinausgeht, zu erhalten.
Die Vertreter (z.B. Rousseau, Pestalozzi) dieser Argumentation schraken auch nicht davor zurück, die Zulassung der weiblichen Studenten mit dem Untergang der Universität gleichzusetzten, da durch den Wegfall der Zugangsbeschränkung auch die Qualität der Bildung leiden würde. Neben Rousseau und Pestalozzi war ein weiterer Vertreter dieser Argumentation Theodor Bischoff.
Er war ein angesehener Anatomieprofessor und war der Meinung, dass Frauen aufgrund des leichteren Gewichts ihres Gehirnes eine gemilderte Leistungsfähigkeit haben würden. Frauen seien, im Gegensatz zu Männern, nach Bischoff somit nicht in der Lage, logisch und wissenschaftlich denken zu können.
Durch die Anfänge der Frauenbildung rückte geschlechtsspezifische Heterogenität in den Blick der Forschung. Die Rebellion gegen die andro- und phallozentrischrische Weltsicht seitens der Frauenforschung führte zu umfangreichen Rekonstruktionen der Weiblichkeit und der Rolle der Frau in der Geschichte. Ihrer (der Frauenforschung) Ansicht nach, ist Geschlechterdifferenz ein soziales Phänomen bzw. ein Konstrukt. Das Ziel der Frauenforschung ist es, die Geschichte des Ausschlusses der Frau aus dem Bildungswesen und die Benachteiligung von Frauen in allen Gesellschaftsbereichen aufzuzeigen und zu überwinden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- ,,Die tüchtige Hausfrau: gebildet aber nicht gelehrt" - Anfänge der Frauenbildung
- Das bürgerliche Frauenbild im frühen 19. Jahrhundert
- Historische Entwicklung der Frauenbildung
- Das Frauenstudium an der Universität Wien
- Die neuzeitliche Entwicklung der Bildungsbeteiligung von Frauen an der Hochschule
- Die Frauenbeteiligung an österreichischen Universitäten und Kunsthochschulen in der Nachkriegszeit von 1955 bis einschließlich 1996
- Das Bundes- Gleichbehandlungsgesetz
- Die Fachhochschulen Österreichs
- Studienabschlüsse
- Wissenschaftliches Personal
- Aktuelle Studien und Ergebnisse um die Bildungsbeteiligung von Frauen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Wandel der Bildungschancen von Frauen im Kontext des sich verändernden Frauenbildes. Sie vergleicht die frühen Anfänge der Frauenbildung im frühen 20. Jahrhundert mit der Situation im 21. Jahrhundert, um die Herausforderungen und Fortschritte in der Gleichstellung der Geschlechter im Bildungsbereich aufzuzeigen.
- Das traditionelle Frauenbild im frühen 20. Jahrhundert und seine Auswirkungen auf den Zugang zur Hochschulbildung.
- Die historische Entwicklung der Frauenbildung und die Einführung des Frauenstudiums an der Universität Wien.
- Die aktuelle Situation der Bildungsbeteiligung von Frauen in Österreich, einschließlich ihrer Repräsentation in verschiedenen Bildungseinrichtungen.
- Die Bedeutung von Frauenförderungsplänen und der Notwendigkeit, die Diskriminierung von Frauen im Bildungswesen zu überwinden.
- Die Herausforderungen und Chancen für eine gerechtere und inklusivere Bildungslandschaft.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das zentrale Thema der Arbeit vor und beleuchtet die historische Bedeutung des Frauenbildes und seiner Auswirkungen auf die Bildungschancen von Frauen. Kapitel 1 analysiert das bürgerliche Frauenbild im frühen 19. Jahrhundert, wobei die Rolle von prominenten Denkern wie Rousseau und Hohberg im Fokus steht. Kapitel 2 beleuchtet die Anfänge des Frauenstudiums an der Universität Wien und beschreibt die Hürden, die Frauen überwinden mussten, um Zugang zur Hochschulbildung zu erhalten. Kapitel 3 untersucht die aktuelle Entwicklung der Bildungsbeteiligung von Frauen an österreichischen Universitäten, Kunsthochschulen und Fachhochschulen und analysiert die Gleichstellung der Geschlechter im Bildungswesen.
Schlüsselwörter
Frauenbildung, Geschlechterrollen, Bildungsbeteiligung, Gleichstellung der Geschlechter, Hochschulbildung, Universität Wien, Österreich, Frauenforschung, Frauenförderung.
Häufig gestellte Fragen zum Wandel der Frauenbildung
Wie wurde der Ausschluss von Frauen von der Hochschulbildung früher begründet?
Gegner wie Theodor Bischoff argumentierten mit einer angeblich geringeren Leistungsfähigkeit aufgrund des Gehirngewichts oder der "natürlichen Bestimmung" für häusliche Pflichten.
Welche Rolle spielte die Universität Wien in der Geschichte der Frauenbildung?
Die Universität Wien war ein zentraler Ort für die Einführung und Entwicklung des Frauenstudiums in Österreich.
Was ist das Ziel der modernen Frauenforschung im Bildungsbereich?
Sie möchte die Geschichte des Ausschlusses aufzeigen und die Benachteiligung von Frauen in allen Gesellschaftsbereichen überwinden.
Was besagt das Bundes-Gleichbehandlungsgesetz?
Es dient der rechtlichen Absicherung der Gleichstellung von Frauen und Männern, insbesondere im öffentlichen Dienst und an Hochschulen.
Wie hat sich das Frauenbild seit dem 19. Jahrhundert verändert?
Vom Ideal der „tüchtigen Hausfrau“ hin zur Anerkennung der Frau als gleichberechtigte Wissenschaftlerin und Studentin.
- Arbeit zitieren
- Nina Belkacem (Autor:in), Martina Dunkl (Autor:in), 2012, Der Wandel der Stellung der Frau in der Hochschulbildung des 20. und 21. Jahrhunderts, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/315839