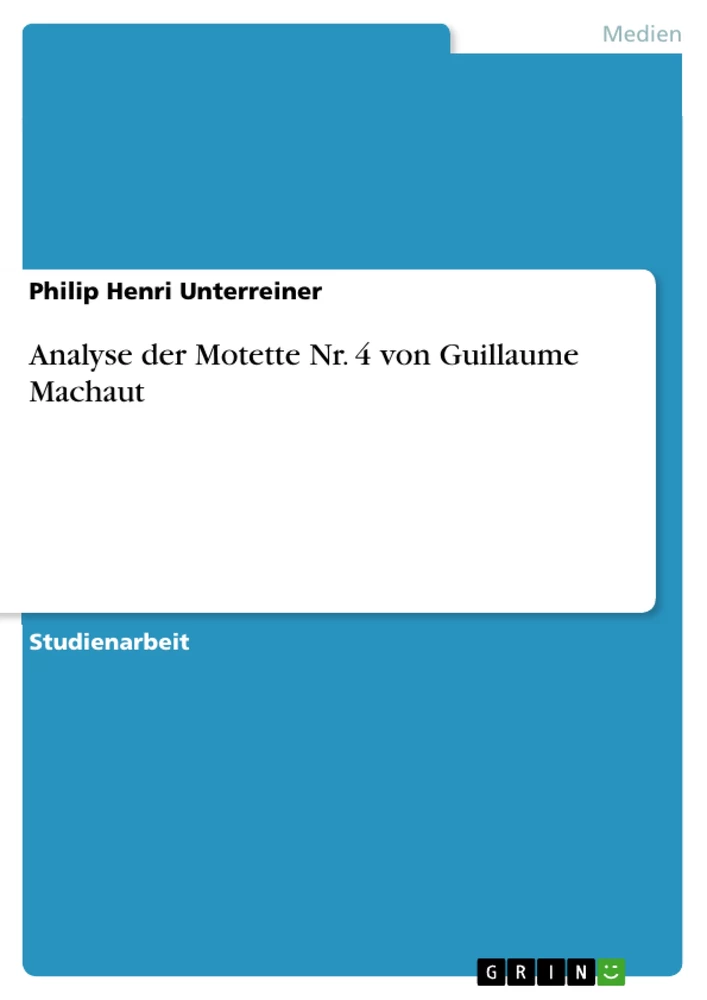Das Ziel folgender Arbeit ist eine knappe Analyse der Motette Nr. 4 von Guillaume de Machaut. Dabei soll untersucht werden, wie das Werk aufgebaut ist, welche Einflüsse aus einer anderen Gattung sich finden lassen, und wie sich das Verhältnis von Text und Musik gestaltet.
Die Edition der Motetten Machauts von Friedrich Ludwig diente vorliegender Analyse als Quelle.
Die Motette ist dreistimmig aus Tenor, Motetus und Triplum aufgebaut und entsprechend in c4 und zweimal in c1 geschlüsselt. Der Modus und das Tempus sind imperfekt und die Prolatio perfekt. Die perfekte Prolatio oder Prolatio maior, die die Teilung der Semibrevis in drei Minimae angibt, wird in den Noten als Triole wiedergegeben. Eine Mensur wird hier als eine Einheit verstanden, die die Dauer einer Longa oder von zwei Breven besitzt. Ein auffälliges Formmerkmal stellt der zweiteilige Aufbau der Motette dar. Ab Mensur 103 beginnt der zweite, diminuierte Teil, der insofern verkürzt ist, als die Notenwerte im Tenor jeweils um die Hälfte kleiner werden und somit Talea und Color doppelt so schnell erklingen.
Die Motette Nr. 4 ist eine isorhythmische Motette. Die Talea oder Tondauernreihe umfasst 12 Töne und der Color 18 Töne, was ein kleinstes gemeinsames Vielfaches von 36 ergibt. Das bedeutet, dass die Talea dreimal und der Color zweimal erklingen müssen, um ein gemeinsames Ende zu finden und einen Durchlauf zu beenden. In Teil II erscheint der Tenor dagegen diminuiert, was zur Folge hat, dass sich die Bewegung gewissermaßen beschleunigt.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Aufbau
- Allgemeiner Aufbau
- Isorhythmischer Aufbau
- Tenor
- Der Tenor als Grundlage einer Motette
- Herkunft des Tenors aus einem Gregorianischen Choral
- Zusammenhang zwischen Tenor und Triplum- und Motetustext
- Struktur
- Isorhythmie als Strukturelement oder transzendentales Moment
- Binnengliederung und Analogien
- Unterteilung im Teil I
- Unterteilung im Teil II
- Musikalische Textbezüge
- Strukturelle Analogien von Versenden und Kadenzen
- Textausdeutung in der Motette
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit widmet sich einer Analyse der Motette Nr. 4 von Guillaume de Machaut. Sie untersucht den Aufbau des Werks, die Einflüsse anderer Gattungen und das Verhältnis von Text und Musik.
- Analyse des Aufbaus der Motette Nr. 4
- Untersuchung der Einflüsse anderer Gattungen auf die Motette
- Erforschung des Verhältnisses zwischen Text und Musik in der Motette
- Besondere Aufmerksamkeit auf die isorhythmische Struktur der Motette
- Bedeutung des gregorianischen Chorals als Quelle für den Tenor der Motette
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel beleuchtet den Aufbau der Motette Nr. 4 von Guillaume de Machaut. Dabei werden der allgemeine Aufbau, die isorhythmische Struktur und die Besonderheiten des zweiten Teils, der als diminuierter Teil mit verkürzten Notenwerten präsentiert wird, untersucht.
Im zweiten Kapitel liegt der Fokus auf dem Tenor der Motette. Es wird erläutert, dass der Tenor als Grundlage der Motette dient und seinen Ursprung in einem gregorianischen Choral hat. Der Zusammenhang zwischen dem Tenor und den Texten des Triplums und Motetus wird untersucht, wobei die Schlüsselfunktion des Textes „speravi“ im Choral und in der Motette hervorgehoben wird.
Das dritte Kapitel beleuchtet die Struktur der Motette Nr. 4. Es wird die Rolle der Isorhythmie als Strukturelement und die Binnengliederung des Werks mit Analogien betrachtet. Die Unterteilung der Motette in zwei Teile und die entsprechenden Veränderungen in der Musik werden detailliert dargestellt.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die wichtigsten Begriffe, die in dieser Arbeit behandelt werden, sind Guillaume de Machaut, Motette, Isorhythmie, Tenor, gregorianischer Choral, Text-Musik-Beziehung, Analyse, Struktur, Binnengliederung, speravi.
- Arbeit zitieren
- Philip Henri Unterreiner (Autor:in), 2011, Analyse der Motette Nr. 4 von Guillaume Machaut, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/315862