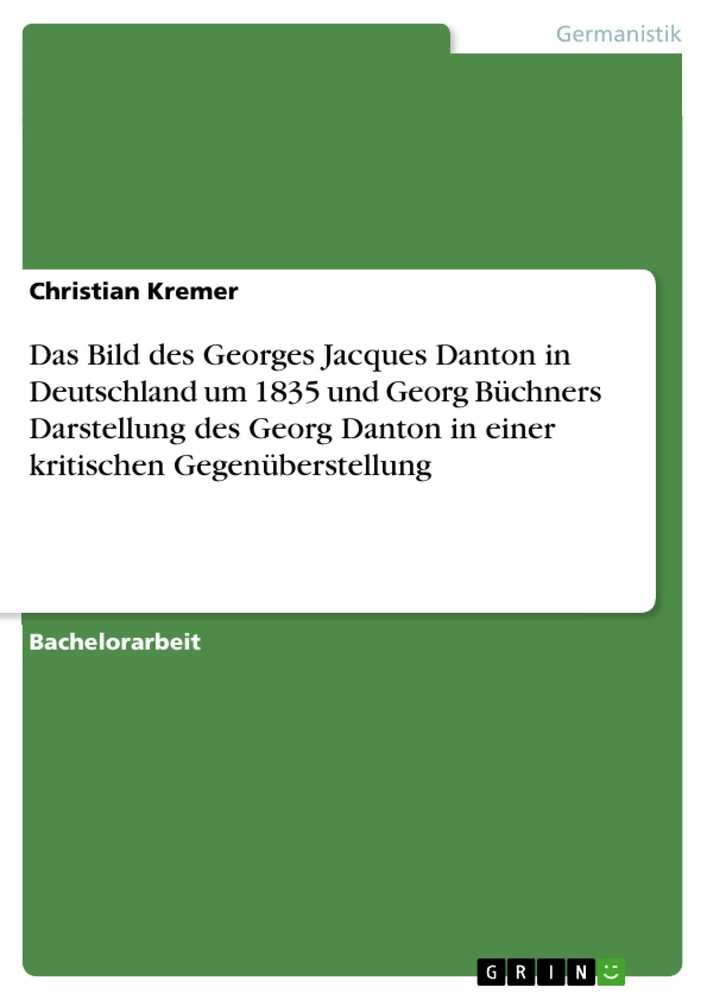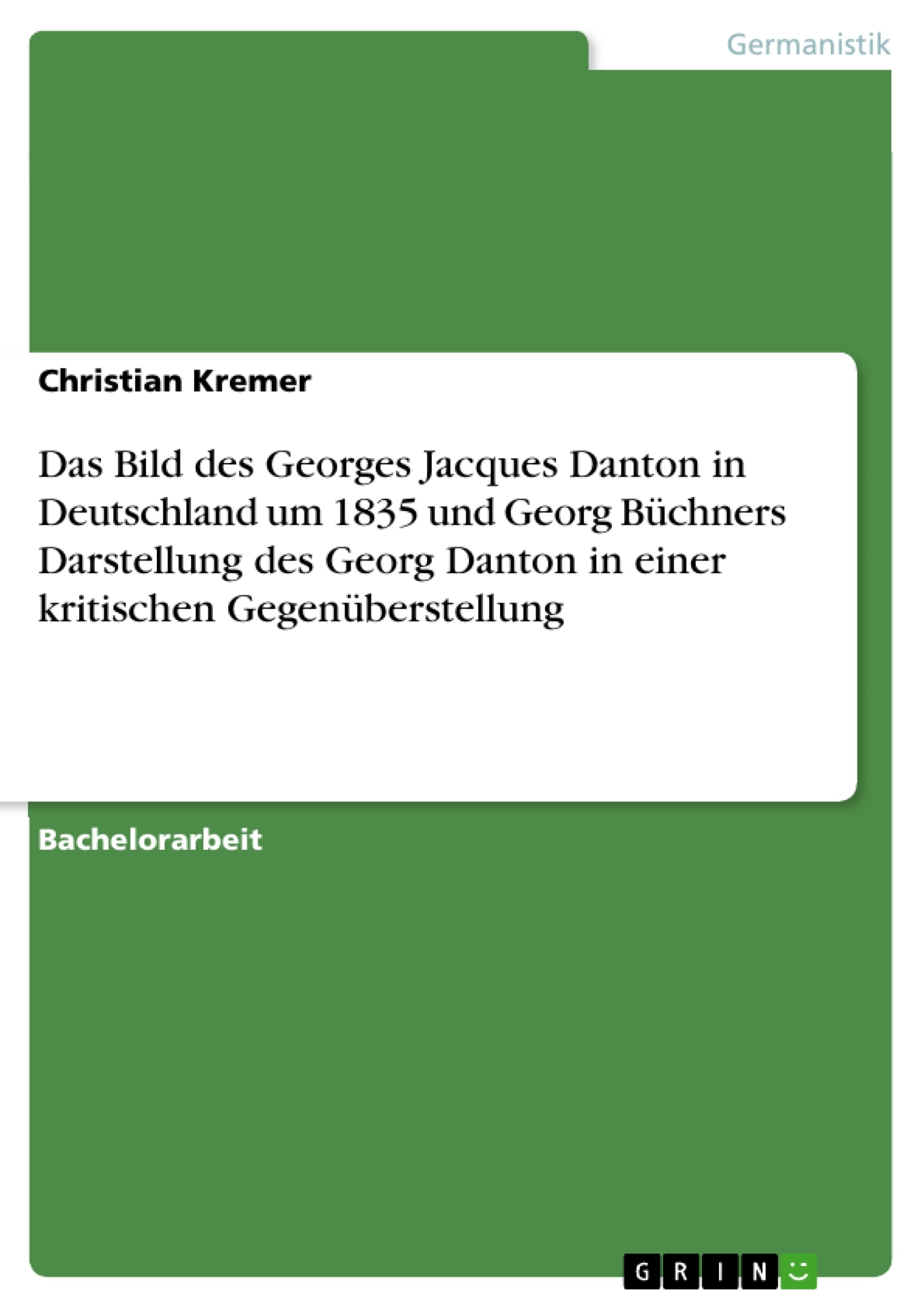Als einer der bedeutendsten Autoren des Vormärz gilt der schon mit 23 Jahren verstorbene Georg Büchner. In seinem kurzen Leben verfasst er zwei vollständige Dramen ("Dantons Tod", "Leonce und Lena") und zwei fragmentarische Werke (das Drama "Woyzeck" und die Novelle "Lenz"). Außerdem engagiert er sich im politischen Untergrund mit der Anfertigung der Flugschrift "Der Hessische Landbote" und in der geheimen ,Gesellschaft der Menschenrechte‘. In seinem vieraktigen Geschichtsdrama "Dantons Tod" wirft Büchner einen Blick auf die letzten Tage im Leben des französischen Revolutionärs Georges Jacques Danton bzw. Georg Danton, wie er im Drama heißt. Im Frühjahr 1794 auf dem Höhepunkt der jakobinischen Terrorherrschaft verlor Danton, selbst Jakobiner, im Alter von 34 Jahren sein Leben unter dem Fallbeil.
Angesichts des Anspruchs Büchners an sein Geschichtsdrama, die historische Wirklichkeit abzubilden, stellt sich die Frage, inwiefern "Dantons Tod" diesem Anspruch gerecht wird. Dieser Frage wird in der vorliegenden Bachelorarbeit am Beispiel des sowohl historischen als auch dramatischen Danton nachgegangen. Auf Grundlage der historisch-kritischen Marburger Ausgabe werden der Blick auf Danton im Deutschen Bund der Vormärzzeit und Büchners Darstellung kritisch miteinander verglichen. Die Untersuchung von Büchners Umgang mit seiner historiographischen Strukturquelle "Unsere Zeit", die das etablierte Dantonbild der Restaurationsepoche zeichnet, unterstützt diese kritische Gegenüberstellung, indem sie Gemeinsamkeiten offenlegt und zeigt, wie Büchner seine eigenen kreativen Anteile an der Darstellung Dantons mit historiographisch verbürgten Elementen verbindet.
Im ersten Kapitel der vorliegenden Arbeit wird das Bild des Georges Jacques Danton im Deutschen Bund vor dem Hintergrund der gesellschaftspolitischen Situation der Jahre 1815 bis 1835 am Beispiel von Büchners Heimat Hessen-Darmstadt dargestellt. Das zweite Kapitel bietet zunächst einen Überblick über Büchners historische, literarische und philosophische Quellen, bevor die Übernahmen aus "Unsere Zeit" mit dem Schwerpunkt auf Dantons Redebeiträge und seiner Charakterisierung untersucht werden. Im dritten Kapitel wird das Dantonbild in Deutschland um 1835, ergänzt durch relevante historische Fakten, mit der Darstellung des Danton in Büchners Drama verglichen sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede mit besonderem Blick auf Büchners Quelle "Unsere Zeit" kritisch reflektiert. Abschließend folgt das Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Das Bild des Georges J. Danton in Deutschland um 1835
- 1.1 Rheinbund, Deutscher Bund und Hessen-Darmstadt
- 1.2 Georges Jacques Danton
- 2. Georg Büchners Umgang mit seiner Quelle Unsere Zeit
- 2.1 Georg Büchners Quellen
- 2.2 Unsere Zeit in Dantons Tod
- 3. Georg Danton in Dantons Tod
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Darstellung Georges Jacques Dantons in Deutschland um 1835 und vergleicht sie kritisch mit Georg Büchners Darstellung in seinem Drama „Dantons Tod“. Ziel ist es, die Übereinstimmungen und Unterschiede aufzuzeigen und Büchners Umgang mit seinen historischen Quellen zu analysieren.
- Das Bild Dantons in Deutschland um 1835 im Kontext der politischen Situation des Vormärz
- Büchners Quellen und deren Einfluss auf seine Darstellung Dantons
- Ein Vergleich der historischen und dramatischen Darstellung Dantons
- Büchners kreative Anteile in der Gestaltung der Figur Danton
- Die Rolle Dantons in der Französischen Revolution und seine Rezeption im Vormärz
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den literaturgeschichtlichen Kontext zwischen 1815 und 1848 in Deutschland, mit den gegensätzlichen Strömungen des Biedermeiers und des Vormärz. Sie führt in die Thematik der Arbeit ein, die den Fokus auf Georg Büchners „Dantons Tod“ und dessen historische Grundlage legt. Die Arbeit untersucht den Vergleich zwischen dem historischen Danton und Büchners Darstellung, unter Berücksichtigung von Büchners Umgang mit seinen Quellen und der politischen Situation des Vormärz. Die methodische Vorgehensweise und die verwendeten Quellen werden erläutert.
1. Das Bild des Georges J. Danton in Deutschland um 1835: Dieses Kapitel beleuchtet zunächst die politische Situation in Hessen-Darmstadt um 1835, von der Gründung des Rheinbundes bis zum Deutschen Bund. Anschließend wird Dantons Rolle in der Französischen Revolution dargestellt und das Bild, das von ihm in Deutschland um 1835 existierte, skizziert, 40 Jahre nach Dantons Tod. Der Fokus liegt auf der Rezeption Dantons im Kontext der politischen und gesellschaftlichen Bedingungen des Vormärz und die daraus resultierenden Interpretationen seiner Figur.
2. Georg Büchners Umgang mit seiner Quelle Unsere Zeit: Das Kapitel analysiert Büchners Quellen für „Dantons Tod“, mit besonderem Augenmerk auf „Unsere Zeit“. Es untersucht, wie Büchner die Informationen aus dieser Quelle in sein Drama integriert, sowohl bezüglich Dantons Reden als auch seiner Charakterisierung. Der Fokus liegt darauf, wie Büchner historiografische Elemente mit seinen eigenen kreativen Gestaltungsmitteln verbindet. Die Analyse zeigt den Einfluss der Quellen auf Büchners Interpretation Dantons und seinen Beitrag zur Dramaturgie des Stückes auf.
3. Georg Danton in Dantons Tod: Dieses Kapitel vergleicht das Dantonbild in Deutschland um 1835 mit Büchners Darstellung in seinem Drama. Es beleuchtet Gemeinsamkeiten und Unterschiede, unter Berücksichtigung von Büchners Quelle „Unsere Zeit“. Die kritische Reflexion umfasst die historische Einordnung und die Interpretation der Figur Danton sowohl in der historischen als auch der dramatischen Perspektive. Hier werden die Ergebnisse der vorhergehenden Kapitel zusammengeführt und die eigenständige Interpretation Büchners herausgestellt.
Schlüsselwörter
Georg Büchner, Dantons Tod, Georges Jacques Danton, Vormärz, Deutscher Bund, Französische Revolution, Historiografie, Dramaturgie, Quellenanalyse, Heimat, Restauration, Jakobiner, Revolution, Geschichte, Literatur, Politische Strömungen
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Darstellung Georges Jacques Dantons in Georg Büchners "Dantons Tod"
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Bachelorarbeit untersucht die Darstellung Georges Jacques Dantons in Deutschland um 1835 und vergleicht sie kritisch mit Georg Büchners Darstellung in seinem Drama „Dantons Tod“. Der Fokus liegt auf den Übereinstimmungen und Unterschieden sowie auf Büchners Umgang mit seinen historischen Quellen.
Welche Aspekte werden im Einzelnen betrachtet?
Die Arbeit analysiert das Bild Dantons in Deutschland um 1835 im Kontext des Vormärz, Büchners Quellen und deren Einfluss, den Vergleich zwischen historischer und dramatischer Darstellung, Büchners kreative Gestaltung der Figur Danton und die Rolle Dantons in der Französischen Revolution und seine Rezeption im Vormärz.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, drei Hauptkapiteln und einem Fazit. Die Einleitung beschreibt den literaturgeschichtlichen Kontext und die Methodik. Kapitel 1 beleuchtet das Bild Dantons in Deutschland um 1835 im Kontext der politischen Situation. Kapitel 2 analysiert Büchners Umgang mit seinen Quellen, insbesondere "Unsere Zeit". Kapitel 3 vergleicht das historische und dramatische Dantonbild.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf diverse Quellen, insbesondere auf "Unsere Zeit" als wichtige Quelle für Büchners Drama "Dantons Tod". Weitere Quellen werden in der Arbeit explizit genannt und erläutert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Georg Büchner, Dantons Tod, Georges Jacques Danton, Vormärz, Deutscher Bund, Französische Revolution, Historiografie, Dramaturgie, Quellenanalyse, Heimat, Restauration, Jakobiner, Revolution, Geschichte, Literatur, Politische Strömungen.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine vergleichende Methode, die historische Quellen mit Büchners Dramaturgie konfrontiert. Sie analysiert den Umgang Büchners mit seinen Quellen und die Auswirkungen auf seine Interpretation der Figur Danton.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit fasst die Ergebnisse der einzelnen Kapitel zusammen und stellt die eigenständige Interpretation Büchners heraus, indem es die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen der historischen und dramatischen Darstellung Dantons beleuchtet.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für Leser gedacht, die sich für Georg Büchner, "Dantons Tod", die Französische Revolution, den Vormärz und die historische Dramaturgie interessieren. Sie richtet sich insbesondere an ein akademisches Publikum.
Wo finde ich den vollständigen Text?
Der vollständige Text ist in der Originalpublikation zu finden (genaue Quelle müsste hier ergänzt werden).
- Quote paper
- Christian Kremer (Author), 2015, Das Bild des Georges Jacques Danton in Deutschland um 1835 und Georg Büchners Darstellung des Georg Danton in einer kritischen Gegenüberstellung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/316024