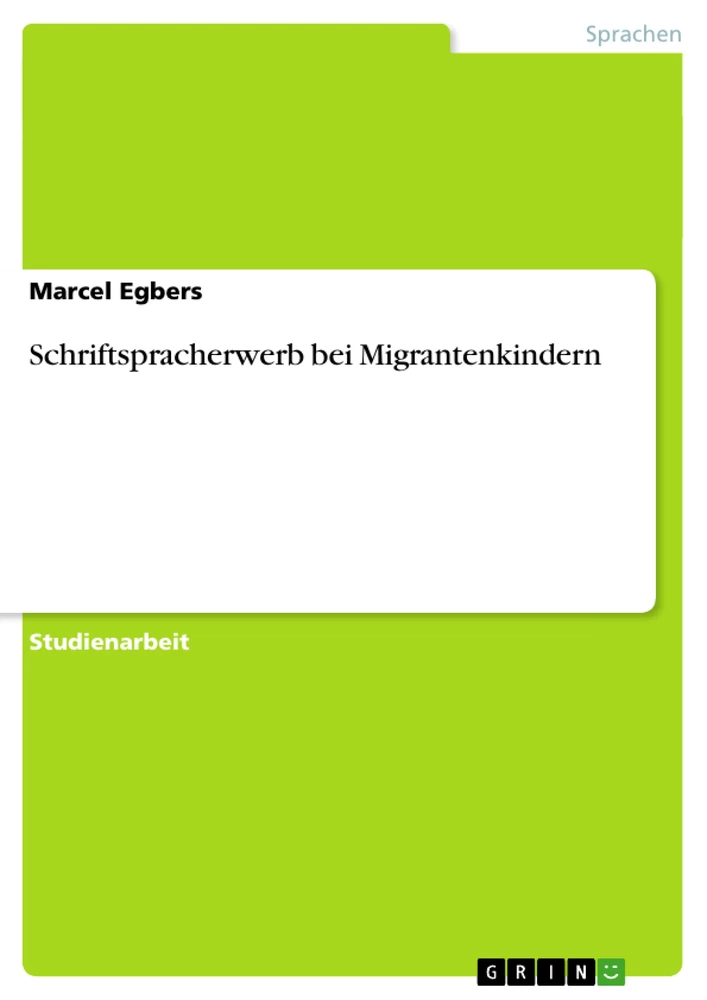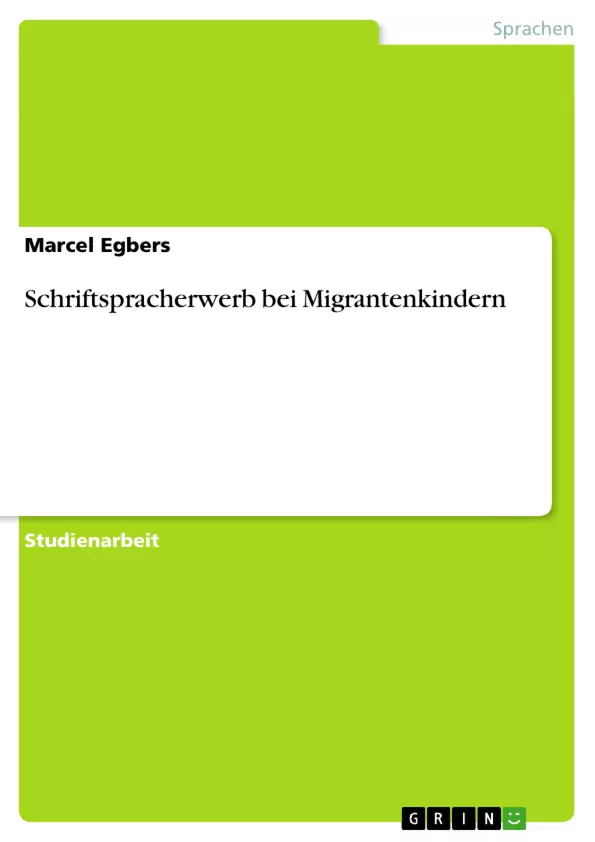[...] Diese und ähnliche Ansichten bekommen Lehrer und Lehrerinnen immer wieder zu hören, wenn es darum geht, immigrierten Kindern einen speziellen Unterricht in ihrer Muttersprache anzubieten. Zum Großteil sind es sogar die Eltern solcher Kinder, die überzeugt sind, die Konzentration auf die eigene Sprache behindere das Erlernen der zweiten Sprache Deutsch. Dies spiegelt die in der Bevölkerung weit verbreitete Meinung wider, dass eine gleichzeitige Förderung der Muttersprache bei Migrantenkindern negative Folgen hat, wenn es um die Beherrschung und das Erlernen des Deutschen geht. Betrachtet man hingegen die Ansichten von Sprachwissenschaftlern und Sprachdidaktikern, so herrschte dort lange größtenteils Einigkeit, dass es am besten sei „ein Kind, welches in der Familie einsprachig erzogen worden ist, in der Schule zunächst ebenfalls einsprachig zu erziehen. Eine zweite Sprache solle erst dann eingeführt werden, wenn die muttersprachliche Entwicklung zu einem gewissen Abschluß gelangt sei.“ Begründet wurde diese Forderung meist mit der Behauptung, „daß eine ungestörte altersentsprechende Entwicklung der Muttersprache die Voraussetzung für eine normale psychosoziale und kognitive Entwicklung sei und damit auch die Voraussetzung für den erfolgreichen Erwerb weiterer Sprachen.“ Doch wenn unter Linguisten und Didaktikern größtenteils Einigkeit geherrscht hatte, erschließt sich daraus auch, dass es von dieser These abweichende Stimmen gab und gibt. So urteilt unter anderem Suzanne Romaine, es sei unter bestimmten Voraussetzungen durchaus sinnvoll, wenn Kinder erstmal solange in ihrer Muttersprache unterrichtet werden, bis sie in dieser ein bestimmtes Niveau erreicht hätten; gleichzeitig merkt sie jedoch an, dass in vielen Fällen eine frühe Erziehung zur Mehrsprachigkeit in der Schule vollkommen unproblematisch ist. Doch die Position Romaines wird im nächsten Kapitel genauer erläutert werden. Festzuhalten ist zunächsteinmal, dass im Bereich der Spracherziehung die Meinungen weit auseinandergehen: [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Ein Thema und die Vielzahl an Meinungen
- 2. Bisherige Untersuchungen zum Zweitspracherwerb in der Schule
- 2. 1 Forschung zur bilingualen Erziehung – von Skepsis zur Euphorie
- 2. 2 Überblick einzelner Untersuchungen zum Zweitspracherwerb in der Schule
- 2.2.1 Studien von Leo Weisgerber (1966)
- 2.2.2 Studien von Lambert/Tucker (1972)
- 2.2.3 Studien von Skutnabb-Kangas/Toukomaa (1976)
- 3. Cummins
- 3.1 Interdependenz- und Schwellenhypothese
- 3.2 Kritik an Cummins Thesen
- 4. Die Bedeutung von Cummins Thesen für den Schulunterricht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beleuchtet die unterschiedlichen Standpunkte zum Thema Zweitspracherwerb bei Migrantenkindern und stellt mit den Hypothesen von Cummins einen möglichen Erklärungsansatz für divergierende Forschungsergebnisse vor. Sie untersucht, welche Umstände das Lernen der Zweitsprache beeinflussen und inwiefern Wechselwirkungen beim Lernen von Erst- und Zweitsprache auftreten.
- Die unterschiedlichen Ansichten zum Zweitspracherwerb bei Migrantenkindern.
- Cummins Interdependenz- und Schwellenhypothese als Erklärungsansatz für divergierende Forschungsergebnisse.
- Die Bedeutung von Cummins Thesen für den Schulunterricht.
- Die Herausforderungen der sprachlichen Integration von Migrantenkindern in Deutschland.
- Die Rolle der Schule bei der Förderung der Zweitspracherwerbskompetenz von Migrantenkindern.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die unterschiedlichen Meinungen zum Thema Zweitspracherwerb bei Migrantenkindern und stellt die gängige Forschungsmeinung zum Thema vor. Es thematisiert die weit verbreitete Ansicht, dass eine gleichzeitige Förderung der Muttersprache negative Folgen für das Erlernen des Deutschen hat.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Ergebnisse verschiedener Untersuchungen zum Zweitspracherwerb in der Schule. Es analysiert die Studien von Weisgerber, Lambert/Tucker und Skutnabb-Kangas/Toukomaa und diskutiert die Ergebnisse dieser Forschung.
Das dritte Kapitel stellt Cummins Interdependenz- und Schwellenhypothese vor und beleuchtet die Kritik an seinen Thesen. Es erklärt, wie Cummins Thesen die Wechselwirkungen zwischen Erst- und Zweitspracherwerb erklären können.
Schlüsselwörter
Zweitspracherwerb, Migrantenkinder, Bilingualismus, Cummins, Interdependenz- und Schwellenhypothese, Sprachliche Integration, Schriftspracherwerb, Lesekompetenz, PISA-Studie, Schulunterricht.
Häufig gestellte Fragen
Behindert die Förderung der Muttersprache das Erlernen von Deutsch?
Entgegen weit verbreiteter Meinung zeigen linguistische Theorien, dass eine gut entwickelte Erstsprache oft die Voraussetzung für den erfolgreichen Erwerb einer Zweitsprache ist.
Was besagt Cummins Interdependenzhypothese?
Sie besagt, dass kognitive Fähigkeiten in der Erst- und Zweitsprache voneinander abhängig sind und Kompetenzen von einer Sprache auf die andere übertragen werden können.
Was ist die Schwellenhypothese?
Diese Hypothese besagt, dass Kinder ein bestimmtes Kompetenzniveau in beiden Sprachen erreichen müssen, um von den kognitiven Vorteilen der Zweisprachigkeit zu profitieren.
Warum ist Schriftspracherwerb für Migrantenkinder eine Herausforderung?
Herausforderungen entstehen oft durch mangelnde Förderung der Erstsprache und die Notwendigkeit, Bildungssprache in einer noch nicht voll beherrschten Zweitsprache zu erwerben.
Welche Rolle spielt die Schule bei der bilingualen Erziehung?
Schulen können durch gezielten muttersprachlichen Unterricht und die Anerkennung der Mehrsprachigkeit den Bildungserfolg von Migrantenkindern maßgeblich unterstützen.
- Citation du texte
- Marcel Egbers (Auteur), 2004, Schriftspracherwerb bei Migrantenkindern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31615