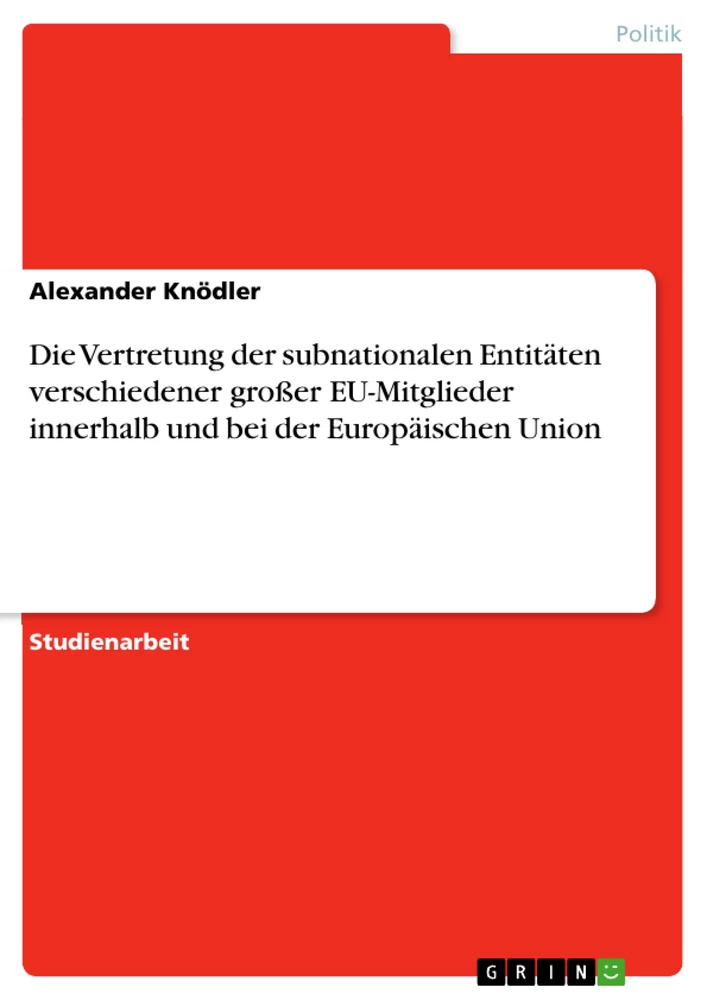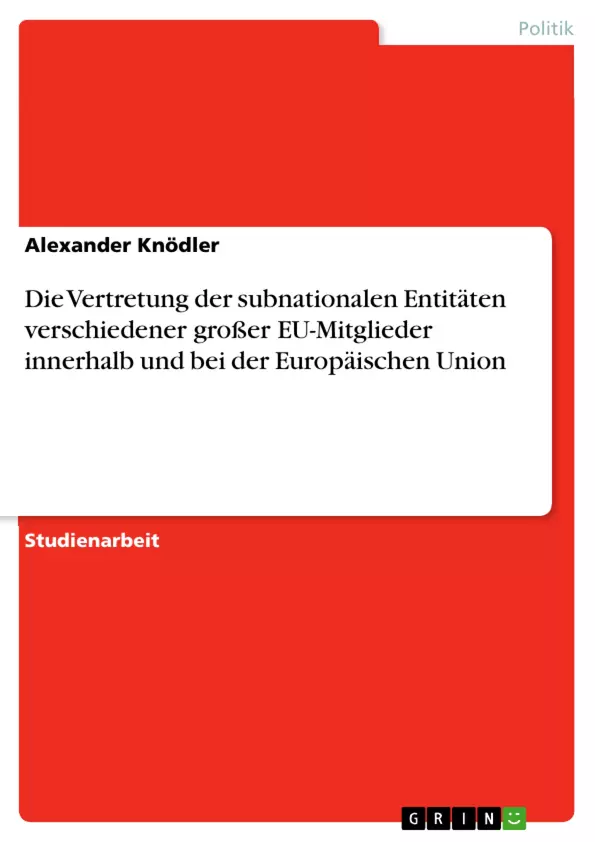Die Europäische Union fasst mit seinen heutigen 28 Mitgliedsstaaten nicht nur mehr als eine halbe Millarde Einwohner, es sind auch besonders viele von ihnen auf recht wenige Länder konzentriert. Natürlich ist der Staatenverbund neben vielen andere Dichotomien vor allem auch auf den Ausgleich zwischen kleinen und großen Nationen bedacht, doch verschwinden die Unterschiede innerhalb der großen Nationen allzu häufig hinter dem Primat der Mitgliedsstaaten. Auf ähnliche Weise, wie die Existenz des Mezzogiorno als komischer Kauz in der Wirtschaftswunder-EG für die Einrichtung der Kohäsionsfonds gesorgt hat und ärmere Neumitglieder später von ihm profitierten, führte die Existenz einer Bundesrepublik Deutschland innerhalb eines von Einheitsstaaten bevölkerten Staatenbundes langfristig zum Ausschuss der Regionen, das auch als Forum für Regionen anderer Länder taugt, die sich mit ihren Interessen scheinbar allein gelassen fühlen.
Nun sind es aber gerade die post-transformatorischen Erweiterungen, die von besonderem Interesse sind, da eine demokratische Systemtransformation eben auch die (Wieder-)Einführung einer entsprechend demokratischen kommunalen Selbstverwaltung nach sich zieht und es sich daher anbietet, überkommene, einer Top-Down-Logik herrührende Verwaltungsstrukturen durch neue Bottom-Up-Strukturen zu ersetzen, in der die Mittelinstanzen viel mehr der Gestaltung von unten als der Befehlsausführung von oben dienen.
Überhaupt wird befürchtet, dass eine verstärkte Union zu einer Verschleifung der identitären Besonderheiten seiner nachgeordneten Mitglieder führt. Das ist nicht nur ein Problem für den Patriotismus, sondern auch für die Vitalität des Gesamtsystems, denn jedes gesunde Gemeinwesen baut auf darunter liegenden Strukturen auf und sucht sie zu stützen, nicht sie zu ersetzen. Sogar der Papst hat zwischen den Weltkriegen in einer Enzyklika genau dies verlautbart und wird auch in wissenschaftlicher Literatur dazu zitiert und was für die karitative Wohlfahrt gilt, gilt eben auch für politische Systeme. Dieser Subsidiarität allerdings Geltung zu verschaffen, bedarf in einem großzügig dimensionierten politischen System gewisser institutioneller Voraussetzungen. Hilfreich bei deren Ausgestaltung hat sich aber die Dezentralisierungswelle bei einigen großen Einheitsstaaten gezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wozu ein Europa der Regionen?
- Der Ausschuss der Regionen - Ein formelles Organ des regionalen Lobbying
- Ländervertretungen & Co. - Informelle Kanäle des regionalen Lobbying
- Forschungsfrage und Anliegen der Seminararbeit
- Hypothesen und Argumente
- Hypothesenpaket A: Regionalbüros bei der Europäischen Union
- Hypothesenpaket B: Ausschuss der Regionen
- Methodischer Ansatz
- Vergleichende Politikwissenschaft
- Die Fallbeispiele: UK, Frankreich, Italien, Polen, Spanien, Deutschland
- Empirische Analyse
- Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland
- Vorgeschichte
- Regionalbüros aus dem Vereinigten Königreich
- Das Königreich im Ausschuss der Regionen
- Überprüfung der Hypothesen
- Französische Republik
- Vorgeschichte
- Regionalbüros aus Frankreich
- Frankreich im Ausschuss
- Überprüfung der Hypothesen
- Italienische Republik
- Vorgeschichte
- Regionalbüros aus Italien
- Italien im Ausschuss
- Überprüfung der Hypothesen
- Republik Polen
- Vorgeschichte
- Regionalbüros aus Polen
- Polen im Ausschuss
- Überprüfung der Hypothesen
- Königreich Spanien
- Vorgeschichte
- Regionalbüros aus Spanien
- Spanien im Ausschuss
- Überprüfung der Hypothesen
- Bundesrepublik Deutschland
- Vorgeschichte
- Ländervertretungen und sonstige Büros
- Deutschland im Ausschuss
- Überprüfung der Hypothesen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht, wie sich die subnationalen Strukturen der Mitgliedsstaaten auf das Wirken ihrer Subjekte bei der Europäischen Union auswirken. Sie analysiert die Rolle von Regionalbüros und dem Ausschuss der Regionen, wobei der Fokus auf sechs großen EU-Ländern mit über 30 Millionen Einwohnern liegt.
- Die Rolle von Regionalbüros als Instrument des regionalen Lobbying
- Der Einfluss der subnationalen Strukturen auf die Vertretung im Ausschuss der Regionen
- Die Bedeutung der regionalen Autonomie für die Interessenvertretung in der EU
- Die vergleichende Analyse von Regionalregimen in verschiedenen EU-Staaten
- Die Auswirkungen der EU-Erweiterung auf die Rolle von Regionen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Seminararbeit widmet sich der Frage, warum ein Europa der Regionen notwendig ist. Es beleuchtet die Herausforderungen des Ausgleichs zwischen kleinen und großen Nationen sowie die Bedeutung der dezentralisierten Strukturen für eine lebendige Demokratie. Das zweite Kapitel stellt die Hypothesen zur Rolle von Regionalbüros und dem Ausschuss der Regionen auf. Das dritte Kapitel erläutert den methodischen Ansatz der Arbeit, der auf der vergleichenden Politikwissenschaft mit der Differenzmethode basiert. Die empirische Analyse in Kapitel vier untersucht sechs Fallbeispiele: UK, Frankreich, Italien, Polen, Spanien und Deutschland. Jedes Land wird hinsichtlich seiner subnationalen Strukturen, der Rolle von Regionalbüros und der Vertretung im Ausschuss der Regionen analysiert. Die Überprüfung der Hypothesen erfolgt in jedem Kapitel separat. Das Fazit fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit beschäftigt sich mit den Themen des regionalen Lobbying, der subnationalen Strukturen, des Ausschuss der Regionen, der EU-Erweiterung, der regionalen Autonomie, der vergleichenden Politikwissenschaft und den Fallbeispielen UK, Frankreich, Italien, Polen, Spanien und Deutschland.
- Citar trabajo
- Alexander Knödler (Autor), 2014, Die Vertretung der subnationalen Entitäten verschiedener großer EU-Mitglieder innerhalb und bei der Europäischen Union, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/316194