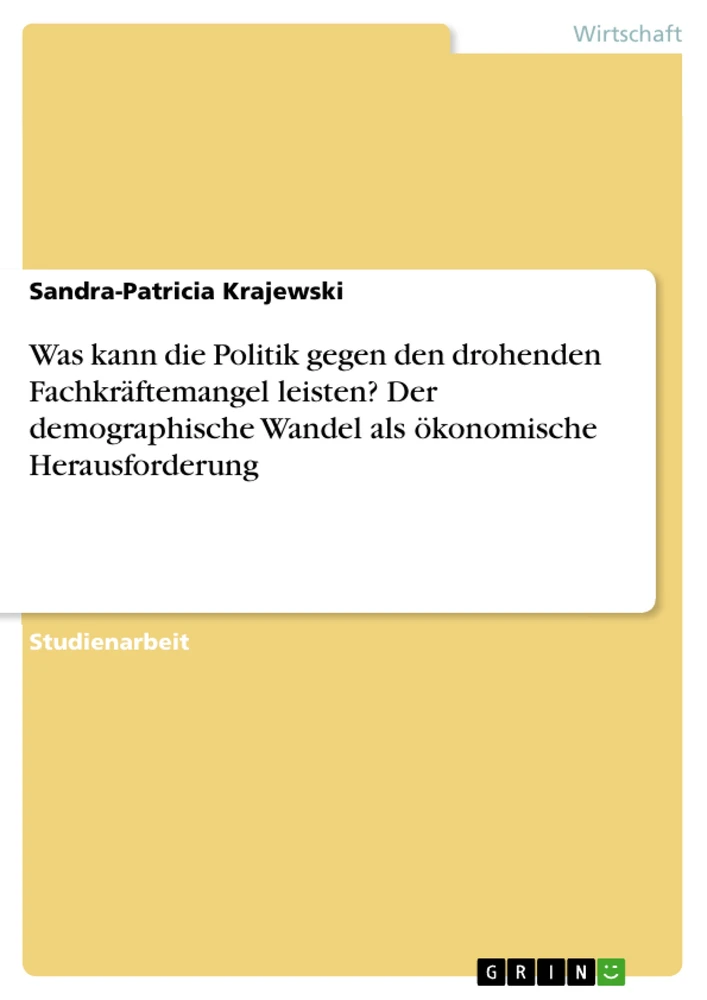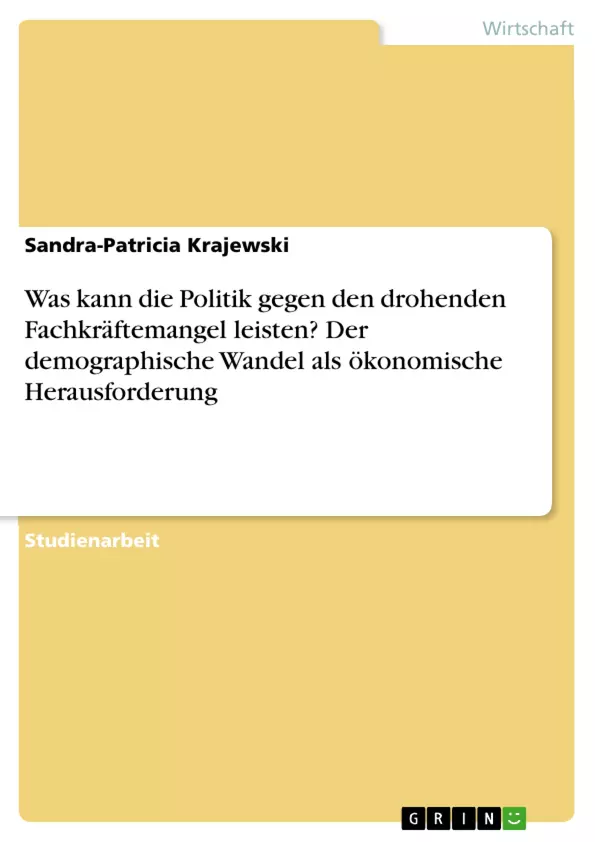Der demographische Wandel prägt die deutsche Bevölkerung seit Ende der 60er Jahre. Inzwischen ist es ein weit verbreitetes Diskussionsthema, das uns in den verschiedensten Lebensbereichen begegnet. Das Ausmaß, welches der demographische Wandel mit sich bringt, galt in der Anfangsphase als schwer vorstellbar. Volkswirtschaftliche Modelle und ein dadurch entstandener Ausblick in die Zukunft beantworten die aufgeworfenen Fragen pessimistisch. Die Konsequenz daraus ist, dass eine Ungewissheit entsteht, welche Auswirkung der demographische Wandel auf die Bevölkerung und die Wirtschaft hat.
Dieses eher negative Bild hat sich in den letzten Jahren in Deutschland weit verbreitet und in den Köpfen gefestigt. Die Sozialsysteme der deutschen Rentenversicherung und das Gesundheitssystem werden in Frage gestellt. Auf der anderen Seite muss die steigende Lebenserwartung, der medizinische Fortschritt und die dadurch resultierende besser werdende Gesundheit betrachtet werden, denn dies ist eine wichtige Ressource für die Gesellschaft. Eine längere Erwerbstätigkeit ohne große Einbußen an Lebensqualität wird ermöglicht.
Ob der demographische Wandel unseren Sozialstaat und Lebensstandard bedroht, ist nicht zu 100 Prozent auszuschließen, sondern hängt eindeutig davon ab, welche künftigen wirtschafts-, sozial- und arbeitsmarktpolitischen Entscheidungen getroffen werden, welche Chancen sich daraus ergeben und wie die Reaktion der deutschen Bevölkerung darauf ist. Für das 21. Jahrhundert ist der demographische Wandel einer der ‚Megatrends‘, der die ökonomische, soziale und politische Situation unseres Landes und weltweit verändern wird.
Die eingeschlichenen Veränderungen in der Geburtenhäufigkeit, der Sterberate und der Abwanderungen in andere Länder stellen den deutschen Staat vor Veränderungen und neue Aufgaben. Erste Auswirkungen des Wandels zeichnen sich auf dem Arbeitsmarkt und in der deutschen Wirtschaft ab. Die Zahl der Erwerbstätigen wird immer mehr abnehmen und schon heutzutage ist in einigen Branchen Fachkräftemängel zu verzeichnen. Der einstige Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle stellte die Behauptung auf, dass der Fachkräftemangel in den nächsten Jahren zum Schlüsselproblem werde.
Die Bürger aus dem Inland haben Potenzial, die Lücke teilweise zu schließen. Die rückläufigen Geburtenraten zeigen dennoch auf, dass die Einwohner in Deutschland allein nicht ausreichen werden, um den Bedarf an Fachkräften zu erfüllen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Allgemeine Einleitung
- 1.2. Zielsetzung der Arbeit
- 1.3. Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit
- 2. Der demographische Wandel
- 2.1. Die weltweiten Veränderungen des demographischen Wandels
- 2.2. Der demographische Wandel in Deutschland
- 2.2.1. Geburtenzahl
- 2.2.2. Lebenserwartungen
- 2.2.3. Zuwanderung
- 2.3. Der demographische Wandel in Deutschland im Bezug auf Fachkräfte
- 3. Aktuelle Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel in Deutschland
- 3.1. Die gesteuerte Zuwanderung in Deutschland
- 3.2. Steigerung der Erwerbsquote der Frauen
- 3.3. Beschäftigungssicherung älterer Arbeitsnehmer
- 4. Was kann die Politik leisten?
- 4.1. Investitionsmodel Bildung und Ausbildung
- 4.2. Qualifizierte Zuwanderung nach Deutschland
- 5. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den demographischen Wandel als ökonomische Herausforderung und untersucht, welche Maßnahmen die Politik gegen den drohenden Fachkräftemangel ergreifen kann.
- Analyse des demographischen Wandels in Deutschland und seinen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt
- Bewertung der aktuellen politischen Maßnahmen zur Bekämpfung des Fachkräftemangels
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen für die Politik zur Bewältigung der Herausforderung
- Untersuchung des Potenzials der Zuwanderung zur Deckung des Fachkräftebedarfs
- Bewertung der Bedeutung von Bildung und Ausbildung zur Sicherung der zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik des demographischen Wandels ein und beleuchtet dessen Bedeutung als "Megatrend" für die deutsche Wirtschaft und Gesellschaft. Dabei wird auf die demographische Entwicklung weltweit und in Deutschland eingegangen, wobei die sinkenden Geburtenraten, die steigende Lebenserwartung und die Abwanderung als wesentliche Faktoren hervorgehoben werden.
Kapitel zwei fokussiert auf den demographischen Wandel in Deutschland im Kontext des Fachkräftemangels. Es werden die Herausforderungen durch den Rückgang der Erwerbstätigen und die Folgen für verschiedene Branchen beleuchtet. Zudem wird die Frage nach dem Potenzial der Zuwanderung zur Deckung des Fachkräftebedarfs aufgeworfen.
Das dritte Kapitel befasst sich mit den aktuellen politischen Maßnahmen zur Bekämpfung des Fachkräftemangels in Deutschland. Hier werden die Schwerpunkte auf die Steuerung der Zuwanderung, die Steigerung der Erwerbsquote von Frauen und die Beschäftigungssicherung älterer Arbeitnehmer gelegt.
Kapitel vier widmet sich der Frage, welche Möglichkeiten die Politik zur Bewältigung der Herausforderung des Fachkräftemangels hat. Es werden Investitionen in Bildung und Ausbildung sowie die Förderung qualifizierter Zuwanderung als zentrale Handlungsfelder identifiziert.
Schlüsselwörter
Der demographische Wandel, Fachkräftemangel, Zuwanderung, Bildung, Ausbildung, Arbeitsmarkt, Politik, Wirtschaft, Sozialstaat, Lebensstandard, Erwerbsquote, Altersstruktur, Megatrend.
- Quote paper
- Sandra-Patricia Krajewski (Author), 2015, Was kann die Politik gegen den drohenden Fachkräftemangel leisten? Der demographische Wandel als ökonomische Herausforderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/316243