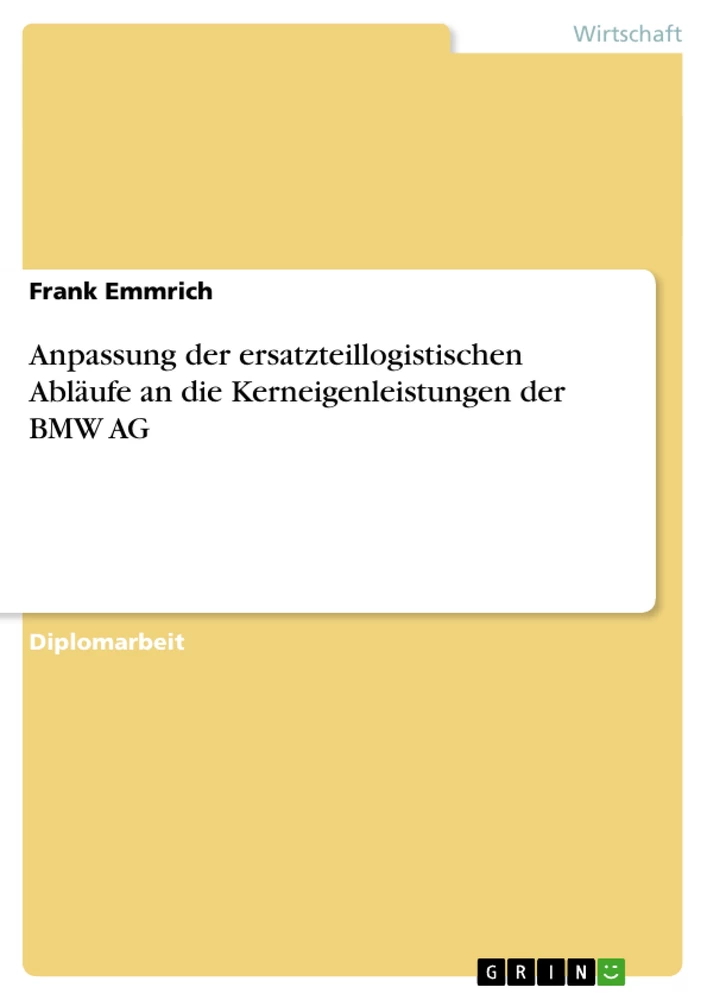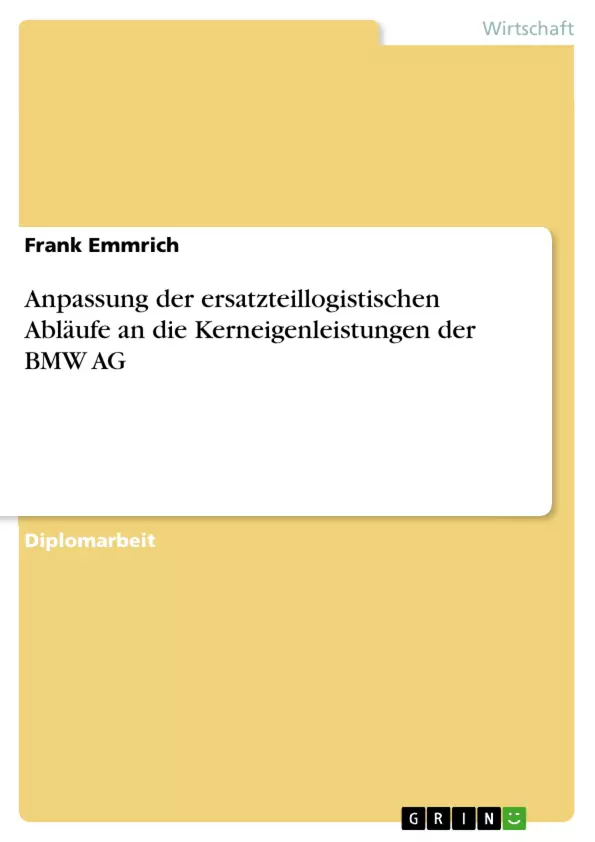Um die Ersatzteillogistik im Bereich von TA-32 effektiver zu gestalten, wurde im Auftrag vom Arbeitskreis Maintenance und der Hauptabteilung TA-3 im 2. Quartal 2003 das Projekt „IH-Ersatzteilmanagement“ initiiert. Das anvisierte Ziel ist es, den Bestell- und Lageraufwand der zu bevorrateten Ersatzteile erheblich zu senken und Bestellvorgänge zu optimieren. Bei den Betrachtungen muss darauf geachtet werden, dass es zu keiner Zeit zu einem Produktionsabriss durch fehlende Teile kommen darf. Dieser würde den evtl. erbrachten Benefit um ein Vielfaches übersteigen. Einerseits müssen die Montage- und Fertigungsanlagen bei einem maschinenbedingten Stillstand schnellstmöglich wieder einsatzfähig gemacht werden, egal welches Teil ausfällt, andererseits sollte der im Lager befindliche Ersatzteilbestand aus wirtschaftlicher Sicht minimale Bestände aufweisen. In der vorliegenden Arbeit wird sich mit der Problematik dieser beiden konträren Ziele auseinandergesetzt und versucht, eine strategisch adäquate Lösung für diese Probleme zufinden. Die Hauptaufgabenstellung des Projekts ist das Bearbeiten und Umsetzen der formulierten Ziele des Arbeitskreises Maintenance.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 1.1 Die BMW AG
- 1.1.1 Geschichte der BMW AG
- 1.1.2 BMW in Zahlen
- 1.2 Hinführung zum Thema
- 1.2.1 Aufgabe
- 1.2.2 Aufgabenstellung
- 1.2.2.1 Hauptaufgaben
- 1.2.2.2 Aufgaben der Diplomarbeit
- 1.2.2.3 Nebenaufgaben
- 1.2.3 Zielstellung
- 2 Darstellung des Ist-Zustandes
- 2.1 Vorstellung des Maschinenspektrums der Abteilung TA-32
- 2.1.1 TA-320
- 2.1.2 TA-321
- 2.1.3 TA-322
- 2.1.4 TA-323
- 2.1.5 Allgemeines
- 2.2 Ist–Zustand der Instandhaltungsorganisation
- 2.2.1 Instandhaltungsstrategien
- 2.2.1.1 Crash Instandhaltung (Ungeplante Instandhaltung)
- 2.2.1.2 Vorbeugende Instandhaltung (Vorbeugend geplante Instandhaltung)
- 2.2.1.3 Risikobasierende Instandhaltung (Geplante Instandhaltung)
- 2.3 Abgrenzung der Untersuchungsgegenstände
- 2.3.1 Lagerorte und Inhalte bei TA-323
- 2.3.1.1 Motorenlager Halle 60 UG
- 2.3.1.2 Stützpunktlager Geb. 43 OG und Geb. 70 OG
- 2.3.1.3 (Zentrales) IH-Lager in der Halle 70 EG (Lager 3210601)
- 2.3.1.4 Zentrallager für mechanische DIN und Normteile
- 2.3.2 Zusammenfassendes
- 2.4 Ist-Analyse der ersatzteillogistischen Abläufe am Standort 2.1
- 2.4.1 Hauptgruppen
- 2.4.2 Systemlieferant
- 2.4.3 Beschreibung der gegenwärtigen Bedarfsfeststellung
- 2.4.4 Beschaffungsvorgänge von IH-Material im Werk 2.1
- 2.4.4.1 Bestellung bei Systemlieferanten
- 2.4.4.2 Bestellung bei Lieferanten
- 2.4.4.3 Bedarf kann über das Zentrallager befriedigt werden
- 2.4.4.4 Bedarf kann nicht über das Zentrallager befriedigt werden
- 2.4.4.5 Innerbetrieblicher Transport
- 2.4.4.6 Zeitbetrachtung für das Lager 3210601
- 2.4.4.6.1 Aufwand bei der Bedarfsfeststellung
- 2.4.4.6.2 Aufwand bei der Bedarfsmeldung
- 2.4.4.6.3 Aufwand für die Bestellung der Artikel durch TD-130
- 2.4.4.6.4 Aufwand für innerbetrieblichen Transport
- 2.4.4.6.5 Aufwand für das Einsortieren der Ware.
- 2.4.4.6.6 Berechnung des gesamten Zeitaufwandes
- 2.4.5 Erstausstattung von Produktionsmaschinen mit Ersatzteilen
- 2.4.6 EDV- Systeme und Ersatzteildokumentation
- 2.4.6.1 IH-MAT
- 2.4.6.2 SAP
- 2.4.6.2.1 Verwalten von Störungsmeldungen
- 2.4.6.2.2 Maschinenbezogene Datenbank (im Aufbau)
- 2.4.6.3 Probleme bei der Datenauswertung
- 2.4.6.4 Beispielhafte Analyse an eine Engpassmaschine
- 2.4.6.4.1 Untersuchung des Teilespektrums nach Kapitalintensität
- 2.4.6.4.2 Berechnung der Opportunitätskosten
- 2.4.6.4.3 Fazit
- 3 Ideenfindung / Aufbau und Inbetriebnahme des Lagers
- 3.1 Begriffsbestimmung
- 3.1.1 Vorbild
- 3.1.1.1 A, B und C-Teile
- 3.1.1.1.1 Eigenschaften von A-Teilen
- 3.1.1.1.2 Eigenschaften von B-Teilen
- 3.1.1.1.3 Eigenschaften von C-Teilen
- 3.1.1.2 Modifizieren der Begriffe
- 3.1.1.2.1 C-Teile JIT-Ersatzteilpool
- 3.1.1.2.2 B-Teil Langsamdreher
- 3.1.1.2.3 A-Teile maschinengebundene Teile
- 3.1.2 Lagerkonzept
- 3.2 Auswahl des zukünftigen Servicepartners
- 3.2.1 Firma Altmann
- 3.2.2 Firma Zitec
- 3.2.3 Bestimmen des Lieferanten
- 3.2.3.1 Lieferspektrum & Kompetenzen
- 3.2.3.2 Entfernung & Service
- 3.2.3.3 Erfahrungen und Partner
- 3.2.4 Parallelen zu anderen Servicepartnern
- 3.3 Festlegen des Teilespektrums in der 1. Phase
- 3.3.1 Bestimmen der Lagerart
- 3.3.2 Lagerstruktur
- 3.3.2.1 Lagerortauswahl
- 3.3.2.1.1 Halle 43 (Lager3210021)
- 3.3.2.1.1.1 Entfernung
- 3.3.2.1.1.2 Umlagerung der Elektroteile
- 3.3.2.1.1.3 Platzbedarf in der Zukunft
- 3.3.2.1.2 Halle 72 (Lager 3210601)
- 3.3.2.1.2.1 Lagerumgestaltung
- 3.3.2.2 Fazit
- 3.3.3 Berechnung der Teileanzahl im zukünftigen Lager
- 3.3.3.1 Lagertyp und Ausstattung
- 3.3.3.2 Berechung
- 3.3.3.2.1 Zusammenfassung der einzelnen Berechnungen
- 3.3.4 Festlegen das Regallayouts und bestimmen der Grundfläche
- 3.3.4.1 Variante 1
- 3.3.4.2 Variante 2
- 3.3.4.3 Verteilung der Gruppen im Lager
- 3.3.4.4 Erweiterung der Lagerkapazität durch eine Bühne
- 3.3.4.4.1 Kostenschätzung für das Errichten der Bühne
- 3.3.4.5 Aufstocken der unteren Regaleinheiten
- 3.3.4.5.1 Kostenschätzung für Erweiterung durch Aufstockung
- 3.3.4.5.1.1 Auswertung
- 3.3.4.6 Kostenvergleich
- 3.3.4.6.1 Weitere Aufwendungen
- 3.3.4.6.2 Zusammenfassung
- 3.3.5 Disposition der Artikel im neuen Lager
- 3.3.5.1 Bewirtschaftung des Lagers in der 1. Umsetzungsphase
- 3.3.5.2 Entnahmeprinzip
- 3.3.5.2.1 Das Supermarktprinzip
- 3.3.5.2.1.1 Was ist das Supermarktprinzip?
- 3.3.5.2.1.2 Funktionsweise des Supermarktprinzips
- 3.3.5.2.1.3 Grafische Darstellung des Supermarktprinzips
- 3.3.5.2.2 Praktischer Entnahmevorgang
- 3.3.5.2.2.1 Ablaufbeschreibung
- 3.3.5.2.2.1.1 Behälterware
- 3.3.5.2.2.1.2 Kartonware
- 3.3.5.2.2.1.3 Riemen
- 3.3.5.2.3 Merkmale des Supermarktprinzips
- 3.3.5.2.4 Vor und Nachteile des Supermarktprinzips
- 3.3.5.2.4.1 Vorteile
- 3.3.5.2.4.1.1 Bereinigung des Artikelstammes
- 3.3.5.2.4.1.2 Teilestandardisierung
- 3.3.5.2.4.1.3 Bestandsreduzierung
- 3.3.5.2.4.1.4 Prozesskostenreduzierung
- 3.3.5.2.4.2 Nachteile
- 4 Angriffspunkte für die Projektphase 2
- 4.1 Erweiterung des Artikelstammes
- 4.1.1 Aufzeigen des Einsparungspotentials
- 4.1.1.1 C-Teile
- 4.1.1.2 C-Plus-Teile
- 4.1.1.3 Elektro- und maschinengebundene Teile
- 4.1.1.4 Zusammenfassung
- 4.2 Zukünftige Aufgaben
- 4.3 Verbuchung von Ersatzteilen
- 4.3.1 Beispiel
- 4.3.2 Aufgaben
- 4.3.3 Ablauf der Verbuchung
- 4.3.3.1 Manuell
- 4.3.3.1.1 Wer verbucht
- 4.3.3.2 Halbautomatisch
- 4.3.3.3 Automatisch
- 4.3.3.3.1 RFID
- 4.3.3.3.1.1 Funktionsweise RFID
- 4.3.3.3.1.2 Mögliches Layout für eine RFID-Station
- 4.3.3.3.1.3 Ablauf
- 4.3.3.3.1.4 Geschätzte Kosten
- 4.3.3.3.1.5 Nachteile
- 4.3.4 Einführung von Barcode und RFID- Technologie
- 4.3.4.1 Barcode
- 4.3.4.2 RFID
- 4.3.4.3 Zusammenfassendes
- 4.4 Erweitern des Lagers um Hilfs- und Betriebsstoffe
- 4.4.1 Hilfsstoffe
- 4.4.2 Betriebsstoffe
- 4.5 Schaffung von Stützpunktlagern
- 4.6 Werksinterner Synergieeffekt
- 4.7 Einführung eines modernen Warenwirtschaftssystems
- 4.8 Berücksichtigen von eCl@ss und BMEcat
- 4.8.1 Elektronische Beschaffung
- 4.8.1.1 Klassifikation als effizientes Werkzeug
- 4.8.1.2 Nutzen im Unternehmen
- 4.8.2 Kurzbeschreibung eCl@ss
- 4.8.2.1 Was ist eCl@ss
- 4.8.2.2 Der Nutzen für die Instandhaltung
- 4.8.3 BMEcat
- 5 Phase 3
- 5.1 Virtuelles Ersatzteillager
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Neuausrichtung des Ersatzteilmanagements der BMW AG, speziell im Hinblick auf die Konzentration auf das Kerngeschäft und die Auslagerung von Dienstleistungen an externe Partner. Das Hauptziel ist die Senkung der Kapitalbindung und die Reduzierung des internen Aufwands bei Ersatzteilbeschaffung, -lagerung und -verbuchung.
- Analyse des aktuellen Ersatzteilmanagements bei BMW
- Entwicklung eines neuen Lagerkonzepts unter Einbezug externer Partner
- Optimierung der Beschaffungs- und Lagerprozesse
- Bewertung verschiedener Technologien zur effizienteren Ersatzteilverwaltung
- Konzeptionierung eines virtuellen Ersatzteilverbundes
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einführung: Dieses Kapitel führt in das Thema ein, stellt die BMW AG und deren Geschäftsfelder vor und beschreibt den Hintergrund des Projekts zur Neuausrichtung des Ersatzteilmanagements. Es werden die Ziele und die Aufgabenstellung der Diplomarbeit definiert, mit dem Fokus auf die Optimierung der Ersatzteillogistik und die Reduktion von Lagerkosten, ohne die Produktion zu gefährden.
2 Darstellung des Ist-Zustandes: Dieses Kapitel analysiert den aktuellen Zustand des Ersatzteilmanagements bei BMW. Es beschreibt die Lagerstruktur, die Instandhaltungsstrategien, die Beschaffungsabläufe und die verwendeten EDV-Systeme. Die Analyse zeigt Ineffizienzen und hohe Kosten im aktuellen System auf, die durch die Diplomarbeit adressiert werden.
3 Ideenfindung / Aufbau und Inbetriebnahme des Lagers: Dieses Kapitel präsentiert ein neues Lagerkonzept, welches auf einem extern bewirtschafteten Konsignationslager basiert und das Supermarktprinzip nutzt. Es beschreibt die Auswahl eines Servicepartners (Zitec), die Festlegung des Teilespektrums für die erste Phase, die Berechnung des Platzbedarfs, und die Gestaltung des Lagerlayouts. Die Kosten für die Implementierung des neuen Systems werden detailliert dargestellt und bewertet.
4 Angriffspunkte für die Projektphase 2: Das Kapitel skizziert die Erweiterung des Konsignationslagers in der zweiten Projektphase. Es beschreibt die Auswahl zusätzlicher Artikel, die Optimierung der Verbuchung von Ersatzteilen, und die Möglichkeiten zur Einführung von Barcode- oder RFID-Technologie zur Verbesserung der Effizienz. Die Schaffung von Stützpunktlagern und die Nutzung von Synergieeffekten innerhalb des Werkes werden ebenfalls diskutiert.
Schlüsselwörter
Ersatzteilmanagement, BMW AG, Lageroptimierung, Konsignationslager, Supermarktprinzip, Servicepartner, RFID, Barcode, eCl@ss, Kostenreduktion, Kapitalbindung, Bestandsreduzierung, Prozessoptimierung, Virtueller Ersatzteilverbund.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Neuausrichtung des Ersatzteilmanagements bei der BMW AG
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Neuausrichtung des Ersatzteilmanagements der BMW AG. Der Fokus liegt auf der Optimierung der Ersatzteillogistik, der Senkung der Kapitalbindung und der Reduzierung des internen Aufwands bei Beschaffung, Lagerung und Verbuchung von Ersatzteilen.
Welche Ziele werden in der Diplomarbeit verfolgt?
Hauptziel ist die Senkung der Kapitalbindung und die Reduzierung des internen Aufwands bei Ersatzteilbeschaffung, -lagerung und -verbuchung. Die Arbeit analysiert das aktuelle Ersatzteilmanagement, entwickelt ein neues Lagerkonzept mit externen Partnern, optimiert Beschaffungs- und Lagerprozesse und bewertet Technologien zur effizienteren Ersatzteilverwaltung. Ein virtuelles Ersatzteilverbund wird konzeptioniert.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine IST-Analyse des aktuellen Ersatzteilmanagements bei BMW, einschließlich der Lagerstruktur, Instandhaltungsstrategien, Beschaffungsabläufe und EDV-Systeme. Ein neues Lagerkonzept wird entwickelt, welches auf einem extern bewirtschafteten Konsignationslager und dem Supermarktprinzip basiert. Die Auswahl eines Servicepartners wird detailliert beschrieben, ebenso die Berechnung des Platzbedarfs, die Gestaltung des Lagerlayouts und die Kosten für die Implementierung.
Welches Lagerkonzept wird vorgeschlagen?
Die Diplomarbeit schlägt ein neues Lagerkonzept vor, das auf einem extern bewirtschafteten Konsignationslager basiert und das Supermarktprinzip nutzt. Dies beinhaltet die Auswahl eines Servicepartners (Zitec), die Festlegung des Teilespektrums für die erste Phase, die Berechnung des Platzbedarfs und die Gestaltung des Lagerlayouts. Die Kosten für die Implementierung werden detailliert dargestellt und bewertet.
Welche Technologien werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht die Möglichkeiten zur Einführung von Barcode- oder RFID-Technologie zur Verbesserung der Effizienz bei der Verbuchung von Ersatzteilen. Die Implementierung eines modernen Warenwirtschaftssystems und die Nutzung von eCl@ss und BMEcat für die elektronische Beschaffung werden ebenfalls diskutiert.
Welche Phasen umfasst das Projekt?
Das Projekt umfasst mindestens drei Phasen. Phase 1 konzentriert sich auf den Aufbau und die Inbetriebnahme des neuen Konsignationslagers. Phase 2 beinhaltet die Erweiterung des Artikelstammes, die Optimierung der Verbuchungsprozesse und die Implementierung von Barcode- oder RFID-Technologie. Phase 3 umfasst die Konzeptionierung eines virtuellen Ersatzteillagers.
Welche Kosten werden berücksichtigt?
Die Kosten für die Implementierung des neuen Lagerkonzepts werden detailliert dargestellt und bewertet. Dies beinhaltet die Kosten für die Lagergestaltung, die Ausstattung, die Implementierung von Technologien wie RFID und die Zusammenarbeit mit dem externen Servicepartner.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Ersatzteilmanagement, BMW AG, Lageroptimierung, Konsignationslager, Supermarktprinzip, Servicepartner, RFID, Barcode, eCl@ss, Kostenreduktion, Kapitalbindung, Bestandsreduzierung, Prozessoptimierung, Virtueller Ersatzteilverbund.
- Quote paper
- Frank Emmrich (Author), 2004, Anpassung der ersatzteillogistischen Abläufe an die Kerneigenleistungen der BMW AG, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31624