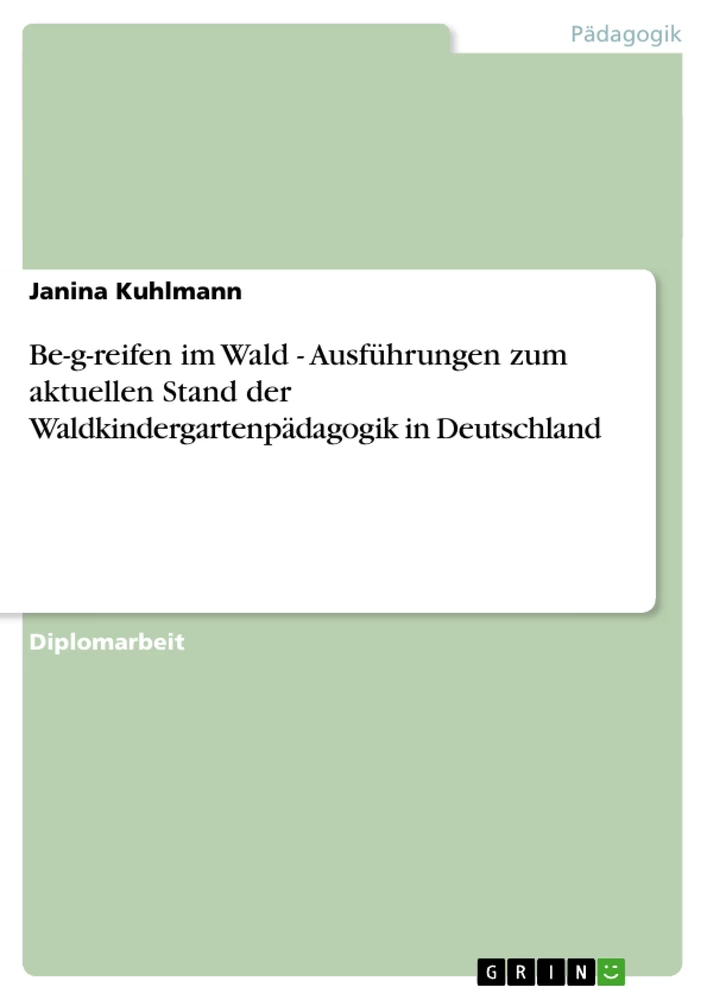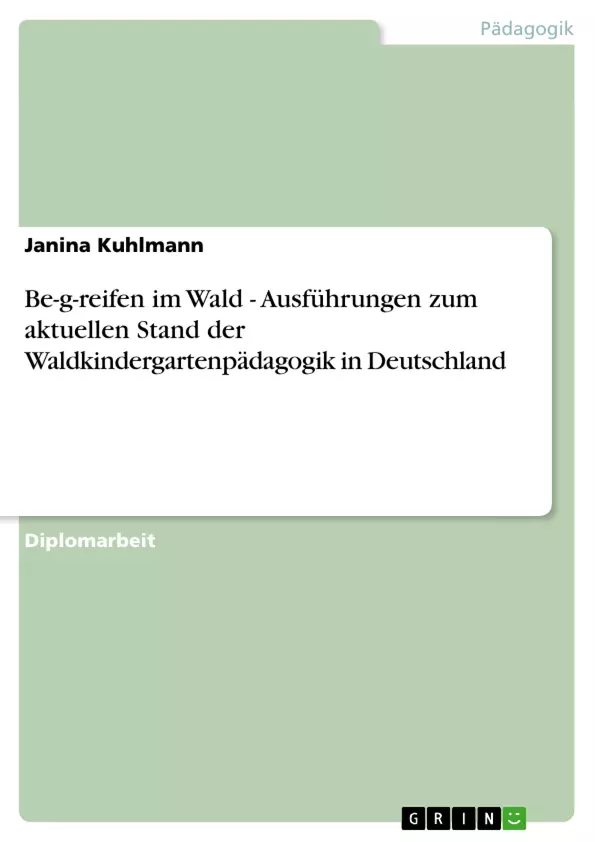[...] Betrachtet man die in Kap. 8.2 dargestellten Forschungsergebnisse, so lässt sich eine deutliche Veränderung der Kindheit in den letzten Jahrzehnten konstatieren und es erhebt sich die Frage, wie diese, auch angesichts der bestehenden Umweltproblematik, wohl in ca. 30 Jahren aussehen mag. Kinder nutzen für ihr Spiel zu nehmend mehr Innen- statt Außenräume. Verschiedene gesundheitliche Schäden im physischen, psychischen und sozialen Bereich sind die Folge. Welche Kompetenzen müssen den Kindern heute vermittelt werden, damit sie morgen verbesserte Lebensbedingungen und -chancen haben und die sie umgebende Umwelt lebens- und liebenswerter gestalten können? Welche der Entwicklung dienenden Handlungsschritte müssen hierfür unternommen werden? Kann das Modell „Waldkindergarten“, das sich als Gegenwehr zu diesen einschneidenden Veränderungen begreift, eine kompensierende Erziehungsarbeit in der frühen Kindheit leisten? Aus welcher Notwendigkeit heraus wurden die ersten Waldkindergärten gegründet? Mussten sie entstehen? Auf welchem Stand ist die Waldkindergartenpädagogik als Teilareal der Umweltpädagogik heute und welche Zukunftschancen hat sie? Betrachtet man Kinder und Bäume, so lassen sich elementare Gemeinsamkeiten erkennen – beide wachsen und benötigen hierfür Raum und Zeit. Dies legt die Vermutung nahe, dass ein Waldkindergarten der ideale Ort für Kinder ist, sich in scheinbar grenzenlosen Raum-Zeit-Gefilden zu entwickeln. Hieraus leitet sich die globale Fragestellung der Arbeit ab: Ist der Waldkindergarten eine innovative Form der Kindergartenpädagogik, die den Bedürfnissen der Kinder gerecht wird, ihre optimale Entwicklung fördert und das kindliche Leben positiv beeinflusst? Intention dieser Arbeit ist es, Antwort auf diese Fragen zu finden. Dabei geht es nicht darum, flächendeckende Vergleiche zu bestehenden Alternativmodellen der Vorschulpädagogik zu ziehen oder eine komplette Aufstellung von Positiv- und Negativfaktoren in Bezug auf die kindliche Entwicklung vorzunehmen. Es soll, wie es auch der Übertitel der Arbeit „Be-g-reifen im Wald“ ausdrückt, erörtert werden, wie Kinder begreifen, indem sie greifen und wie sie daran reifen, denn „begreifen“ fängt im wahrsten Sinne des Wortes mit dem „Greifen“ an (Liemertz, 2002, S. 102 f.) oder wie Fröbel schon meinte: „Vor dem Begreifen kommt das Greifen.“ (Konzeption, Wakiga Erfurt, S. 12) und erfolgreiches „Begreifen“ lässt Kinder zweifelsohne auch reifen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Kind im Wald - ein Entwicklungsraum für die Zukunft
- Der Wald als Lernort
- Kindliche Naturerfahrungen
- Naturerfahrung und Bildung
- Rezeption von Natur
- Der Wald als Experimentierfeld
- Der Waldkindergarten - eine pädagogische Alternative
- Der Waldkindergarten als Institution
- Waldpädagogik im Spannungsfeld zwischen Theorie und Praxis
- Entstehung und Verbreitung von Waldkindergärten
- Konzeption des „Waldkindergartens“
- „Waldpädagogik - Ein neuer Zugang zur Umweltpädagogik“
- Wald und Umwelt
- Die Notwendigkeit einer Umweltpädagogik
- Waldpädagogik in der Praxis
- Zusammenhänge und Wechselwirkungen von Waldpädagogik und Umweltpädagogik
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit „Be-g-reifen im Wald“ befasst sich mit dem aktuellen Stand der Waldkindergartenpädagogik in Deutschland. Sie analysiert die Entwicklung und Verbreitung dieser pädagogischen Alternative und untersucht die Rolle des Waldes als Lernort und Experimentierfeld für Kinder. Dabei werden die Konzepte der Waldpädagogik und Umweltpädagogik beleuchtet und deren Wechselwirkungen dargestellt.
- Der Wald als Lernort für Kinder
- Die Bedeutung kindlicher Naturerfahrungen
- Das Konzept des Waldkindergartens als pädagogische Alternative
- Die Rolle der Waldpädagogik im Spannungsfeld zwischen Theorie und Praxis
- Die Verknüpfung von Waldpädagogik und Umweltpädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext und die Motivation der Diplomarbeit dar und beleuchtet die aktuelle Situation der Waldkindergartenpädagogik in Deutschland.
Das Kapitel „Das Kind im Wald“ untersucht den Wald als Entwicklungsraum für Kinder und analysiert die Bedeutung von kindlichen Naturerfahrungen für die Bildung und Entwicklung. Die Rezeption von Natur und die Rolle des Waldes als Experimentierfeld werden dabei genauer betrachtet.
Das Kapitel „Der Waldkindergarten - eine pädagogische Alternative“ beschreibt die Entstehung, Entwicklung und Verbreitung von Waldkindergärten in Deutschland. Es werden verschiedene Konzepte und Ansätze der Waldkindergartenpädagogik vorgestellt und das Spannungsfeld zwischen Theorie und Praxis beleuchtet.
Das Kapitel „„Waldpädagogik - Ein neuer Zugang zur Umweltpädagogik““ behandelt die Bedeutung von Waldpädagogik für die Umweltpädagogik. Es beleuchtet die Notwendigkeit einer Umweltpädagogik und untersucht die Praxis der Waldpädagogik im Kontext der Umweltbildung. Die Zusammenhänge und Wechselwirkungen von Waldpädagogik und Umweltpädagogik werden dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Diplomarbeit beschäftigt sich mit den Themen Waldkindergarten, Waldpädagogik, Umweltpädagogik, Naturerfahrung, kindliche Entwicklung, Bildung, pädagogische Alternative, Lernort, Experimentierfeld, Theorie und Praxis.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere an der Waldkindergartenpädagogik?
Kinder verbringen den gesamten Alltag im Wald, was ihre motorische, psychische und soziale Entwicklung durch unmittelbare Naturerfahrung fördert.
Warum sind Waldkindergärten heute notwendiger denn je?
Angesichts zunehmender Medialisierung und Bewegungsmangel in Innenräumen bietet der Wald einen kompensatorischen Erziehungsraum für Kinder.
Was bedeutet "Be-g-reifen" im Kontext dieser Arbeit?
Es bezieht sich auf das Zitat "Vor dem Begreifen kommt das Greifen" – Kinder lernen durch das physische Anfassen und Erleben der Natur, was zu ihrer Reifung beiträgt.
Wie hängen Waldpädagogik und Umweltpädagogik zusammen?
Waldpädagogik wird als Teilareal der Umweltpädagogik gesehen, das Kindern hilft, ein tieferes Verständnis und eine Wertschätzung für ihre Umwelt zu entwickeln.
Welche Kompetenzen erwerben Kinder im Waldkindergarten?
Neben körperlicher Fitness werden Kreativität, Problemlösekompetenz im Experimentierfeld Natur und soziale Fähigkeiten in der Gruppe gestärkt.
- Citar trabajo
- Janina Kuhlmann (Autor), 2004, Be-g-reifen im Wald - Ausführungen zum aktuellen Stand der Waldkindergartenpädagogik in Deutschland, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31628