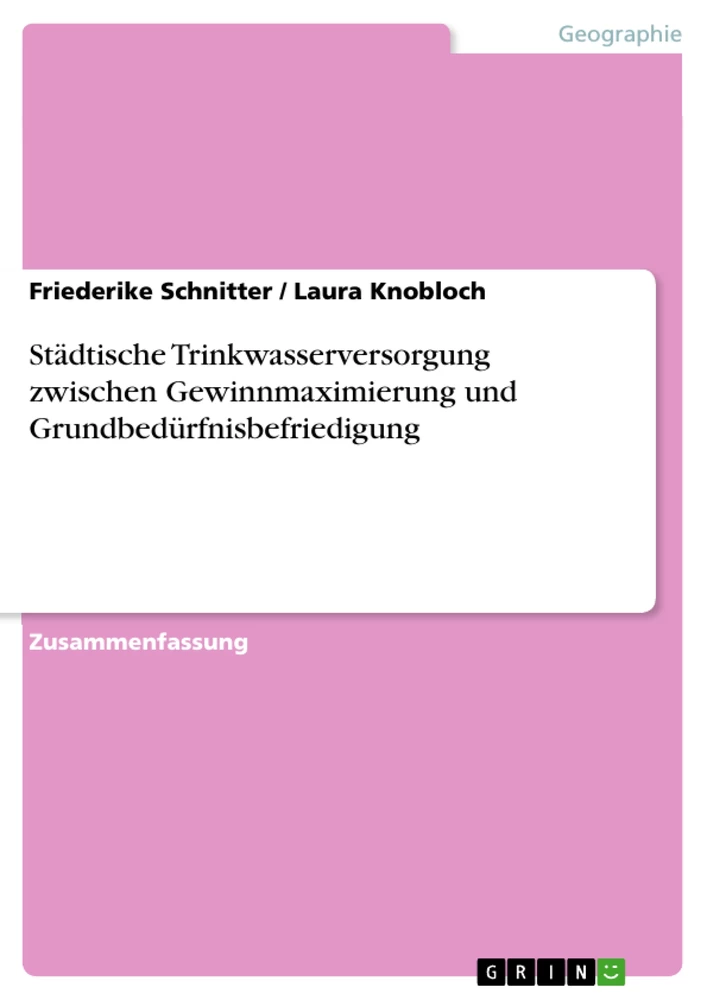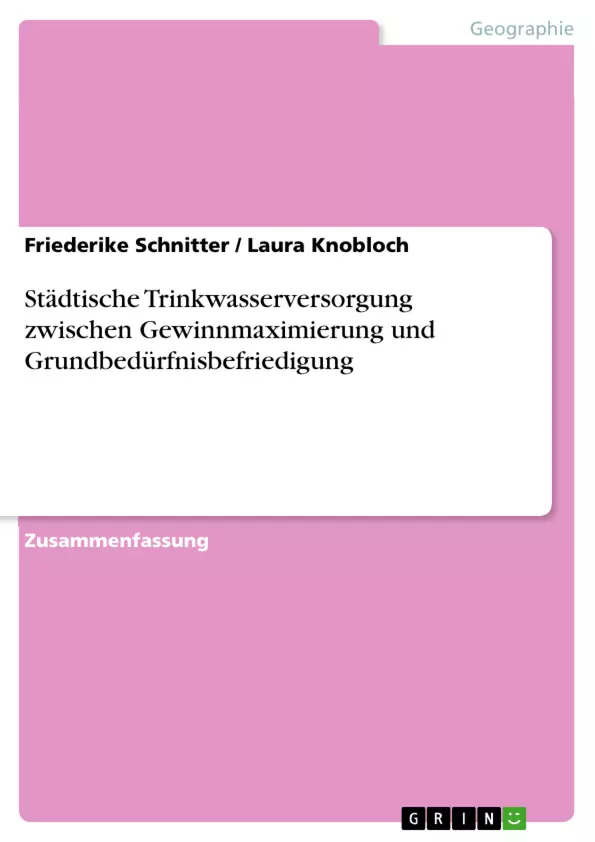Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Umständen einer Privatisierung städtischer Trinkwasserversorgung und untersucht dazu das Fallbeispiel der philippinischen Hauptstadt Manila.
Aus dem Inhalt:
1 Dimensionen von Wasser
2 Wissenschaftstheoretische Einordnung
3 Privatisierung von Wasser
3.1 Driver
3.2 Akteure
4 Beispiele
4.1 Internationale Fallbeispiele
4.2 Fallbeispiel Manila
5 Gruppenarbeit/Diskussion
6 Quellen
Inhaltsverzeichnis
- 1 Dimensionen von Wasser
- Wasser: ein Menschenrecht
- Trinkwasser: Gemeingut & Grundbedürfnis
- Trinkwasser: Grundbedürfnis
- Wasser: Religiöse Bedeutung
- Wasser: Wirtschaftsgut
- Süßwasser: eine knappe Ressource
- 2 Wissenschaftstheoretische Einordnung
- 3 Privatisierung von Wasser
- 3.1 Driver
- 3.2 Akteure
- 4 Beispiele
- 4.1 Internationale Fallbeispiele
- 4.2 Fallbeispiel Manila
- 5 Gruppenarbeit/Diskussion
- 6 Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der komplexen Beziehung zwischen der Trinkwasserversorgung in städtischen Gebieten und den Spannungen zwischen Gewinnmaximierung und der Befriedigung grundlegender Bedürfnisse. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Dimensionen von Wasser, untersucht die wissenschaftstheoretische Einordnung des Themas und beleuchtet die Auswirkungen der Privatisierung von Wasser.
- Die Bedeutung von Wasser als Menschenrecht und Gemeingut
- Die Herausforderungen der Wasserknappheit und der nachhaltigen Wasserbewirtschaftung
- Die Auswirkungen der Privatisierung von Wasser auf die soziale Gerechtigkeit und den Zugang zu sauberem Trinkwasser
- Die Rolle von verschiedenen Akteuren in der Wasserversorgung und -verwaltung
- Die Analyse internationaler Fallbeispiele und die Herausforderungen der Wasserversorgung in Städten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die verschiedenen Dimensionen von Wasser, beginnend mit der Anerkennung als Menschenrecht und der Bedeutung als Gemeingut. Es untersucht die Frage nach der Definition des Grundbedürfnisses und der Quantifizierung des Wasserbedarfs. Weiterhin werden die religiöse Bedeutung von Wasser und die wirtschaftliche Komponente als knappes Gut betrachtet. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der wissenschaftstheoretischen Einordnung der Ressourcenbewirtschaftung und stellt verschiedene Modelle zur Nutzung und Organisation von Ressourcen gegenüber. Das dritte Kapitel beleuchtet die Privatisierung von Wasser und analysiert die zugrundeliegenden Treiber und Akteure. Abschließend werden im vierten Kapitel internationale Fallbeispiele und das Fallbeispiel Manila vorgestellt, um die Herausforderungen der Wasserversorgung in Städten zu verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Trinkwasserversorgung, städtische Gebiete, Gewinnmaximierung, Grundbedürfnisbefriedigung, Menschenrecht, Gemeingut, Wasserknappheit, Privatisierung, Akteure, Fallbeispiele, Manila.
- Citation du texte
- Friederike Schnitter (Auteur), Laura Knobloch (Auteur), 2014, Städtische Trinkwasserversorgung zwischen Gewinnmaximierung und Grundbedürfnisbefriedigung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/316316