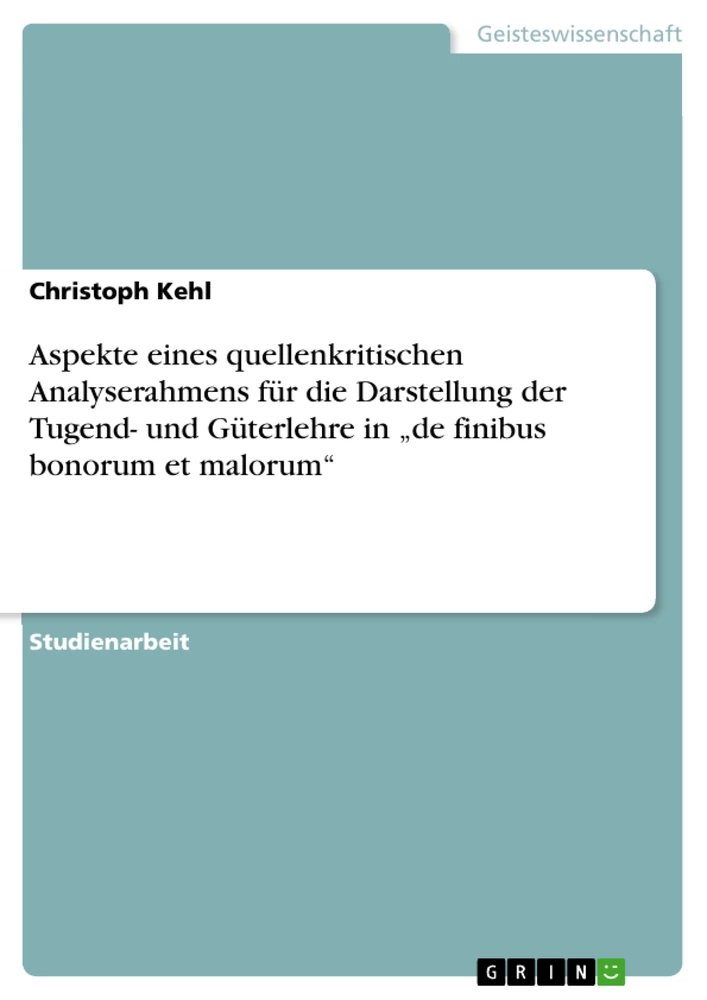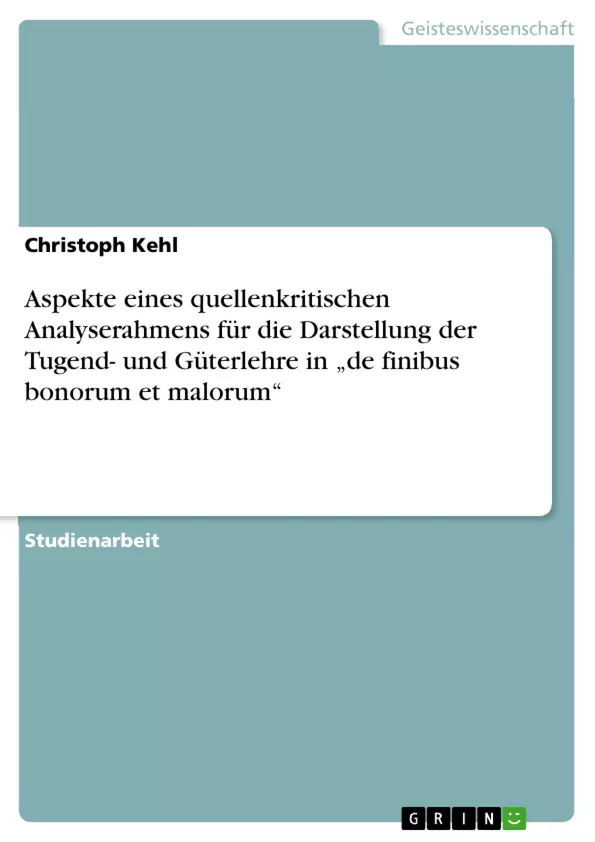Obgleich die Frage nach der Suffizienz der Tugend eine der zentralen Thematiken in Ciceros philosophischem Werke ist, scheint er zu keiner zufriedenstellenden Antwort zu kommen. In seinem Werk "de finibus bonorum et malorum" widmet sich der antike Staatsmann, Redner und Philosoph den einzelnen Schulen der hellenistischen Philosophie. Geradezu schematisch bearbeitet er zunächst den Epikureismus, daran anschließend die Stoa und schließlich die Lehre der Akademie und des Peripatos. Cicero geht dabei stets ähnlich vor: Nach einer zumeist ausführlichen Darlegung der Lehre folgt eine kritische Stellungnahme.
Das Buch V nimmt im gesamten Werk eine Sonderstellung ein. Nicht nur, dass es sich um das letzte Buch des Werkes handelt, in dem der Leser eine Antwort auf die Fragen nach dem finis bonorum et malorum erwartet, auch der Aufbau wirkt anders, der Schematismus der vorangegangenen Bücher durchbrochen. Ausgangslage und Szenerie unterscheiden sich bereits zum Vorangegangenen. Den inhaltlichen Schwerpunkt bildet Pisos Darstellung der peripatetisch-akademischen Ethik in der Tradition des Antiochos von Askalon, bei welchem er genau wie Cicero mehrere Monate gehört hatte.
Aufbau und Inhalt von de finibus sind in der Philosophie wie Philologie vielfach analysiert worden. Interessant und selten näher beleuchtet ist hingegen die Frage, welche Einflüsse zu einer solchen Darstellung der Thematik führten, woher seine Kenntnisse darüber stammen und in welchem Maße das Werk eine Eigenleistung Ciceros oder möglicherweise zu großen Teilen auf seine Quellen zurückzuführen ist. Im Folgenden soll anhand einer exemplarischen Untersuchung der Darstellung der peripatetisch-akademischen Tugend- und Güterlehre gezeigt werden, welche Ergebnisse eine quellenkritische Annäherung an den Text liefern kann. Es geht dabei nicht um eine erschöpfende Darstellung einzelner Quellen oder philosophischer Fragen von ihrem ersten Aufkommen bis zum Aufgreifen Ciceros. Vielmehr soll versucht werden, einzelne Positionen und Einflüsse herauszuarbeiten und gegebenenfalls zuzuordnen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Darstellung der peripatetisch-akademischen Güterlehre in de finibus V
- Quellenkritische Analyse
- Philosophiegeschichtlicher Hintergrund
- Philon von Larisa und die akademische Skepsis
- Antiochos von Askalon und die Alte Akademie
- Ideengeschichtliche Analyse
- Strukturelle und methodische Einflüsse
- Ciceros literarische und philosophische Eigenleistung
- Philosophiegeschichtlicher Hintergrund
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung der peripatetisch-akademischen Tugend- und Güterlehre in Ciceros Werk "de finibus bonorum et malorum" und analysiert die Quellen, die zu dieser Darstellung beigetragen haben. Ziel ist es, einen erweiterten quellenkritischen Analyserahmen zu entwickeln, um die Eigenleistung Ciceros im Vergleich zu seinen Quellen zu beleuchten.
- Die peripatetisch-akademische Tugend- und Güterlehre in Ciceros Werk "de finibus bonorum et malorum"
- Quellenkritische Analyse der Darstellung der peripatetisch-akademischen Güterlehre
- Der Einfluss von Philon von Larisa und Antiochos von Askalon auf Ciceros Werk
- Die Eigenleistung Ciceros in der Darstellung der peripatetisch-akademischen Lehre
- Die Bedeutung der Quellenkritik für die Interpretation von Ciceros Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Ciceros Haltung gegenüber der Frage nach der Suffizienz der Tugend für ein glückseliges Leben vor und führt in das Thema der peripatetisch-akademischen Güterlehre in Ciceros Werk "de finibus bonorum et malorum" ein. Kapitel 2 analysiert die Darstellung der peripatetisch-akademischen Güterlehre in Buch V von "de finibus bonorum et malorum" und beleuchtet die Figurenkonstellation und Gesprächssituation. Die Quellenkritische Analyse in Kapitel 3 behandelt den philosophiegeschichtlichen Hintergrund, die ideengeschichtliche Analyse, die strukturellen und methodischen Einflüsse sowie Ciceros literarische und philosophische Eigenleistung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen peripatetisch-akademische Tugend- und Güterlehre, Cicero, "de finibus bonorum et malorum", Quellenkritik, Philon von Larisa, Antiochos von Askalon, Philosophiegeschichte, Ideengeschichte, strukturelle und methodische Einflüsse, literarische und philosophische Eigenleistung.
- Arbeit zitieren
- Christoph Kehl (Autor:in), 2013, Aspekte eines quellenkritischen Analyserahmens für die Darstellung der Tugend- und Güterlehre in „de finibus bonorum et malorum“, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/316354