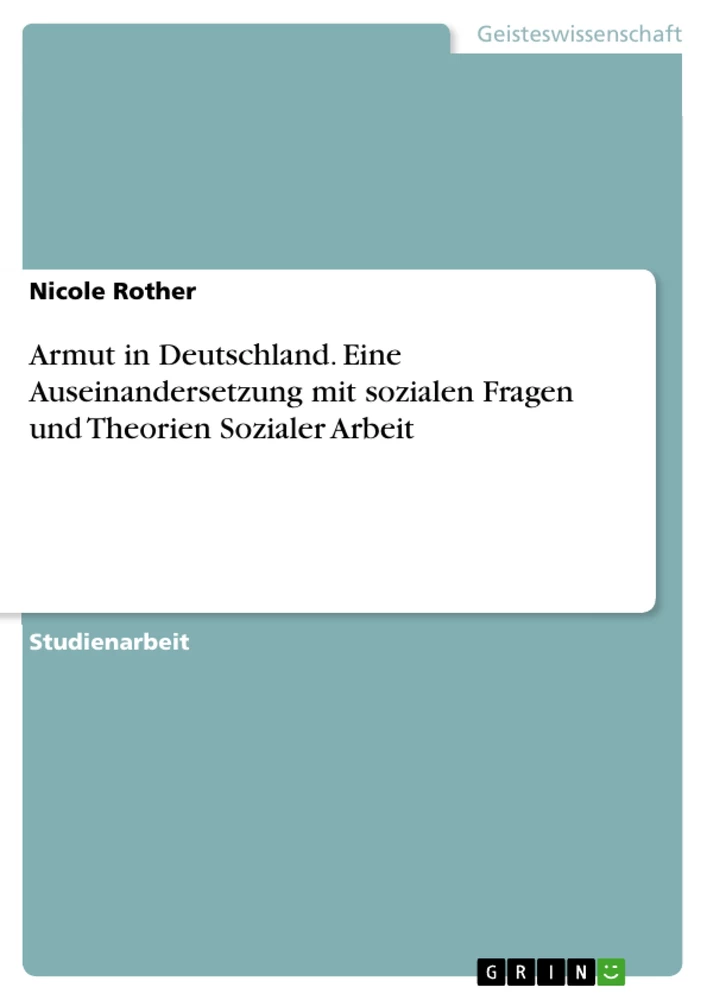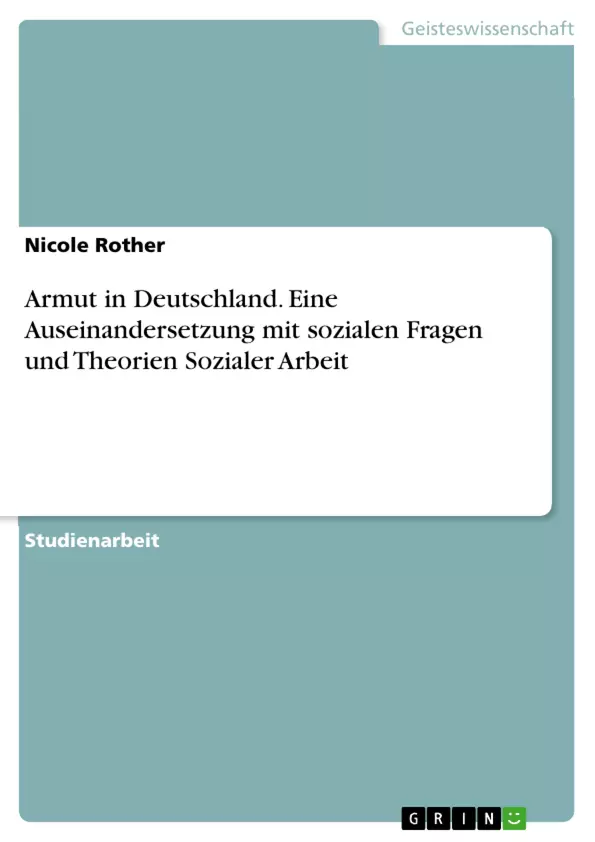Armut und das Leben am Existenzminimum sind keine ‚Erfindung der Neuzeit‘, es handelt sich um Thematiken, die in der Vergangenheit bereits oft diskutiert und bearbeitet wurden. Probleme, die sich in Deutschland beim Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft zeigten, werden deshalb unter dem Begriff – soziale Frage – subsummiert. Um was es sich dabei genau handelt, wurde im Seminar „Die Sozialpädagogik und die soziale(n) Fragen der Gegenwart“ ausgiebig beleuchtet. Aus diesem Grund wird im Folgenden eine Einordnung der Thematik – Armut – in diesen Seminarkontext erfolgen (Kapitel 2).
Außerdem wird das Thema in das Modul „Sozialpädagogik/Sozialmanagement I: Theorien und Methoden“ eingeordnet, für diese Verortung werden die sozialpädagogischen Dimensionen: gesellschaftlicher Kontext, Institutionen, sozialpädagogisch-professionelles Handeln und Lebenswelt der AdressatInnen, hinzugezogen. Eben diese Dimensionen sind kennzeichnend für eine Theorie der Sozialpädagogik, deshalb werden sie im dritten Kapitel zunächst genauer beschrieben, bevor die Einordnung erfolgen kann. Die darauffolgenden beiden Kapitel befassen sich mit dem Lebenslagenansatz (Kapitel 4) und dem professionalisierungstheoretischen Ansatz (Kapitel 5). Beide Theorien sind als Maßnahmen anzusehen, die sozialen Ungleichheiten entgegenwirken und Besserung bringen sollen. Im sechsten Kapitel erfolgt der Vergleich beider Theorien. Das siebte Kapitel beinhaltet das Resümee sowie einen Ausblick. Da es sich bei dieser Ausarbeitung um einen kurzen Überblick handelt, kann nicht alles, in aller Genauigkeit diskutiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Einordnung der Thematik in den Seminarkontext
- Die Sozialpädagogischen Dimensionen
- Der Lebenslagenansatz
- Der professionalisierungstheoretische Ansatz
- Vergleich beider Ansätze aus Kapitel 4 und Kapitel 5
- Resümee und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema Armut und der Einordnung dieser Thematik in den Kontext der Sozialpädagogik. Sie analysiert die sozialpädagogischen Dimensionen von Armut und betrachtet zwei Ansätze zur Bewältigung sozialer Ungleichheit: den Lebenslagenansatz und den professionalisierungstheoretischen Ansatz. Die Arbeit soll einen Überblick über die Problematik von Armut geben und mögliche Lösungsansätze aufzeigen.
- Die Einordnung von Armut in den Seminarkontext
- Die Analyse der sozialpädagogischen Dimensionen von Armut
- Die Darstellung des Lebenslagenansatzes
- Die Darstellung des professionalisierungstheoretischen Ansatzes
- Der Vergleich beider Ansätze
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik von Armut in Deutschland dar und erläutert die Einordnung der Thematik in den Seminarkontext. Kapitel 2 betrachtet die Einordnung der Thematik in den Seminarkontext und beleuchtet die historische Entwicklung der sozialen Frage. Kapitel 3 beschreibt die sozialpädagogischen Dimensionen, die für das Verständnis von Armut relevant sind. Kapitel 4 und 5 befassen sich mit dem Lebenslagenansatz und dem professionalisierungstheoretischen Ansatz als zwei Ansätze zur Bewältigung sozialer Ungleichheit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen Armut, soziale Ungleichheit, Lebenslagenansatz, professionalisierungstheoretischer Ansatz, Sozialpädagogik, soziale Frage, Lebenswelt der AdressatInnen, gesellschaftlicher Kontext, Institutionen, sozialpädagogisch-professionelles Handeln.
- Citar trabajo
- Nicole Rother (Autor), 2014, Armut in Deutschland. Eine Auseinandersetzung mit sozialen Fragen und Theorien Sozialer Arbeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/316478