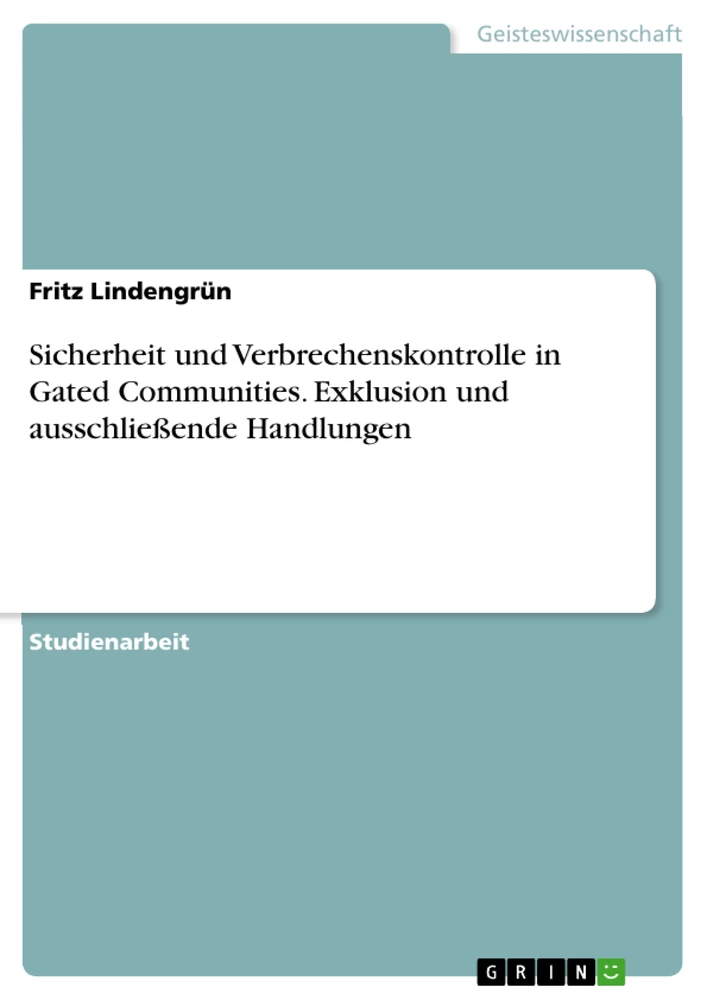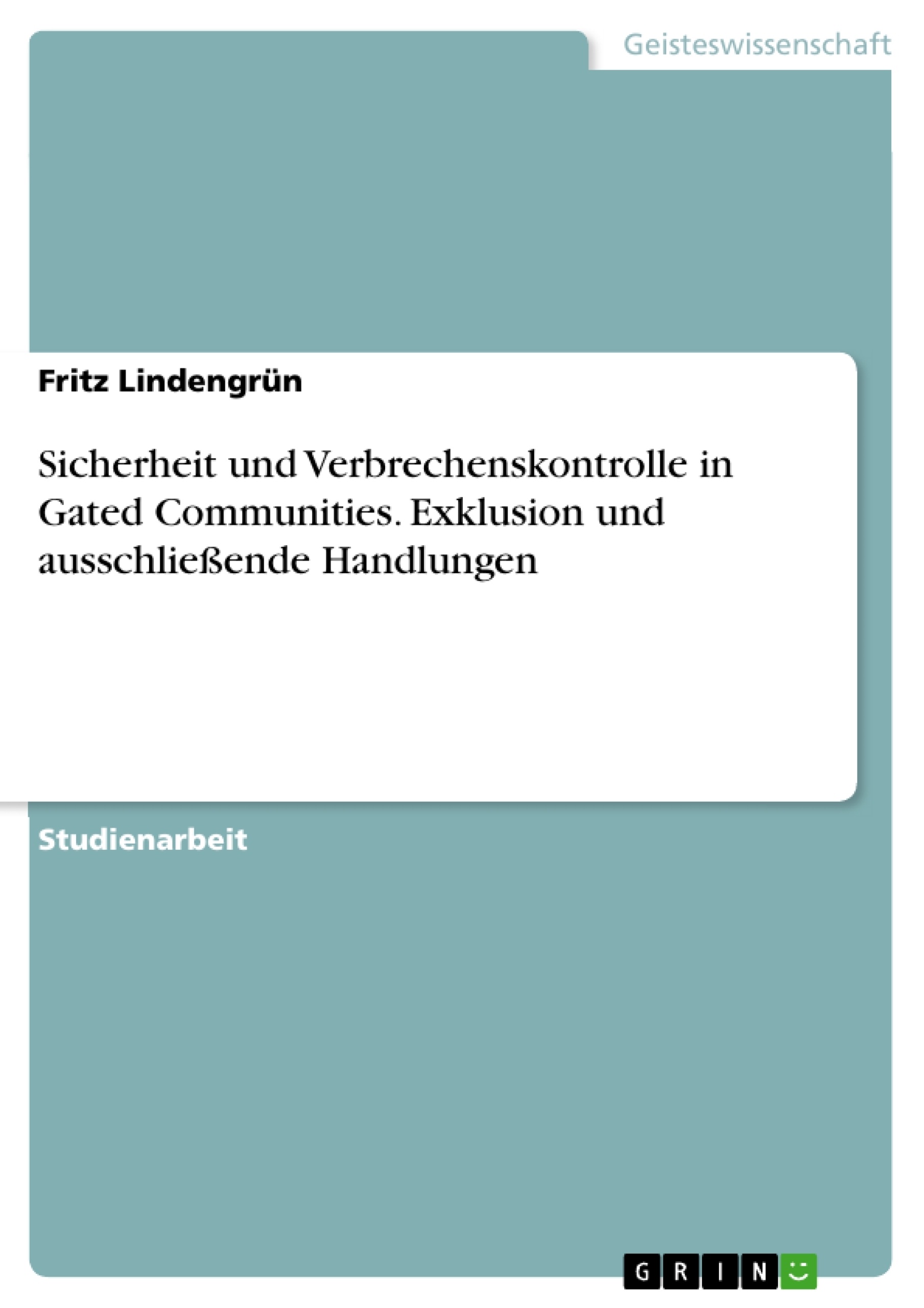Beschäftigt man sich mit dem Phänomen der sogenannten "gated communities", stößt man unweigerlich auf zwei Worte: „Exklusion“ und „ausschließen“. Ziel dieser Arbeit ist es, sich mit diesen beiden Begriffen auseinanderzusetzen und sie im Kontext der gated communities näher zu beleuchten.
Dabei wird ein kurzer Abriss verschiedener theoretischer Zugänge zu „Exklusion“ und „ausschließen“ präsentiert (Systemtheorie, soziale Schließung), die als Grundlage für das hier vorgestellte Konzept der „ausschließenden Handlungen“ dienen sollen. Etwas abseits davon soll auch auf einen weiteren Aspekt eingegangen werden, der gated communities oftmals zugeordnet wird, nämlich dem der Sicherheit und Verbrechenskontrolle.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Exklusion und ausschließende Handlungen
- 2.1 Exklusion in der Systemtheorie
- 2.2 Ausschluss in den Wirtschaftswissenschaften: Das Ausschließbarkeitsprinzip
- 2.3 Soziale Schließung
- 2.4 Ausschließende Handlungen
- 3. Ausschluss und Exklusion in der Literatur über Gated communities
- 4. Gated communities im Kontext von Devianz und sozialer Kontrolle
- 5. Synopsis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Begriffe "Exklusion" und "Ausschließen" im Kontext von Gated Communities. Sie beleuchtet verschiedene theoretische Zugänge zu diesen Begriffen und entwickelt das Konzept der "ausschließenden Handlungen". Der Fokus liegt dabei nicht auf der Entwicklung einer neuen Theorie, sondern auf der Definition eines analytischen Rahmens für die Untersuchung von Gated Communities. Zusätzlich wird der Aspekt der Sicherheit und Verbrechenskontrolle in Gated Communities betrachtet.
- Theoretische Konzepte von Exklusion und Ausschluss
- Ausschließende Handlungen als analytisches Konzept
- Gated Communities als Fallbeispiel für Exklusion
- Der Zusammenhang zwischen Gated Communities, Devianz und sozialer Kontrolle
- Die Rolle von Raum und Ressourcen in Exklusionsprozessen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Gated Communities ein und benennt die zentralen Begriffe "Exklusion" und "Ausschließen" als Untersuchungsgegenstand. Sie skizziert die Zielsetzung der Arbeit, die darin besteht, diese Begriffe im Kontext von Gated Communities zu analysieren und verschiedene theoretische Ansätze zu präsentieren. Dabei wird betont, dass das Ziel nicht die Entwicklung einer neuen Theorie ist, sondern die Schaffung eines analytischen Rahmens für die Untersuchung des Phänomens. Der Aspekt der Sicherheit und Verbrechenskontrolle in Gated Communities wird als weiterer wichtiger Punkt angesprochen.
2. Exklusion und ausschließende Handlungen: Dieses Kapitel untersucht den Begriff "Exklusion" in seiner allgemeinen und soziologischen Bedeutung. Es werden unterschiedliche Interpretationen des Begriffs diskutiert, insbesondere im Hinblick auf soziale Exklusion. Es wird zwischen dem wertneutralen Begriff des "Ausschlusses" und dem soziologisch aufgeladenen Begriff der "Exklusion" differenziert. Das Kapitel dient als Grundlage für die Einführung des Konzepts "ausschließender Handlungen", das im weiteren Verlauf der Arbeit zentral ist. Es werden verschiedene Perspektiven auf Ausschluss, insbesondere aus der Systemtheorie und den Wirtschaftswissenschaften, herangezogen und kritisch beleuchtet.
3. Ausschluss und Exklusion in der Literatur über Gated communities: Dieses Kapitel analysiert die Thematik von Exklusion und Ausschluss innerhalb der wissenschaftlichen Literatur zu Gated Communities. Es beleuchtet die Definition von Gated Communities, identifiziert die handelnden Akteure (Subjekte des Ausschlusses) und die betroffenen Personen oder Gruppen (Objekte des Ausschlusses). Der Fokus liegt auf der Erforschung der Auswirkungen (Effekte) der Exklusionsmechanismen in diesen geschlossenen Wohnsiedlungen.
4. Gated communities im Kontext von Devianz und sozialer Kontrolle: Dieses Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen Gated Communities, Devianz und sozialer Kontrolle. Es analysiert, inwieweit Gated Communities als Ausdruck von Devianz oder als Mittel zur sozialen Kontrolle verstanden werden können. Es wird der Frage nachgegangen, welche Rolle diese Gemeinschaften in der Herstellung und Aufrechterhaltung sozialer Ordnung spielen.
Schlüsselwörter
Exklusion, Ausschluss, Gated Communities, Soziale Schließung, Ausschließende Handlungen, Systemtheorie, Wirtschaftswissenschaften, Devianz, Soziale Kontrolle, Sicherheit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Exklusion und Ausschluss in Gated Communities
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Begriffe "Exklusion" und "Ausschließen" im Kontext von Gated Communities. Sie analysiert verschiedene theoretische Ansätze und entwickelt das Konzept der "ausschließenden Handlungen" als analytischen Rahmen für die Untersuchung dieses Phänomens. Ein weiterer Fokus liegt auf dem Aspekt der Sicherheit und Verbrechenskontrolle in Gated Communities.
Welche theoretischen Ansätze werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene theoretische Zugänge zu Exklusion und Ausschluss, insbesondere aus der Systemtheorie und den Wirtschaftswissenschaften. Es wird zwischen dem wertneutralen Begriff des "Ausschlusses" und dem soziologisch aufgeladenen Begriff der "Exklusion" differenziert. Das Konzept der "ausschließenden Handlungen" wird als zentrales analytisches Werkzeug eingeführt.
Was sind "ausschließende Handlungen"?
Die Arbeit entwickelt das Konzept der "ausschließenden Handlungen" als analytischen Rahmen. Es dient der Untersuchung von Mechanismen der Exklusion in Gated Communities, ohne eine neue umfassende Theorie zu formulieren.
Wie werden Gated Communities in dieser Arbeit betrachtet?
Gated Communities dienen als Fallbeispiel für die Analyse von Exklusion und Ausschluss. Die Arbeit untersucht die Definition von Gated Communities, identifiziert die Akteure des Ausschlusses und die betroffenen Gruppen, und analysiert die Auswirkungen der Exklusionsmechanismen.
Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Gated Communities, Devianz und sozialer Kontrolle?
Die Arbeit untersucht, inwieweit Gated Communities als Ausdruck von Devianz oder als Mittel zur sozialen Kontrolle verstanden werden können und welche Rolle sie in der Herstellung und Aufrechterhaltung sozialer Ordnung spielen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Exklusion und ausschließende Handlungen, Ausschluss und Exklusion in der Literatur über Gated Communities, Gated Communities im Kontext von Devianz und sozialer Kontrolle, und Synopsis.
Welche Schlüsselbegriffe werden behandelt?
Schlüsselbegriffe sind Exklusion, Ausschluss, Gated Communities, Soziale Schließung, Ausschließende Handlungen, Systemtheorie, Wirtschaftswissenschaften, Devianz, Soziale Kontrolle und Sicherheit.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist nicht die Entwicklung einer neuen Theorie, sondern die Schaffung eines analytischen Rahmens zur Untersuchung von Exklusion und Ausschluss in Gated Communities. Die Arbeit soll verschiedene theoretische Ansätze präsentieren und die Bedeutung von "ausschließenden Handlungen" hervorheben.
- Quote paper
- Fritz Lindengrün (Author), 2015, Sicherheit und Verbrechenskontrolle in Gated Communities. Exklusion und ausschließende Handlungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/316488