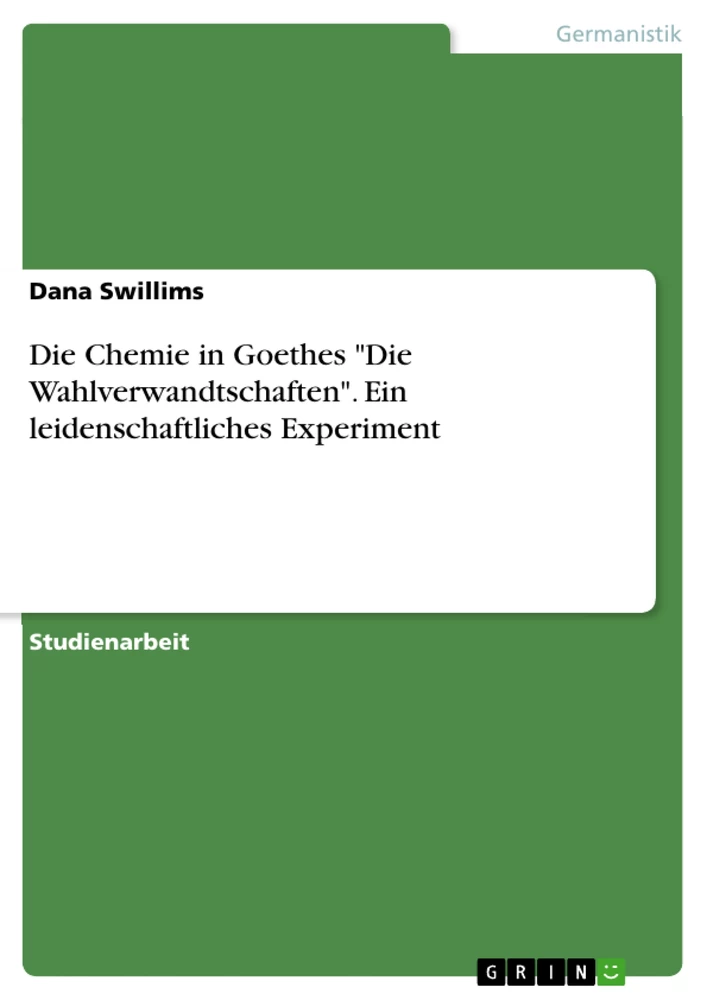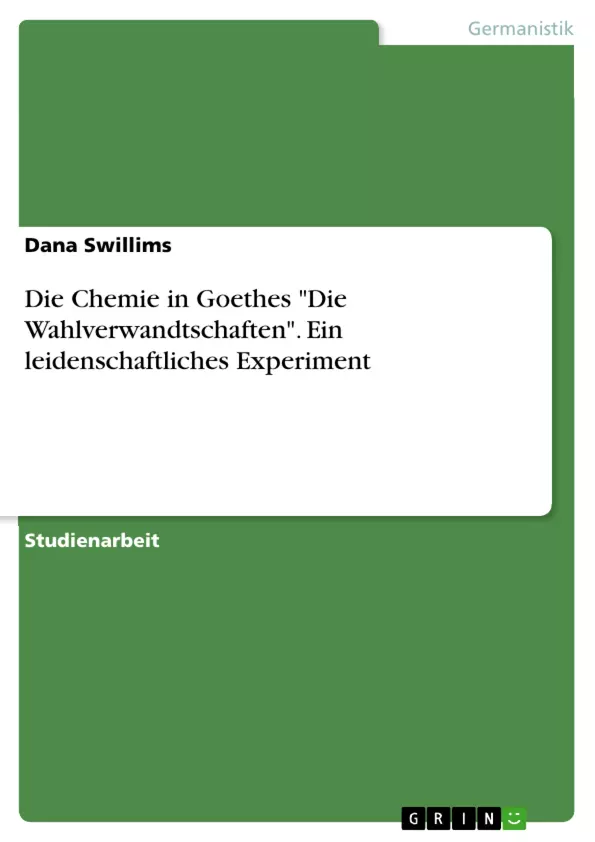Goethes Roman "Die Wahlverwandschaften" (1809) zeigt genau die Vereinbarung der scheinbar gegensätzlichen Begriffe Wissenschaft und Poesie. Der Roman stellt nach Adler „eine einzigartige Synthese von Literatur und Naturwissenschaften dar“ (Adler 1987, S. 9). Bereits der gewählte Titel verweist auf die Bedeutung der Naturwissenschaften für den Roman. Der Begriff der „Wahlverwandtschaft“ ist in der Chemie des achtzehnten Jahrhunderts zu verorten und beschreibt die Eigenschaft bestimmter chemischer Elemente, bei der Annäherung anderer Stoffe ihre bestehenden Verbindungen zu lösen und sich mit den neu hinzugekommenen Elementen zu vereinigen. Der Roman stützt sich auf diese Theorie der Wahlverwandtschaften und überträgt diese auf menschliche Verhältnisse. Es scheint, als habe Goethe großes Vergnügen, innerhalb des Romans statt mit Stoffen mit Menschen zu experimentieren.
Zentrale Kapitel, die einen besonderen Bezug zur Chemie haben, sollen innerhalb dieser Arbeit näher beleuchtet werden und es soll überprüft werden, inwiefern die chemischen Gesetze die menschlichen Leidenschaften der Protagonisten erklären können.
Im Fokus steht dabei das vierte Kapitel des ersten Teils, welches die Gleichnisrede beinhaltet, innerhalb derer die chemische Theorie der Verwandtschaften mit vielen Einzelheiten besprochen, und die Handlung des Romans bis zu einem gewissen Maß vorhersagt wird. Die Diskussion der Figuren dreht sich um Anziehungen und Abstoßungen von Elementen. Im weiteren Verlauf des Romans wird die Lehre der Verwandtschaften auf menschliche Verhältnisse übertragen und am Beispiel der Protagonisten ergänzt und erweitert. Weiterhin sollen die ersten Kapitel des Romans betrachtet werden, da dies bereits zahlreiche Verweise auf chemische Hintergründe beinhalteten.
Überdies soll genauer beleuchtet werden, inwiefern die Elemente den Romanfiguren zugeordnet werden können. Dies soll mit Textstellen aus dem Roman belegt werden. Ich stützte mich in dieser Arbeit insbesondere auf die Arbeiten von Adler (1987) und Wiethölter (1982), die sich beide in umfassender Weise mit der Chemie in den Wahlverwandtschaften auseinandergesetzt haben. Gewiss lassen sich die Theorien der beiden auch durch einige Textstellen widerlegen, wie auch in der Literatur bereits geschehen. Dennoch möchte ich mich der Lesart der beiden Autoren anschließen und versuchen ihre Theorien durch entsprechende Textstellen zu untermauern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition „Wahlverwandtschaft“ in der Chemie
- Kapitel 1 und 2
- Zuordnung der Figuren des Romans zu den Elementen (nach Wiethölter)
- Kapitel 4: Die Gleichnisrede
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Bedeutung der Chemie im Roman „Die Wahlverwandtschaften“ von Johann Wolfgang von Goethe. Ziel ist es, die chemischen Gesetze zu analysieren und zu untersuchen, inwiefern sie die menschlichen Leidenschaften der Protagonisten erklären können.
- Die chemische Theorie der Wahlverwandtschaften im Kontext des Romans
- Die Übertragung chemischer Gesetze auf menschliche Verhältnisse
- Die Bedeutung der Gleichnisrede im vierten Kapitel des Romans
- Die Zuordnung der Romanfiguren zu den Elementen
- Die Rolle der Naturwissenschaften in Goethes Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext des Romans „Die Wahlverwandtschaften“ dar und zeigt die Verbindung zwischen Wissenschaft und Poesie auf. Das zweite Kapitel beleuchtet die Definition der „Wahlverwandtschaft“ in der Chemie und verweist auf die Bedeutung der Theorie von Torbern Bergman. Kapitel 3 analysiert die ersten beiden Kapitel des Romans und zeigt die Verbindung zwischen den Figuren und chemischen Experimenten auf. Das vierte Kapitel beleuchtet die Zuordnung der Romanfiguren zu den Elementen nach Wiethölter und bereitet die Analyse der Gleichnisrede im vierten Kapitel vor.
Schlüsselwörter
Chemie, Wahlverwandtschaften, Goethe, Roman, Naturwissenschaften, Poesie, Figuren, Elemente, Gleichnisrede, Liebe, Leidenschaften, Beziehungen, Experiment, Adler, Wiethölter.
- Quote paper
- Dana Swillims (Author), 2012, Die Chemie in Goethes "Die Wahlverwandtschaften". Ein leidenschaftliches Experiment, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/316498