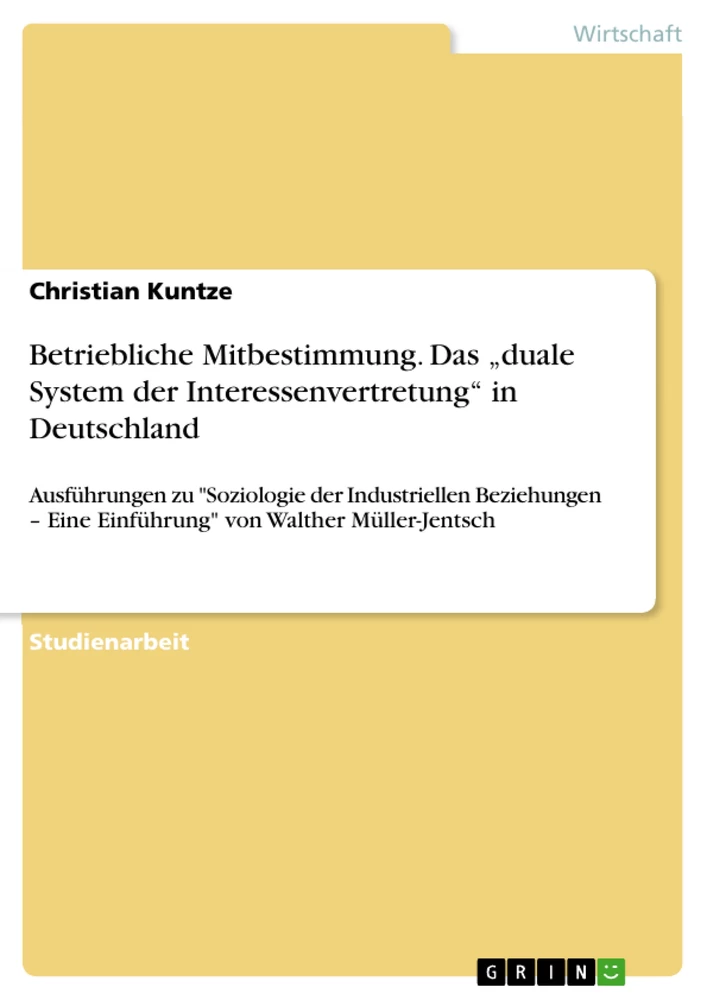Das Recht auf Partizipation der arbeitenden Menschen am betrieblichen Geschehen, wie es sich vornehmlich in der Institution des Betriebsrates ausdrückt, ist aus historischer Perspektive alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Gleichwohl ist dieses Recht aus einem langen historischen Prozess erwachsen und findet heute seinen Ausdruck vor allem im Betriebsverfassungsgesetz.
Im Folgenden wird die betriebliche Mitbestimmung anhand des Kapitels „Betriebliche Interessenvertretung der Arbeitnehmer“ aus dem Buch „Soziologie der Industriellen Beziehungen – Eine Einführung“ (1997) von Walther Müller-Jentsch besprochen. Der vorliegende Text von Walther Müller-Jentsch beschäftigt sich mit eben dieser rechtlich institutionalisierten Form der betrieblichen Mitbestimmung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung.
- Historische Entwicklung der betrieblichen Mitbestimmung
- Vorgeschichte und Entstehung des Betriebsrätegesetzes.
- Die Rolle der Gewerkschaften
- Inhalt des Betriebsrätegesetzes.....
- Weitere Entwicklung bis zur Gegenwart
- Allgemeine Daten zum Betriebsverfassungsgesetz.
- Geltungsbereich....
- Zahl der Betriebsratsmitglieder.
- Existenz von Betriebsräten nach der Anzahl der Beschäftigten.
- Gesetzliche Stellung und Handlungsrahmen des Betriebsrates...
- Gewerkschaftsunabhängige Stellung
- Repräsentativorgan.......
- Handlungsrahmen.......
- Allgemeine Grundlagen zu Beteiligungsrechten
- Vorteile einer Partizipation für den Arbeitnehmer und Arbeitgeber......
- Partizipationsmöglichkeiten
- Partizipationsrechte des Betriebsrates nach dem BetrVG.
- Soziale Angelegenheiten
- Personelle Angelegenheiten.
- Wirtschaftliche Angelegenheiten.
- Verhältnis zwischen Betriebsrat und Management.
- Der Betriebsrat als intermediäre Institution
- Literatur.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text von Walther Müller-Jentsch befasst sich mit der rechtlich institutionalisierten Form der betrieblichen Mitbestimmung in Deutschland, insbesondere mit dem Betriebsverfassungsgesetz. Er beleuchtet die historische Entwicklung der betrieblichen Mitbestimmung, die Rolle der Gewerkschaften und den Inhalt des Betriebsverfassungsgesetzes, einschließlich der Beteiligungsrechte des Betriebsrates. Der Text analysiert auch das Verhältnis zwischen Betriebsrat und Management und beleuchtet die intermediäre Rolle des Betriebsrates als Interessenvertretung des Faktors Arbeit.
- Die historische Entwicklung der betrieblichen Mitbestimmung in Deutschland
- Die Rolle der Gewerkschaften in der Entwicklung der betrieblichen Mitbestimmung
- Der Inhalt des Betriebsverfassungsgesetzes und die Beteiligungsrechte des Betriebsrates
- Das Verhältnis zwischen Betriebsrat und Management
- Die intermediäre Rolle des Betriebsrates
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Der Text stellt das Recht auf Partizipation der Arbeitnehmer am betrieblichen Geschehen in den Kontext der historischen Entwicklung und erläutert die Bedeutung des Betriebsverfassungsgesetzes. Er liefert einen Überblick über die Themen, die in den folgenden Kapiteln behandelt werden.
2. Historische Entwicklung der betrieblichen Mitbestimmung
Dieses Kapitel verfolgt die Entwicklung der betrieblichen Mitbestimmung von den Anfängen der Industrialisierung bis hin zur Entstehung des Betriebsrätegesetzes. Es beleuchtet die Rolle der Arbeiter- und Soldatenräte während der Weimarer Republik und die Bedeutung des Stinnes-Legien-Abkommens für die Beziehung zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern.
3. Allgemeine Daten zum Betriebsverfassungsgesetz.
Dieses Kapitel gibt einen Überblick über den Geltungsbereich des Betriebsverfassungsgesetzes, die Anzahl der Betriebsratsmitglieder und die Existenz von Betriebsräten in Abhängigkeit von der Anzahl der Beschäftigten.
4. Gesetzliche Stellung und Handlungsrahmen des Betriebsrates...
Dieses Kapitel beschreibt die rechtliche Stellung des Betriebsrates als gewerkschaftsunabhängiges Repräsentativorgan der gesamten Belegschaft. Es erläutert den vom Gesetzgeber festgelegten Handlungsrahmen, der auf den Prinzipien von Vertrauen, Frieden und Diskretion basiert.
5. Allgemeine Grundlagen zu Beteiligungsrechten
Dieses Kapitel beleuchtet die Vorteile der Partizipation für Arbeitnehmer und Arbeitgeber und stellt verschiedene Partizipationsmöglichkeiten vor.
6. Partizipationsrechte des Betriebsrates nach dem BetrVG.
Dieses Kapitel beschreibt die Beteiligungsrechte des Betriebsrates in den Bereichen soziale Angelegenheiten, personelle Angelegenheiten und wirtschaftliche Angelegenheiten.
7. Verhältnis zwischen Betriebsrat und Management.
Dieses Kapitel analysiert das Verhältnis zwischen Betriebsrat und Management und zeigt positive Tendenzen in dieser ambivalenten Beziehung auf.
8. Der Betriebsrat als intermediäre Institution
Dieses Kapitel fasst die intermediäre Rolle des Betriebsrates zusammen und betont seine Bedeutung als Interessenvertretung des Faktors Arbeit.
Schlüsselwörter
Betriebliche Mitbestimmung, Betriebsverfassungsgesetz, Gewerkschaften, Interessenvertretung, Partizipation, Betriebsrat, Management, Soziales, Wirtschaft, Arbeit, Arbeitsverhältnis, Recht, Gesetz, Geschichte, Entwicklung, Struktur, Organisation.
- Arbeit zitieren
- Christian Kuntze (Autor:in), 2003, Betriebliche Mitbestimmung. Das „duale System der Interessenvertretung“ in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/316548